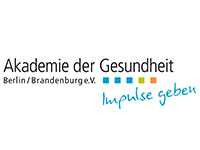News 2025
Research, Innovation, Patient care, Education / 22.12.2025
Entdecken, erfinden, ausgründen – wie Innovation in der Biomedizin gelingt
Interview mit der Leiterin der Abteilung Innovation & Entrepreneurship am Max Delbrück Center, Dr. Nevine Shalaby
Was hat Sie an Ihrer Position am Max Delbrück Center gereizt?
Ich bin promovierte Genetikerin und habe in meiner Laufbahn sowohl fundierte Erfahrungen in der Wissenschaft als auch in der Industrie gesammelt. Für mich ist es deshalb sehr reizvoll, die Brücke zwischen der akademischen Forschung und der Industrie zu stärken. Den entscheidenden Impuls, die Stelle anzutreten, hat für mich ein erster Austausch mit den Erfinder:innen gegeben. Sie stellten sehr interessante Fragen zur Markteinführung ihrer Entdeckungen – allesamt hervorragende Innovationen. Hier am Max Delbrück Center geht es um exzellente Wissenschaft und bahnbrechende Erkenntnisse. Die Forschenden brennen für ihre Entdeckungen und wollen wissen, wie sie sie in Anwendungs- oder Ausgründungsideen umsetzen können. Dazu beizutragen, diese Innovationen in marktfähige Produkte umzuwandeln, ist für mich Ansporn und eine großartige Aufgabe.
Wie ist der Technologietransfer aufgestellt, und welche Impulse möchten Sie setzen?
Wir sehen derzeit, dass es am Max Delbrück Center viele Entdeckungen gibt, die sich als potenzielle Innovations- oder Transferprojekte eignen würden. Daher investieren wir viel Zeit in die Suche nach neuen Projekten. Dabei tauschen wir uns direkt mit den Wissenschaftler:innen aus, um ihre Arbeit zu verstehen. Ebenso intensiv arbeiten wir daran, das Marktpotenzial der von uns identifizierten Entdeckungen zu bewerten.
Seit Anfang 2025 haben wir mehr als 30 neue Projekte von über 15 leitenden Forscher:innen gescoutet, 15 dieser Projekte sind erstmals im Fokus. Dadurch konnten wir unser Innovationsportfolio in den Bereichen Diagnostik, Therapien, Forschungsinstrumente und Plattformen für die Wirkstoffforschung/Biomarker deutlich erweitern.
Im Innovation- und Entrepreneurship-Team konzentrieren wir uns auf drei Säulen. Erstens: Den Schutz des geistigen Eigentums durch eine effektive Patentierung, die die Ideen schützt, ohne die Veröffentlichung zu verzögern. Zweitens: Das Einwerben von Finanzierungen, die es den Forschenden ermöglichen, sich vollständig auf die Produktentwicklung zu konzentrieren. Und drittens: Eine proaktive Geschäftsentwicklung, um unsere Projekte frühzeitig mit den passenden Industriepartner:innen, Expert:innen und/oder Investor:innen zusammenzubringen. Dieser integrierte Ansatz stellt sicher, dass aus wissenschaftlichen Entdeckungen des Max Delbrück Center tatsächlich tragfähige Produkte werden können, die Patient:innen zugutekommen.
Wir wollen zeigen, dass Gründen ein kreativer und lohnenswerter Prozess ist. Deshalb fördern wir unternehmerisches Denken im gesamten Max Delbrück Center und integrieren unsere Forschenden stärker in das Innovationsökosystem Berlins. Erfolgreiche Gründungen tragen auch zu unserer Strategie 2030 bei: Sie helfen, Spitzenkräfte zu gewinnen, und verstärken unseren Impact in die Gesellschaft.
Wie fördern Sie den Übergang von Forschungsergebnissen in marktfähige Produkte?
Neben Scouting, Hilfe bei der Einwerbung von Finanzierungen oder dem Ausbau von Industriepartnerschaften setzen wir vor allem auf entsprechende Weiterbildung und Netzwerke. Interne Förderprogramme wie BOOST (Proof-of-Idea) und PreGoBio (Proof-of-Concept) helfen Projekten in kritischen Phasen. Wir haben BOOST kürzlich von der jährlichen auf eine fortlaufende Ausschreibung umgestellt. Forschende können sich nun bewerben, sobald sie eine Idee haben, und müssen nicht mehr monatelang auf die Förderung warten. Dadurch bieten jetzt mehr Kolleg:innen ihre Projekte an – und die Vorbereitung auf größere Zuschüsse oder externe Förderungen läuft schneller.
Unser Team unterstützt die Forschenden auch dabei, Fördermittel in Programmen wie Helmholtz Enterprise, ERC Proof-of-Concept oder Go-Bio des Bundesforschungsministeriums zu beantragen. Dabei werden zugleich Ideen so weiterentwickelt, dass diese leichter in ein Start-up oder in Lizenzvereinbarungen mit der Industrie überführt werden können.
Ein Start-up im Life-Science-Bereich zu gründen, erfordert neue Kompetenzen, ein Marktverständnis und die Einwerbung von Risikokapital. Mit welchen Formaten unterstützen sie dies?
Die Gründung von Start-ups erfordert sowohl das Engagement der Erfinder:innen als auch die Unterstützung unseres Teams. Wir stellen die richtigen Werkzeuge und Anleitungen bereit und helfen den Wissenschaftler:innen auch dabei, frühzeitig Kontakte zu Risikokapitalgeber:innen und erfahrenen Gründer:innen zu knüpfen. Dies hilft ihnen, die praktischen Aspekte der Gründung eines Start-ups besser zu verstehen. Darüber hinaus unterstützen wir die Teilnahme an Accelerator- und Inkubator-Programmen wie dem Digital Health Accelerator, dem CLIC Incubator von BIH und Charité und dem Creative Disruption Lab, die alle strukturierte Anleitung, Mentoring und Networking-Möglichkeiten bieten. Wir stellen auch spezielle Inkubationsräume auf dem Campus zur Verfügung, damit Gründer:innen ihr akademisches Labor verlassen und als „Sciencepreneurs“ an ihrem Produkt arbeiten können. Dieser Prozess ist keineswegs einfach, und wir unterstützen dies so gut wie möglich.
In Kooperation mit dem H3 Health Hub und anderen Instituten von Helmholtz bieten wir Workshops zu Pharmaentwicklung oder Regulierungsprozessen an, die nicht nur die einzelnen Schritte der Produktentwicklung vermitteln. Dort geben Expert:innen auch schon frühzeitig Feedback zum jeweiligen Produkt. Außerdem sind wir dabei, selbst Inkubator-/Accelerator-Programme aufzubauen. Und wir bringen die Forschenden bei Networking-Veranstaltungen oder Venture-Capital-Tagen mit Risikokapitalgebern und Industriepartnern zusammen.
Ein entscheidender Faktor für jedes Start-up ist das richtige Team.
Genau! Es ist zentral, von Beginn an wirtschaftliche Expertise in das Start-up-Projekt zu holen. Aus diesem Grund haben wir gerade die neue Position des „Entrepreneur-in-Residence“ geschaffen. Als erstes Beispiel wird Dr. Klaas Yperman mit Prof. Dr. Gary Lewin im Start-up „Allothera“ zusammenarbeiten, das kurz vor der Gründung steht und neue Therapien für Patient:innen mit neuropathischen Schmerzen entwickelt. Eine solche „Entrepreneur-in-Residence“-Position könnte mittelfristig regulär im Finanzplan verankert werden – als Alternative zu Postdoktorand:innen-Stellen, die sich ausschließlich auf wissenschaftliche Forschung konzentrieren. Damit schaffen wir die Voraussetzung, die wirtschaftlichen Potenziale herauszuarbeiten und heben auch die Chancen, Investoren zu begeistern.
Mit welchen strategischen Partnern arbeiten Sie zusammen?
Wir haben zahlreiche Partner im öffentlichen und im privaten Sektor. Als Teil der Helmholtz-Gemeinschaft arbeiten wir mit den anderen lebenswissenschaftlichen Zentren zusammen. In Berlin ist vor allem die strategische Partnerschaft mit der Charité – Universitätsmedizin und dem Berlin Institute of Health wichtig, mit denen wir dank der engen Verbindungen zwischen Wissenschaftler:innen und Kliniker:innen viele unserer Erfindungen teilen. Darüber hinaus kooperieren wir eng mit Industriepartnern wie Bruker bei der Weiterentwicklung von Hightech-Forschungsgeräten.
Nicht zuletzt versammelt der BiotechParkmit mehr als 70 Unternehmen, den Pharma Business Schools und dem Format „Talk im Cube“ der Berlin BioScience Academy eine große Expertise auf dem Campus. Durch Partnerschaften wie mit der UNITE-Initiative, der neuen Start-up-Factory für Berlin und Brandenburg, möchten wir die Unterstützung für unsere Forschenden in der Hauptstadtregion strukturell verbessern.
Ein zentrales Vorhaben ist es, einen Inkubator mit Laborräumen für Start-ups im Gründungszentrum BerlinBioCube zu etablieren.
Dies ist eine spannende Perspektive, auf die wir mit Nachdruck hinarbeiten. Derzeit haben wir mehrere Projekte in den Startlöchern, die den Schritt aus dem akademischen Umfeld wagen wollen – geleitet von „Sciencepreneurs“. Unser Ziel: Wir möchten diese Projekte dabei begleiten, aus unserem Inkubator in den BioCube umzuziehen – in das dynamische Ökosystem von Gleichgesinnten, die alle ähnliche Herausforderungen meistern. So fördern wir Austausch und Zusammenarbeit und letztlich gemeinsames Wachstum.
Quelle: Interview aus dem Standortjournal buchinside 01/2026
Research / 19.12.2025
What determines the fate of a T cell?
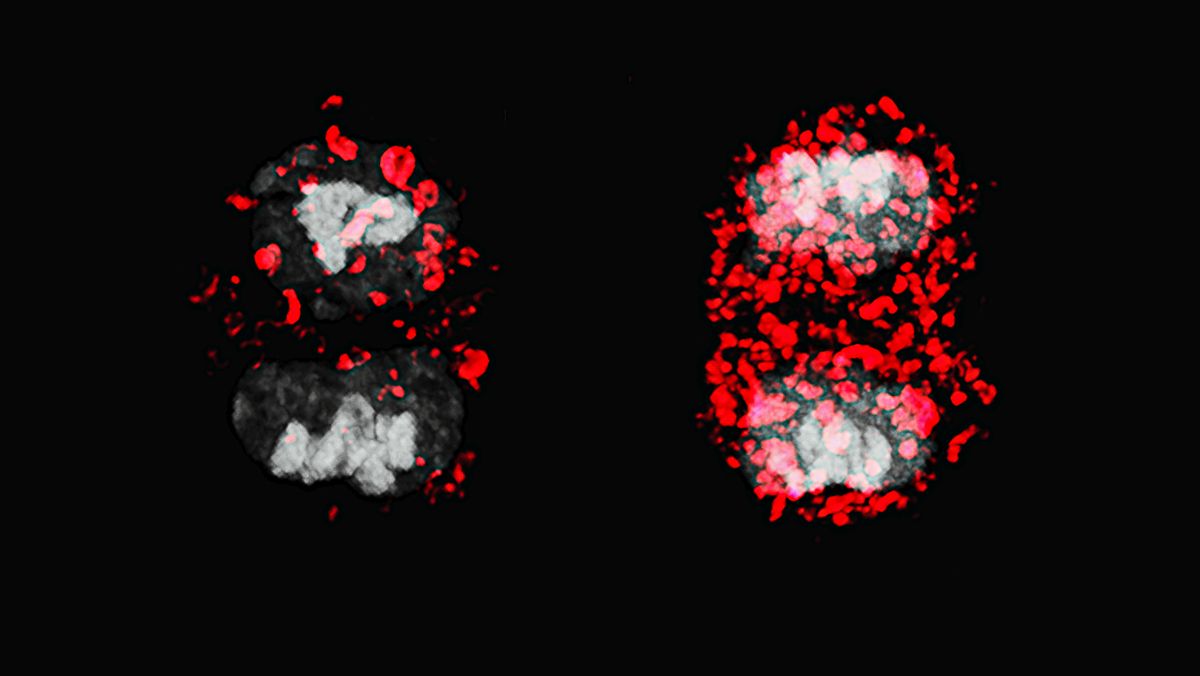
Researchers at the Max Delbrück Center have found that a cellular housekeeping mechanism called autophagy plays a major role in ensuring that T stem cells undergo normal cell division. The findings, published in “Nature Cell Biology,” could help boost vaccine response in older adults.
When killer T cells of our immune system divide, they normally undergo asymmetric cell division (ACD): Each daughter cell inherits different cellular components, which drive the cells toward divergent fates – one cell becomes a short-lived fighter called an effector T cell, the other cell becomes a long-lived memory T cell.
Research by Professor Mariana Borsa at the University of Oxford and colleagues in the Cell Biology of Immunity lab of Professor Katja Simon at the Max Delbrück Center has shown for the first time that cellular autophagy – a “housekeeping” mechanism by which cells degrade and recycle cell cargo – plays a critical role in this decision process.
“Our study provides the first causal evidence that autophagy plays a central role in ensuring that T cells go through ACD normally,” says Borsa, first author of the paper who now leads a research group at the University of Basel. “We found that when T stem cells divide, daughter cells inherit different mitochondria, which influences the T-cell’s destiny,” says Borsa. “By understanding this process, we can start to think about ways to intervene to preserve the function of immune memory cells as we age.”
Split personality
To study ACD in greater detail, the researchers used a novel “MitoSnap” mouse model in which they could tag mitochondria sequentially and discriminate between those in mother and daughter cells. T-cells contain many mitochondria. By tracking how old, damaged mitochondria were distributed between daughter cells, they found that in healthy cells, autophagy was crucial in ensuring that one daughter cell was clear of old mitochondria. This inheritance profile sent the cell down the path toward becoming a long-lived memory precursor cell – immune cells that “remember” a pathogen and begin rapidly dividing when the pathogen is encountered again. Meanwhile, the other daughter cell that took on the older mitochondria became a short-lived effector T-cell – a type of immune cell that rapidly divides to fight off immediate threat. These cells die when the threat is cleared.
When autophagy was disrupted, however, this careful sorting broke down. Both daughter cells inherited damaged mitochondria and hence, were destined to become short-lived cells.
“It was surprising to see that autophagy plays a role beyond just cellular housekeeping,” says Borsa. “Our findings suggest asymmetric inheritance of mitochondria as a potential therapeutic target for memory T cell rejuvenation.”
Boosting vaccine response
By boosting autophagy before or during T stem cell division, it may be possible to enhance the generation of memory cells – the backbone of long-term immunity and vaccine effectiveness.
What’s more, the researchers analyzed daughter cells using single-cell transcriptomics, proteomics and metabolomics and found that effector cells burdened with damaged mitochondria depend heavily on a metabolic pathway called one-carbon metabolism. Targeting this pathway could offer another way to subtly shift the immune balance – nudging T stem-cells toward becoming memory instead of effector cells, Borsa says.
“In the long run, this research could inform strategies to rejuvenate the aging immune system, making vaccines more effective and strengthening protection against infections,” adds Simon. The researchers are planning to further validate their findings in human T-cells.
Photo: T stem cells normally undergo asymmetric cell division (left) whereby one daughter cell becomes a long-lived memory T cell. When autophagy is disrupted, both daughter cells inherit old mitochondria (red) and become effector T-cells. © University of Oxford
Text: Gunjan Sinha
Source: Press Release Max Delbrück Center
https://www.mdc-berlin.de/news/press/what-determines-fate-t-cell
Research / 17.12.2025
Observing synapses in action
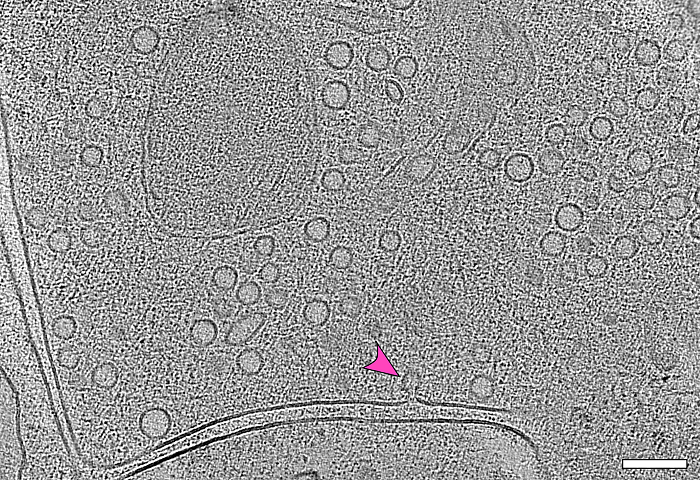
A team of Berlin-based researchers led by Jana Kroll and Christian Rosenmund has captured the fleeting moment a nerve cell releases its neurotransmitters into the synaptic cleft. Their microscopic images and description of the process are published in “Nature Communications.”
It takes just a few milliseconds: A vesicle, only a few nanometers in size and filled with neurotransmitters, approaches a cell membrane, fuses with it, and releases its chemical messengers into the synaptic cleft – making them available to bind to the next nerve cell. A team led by Professor Christian Rosenmund of Charité – Universitätsmedizin Berlin has captured this critical moment of brain function in microscopic images. They describe their achievement in the journal “Nature Communications.”
Point-shaped connections
“Until now, no one knew the exact steps of how synaptic vesicles fuse with the cell membrane,” says Dr. Jana Kroll, first author of the study and now a researcher in the Structural Biology of Membrane-Associated Processes lab headed by Professor Oliver Daumke at the Max Delbrück Center. “In our experiments with mouse neurons, we were able to show that initially, the process begins with the formation of a point-shaped connection. This tiny stalk then expands into a pore through which neurotransmitters enter the synaptic cleft,” Kroll explains.
“With technology we developed over five years, it was possible for the first time to observe synapses in action without disrupting them,” adds senior author Professor Christian Rosenmund, Deputy Director of the Institute for Neurophysiology at Charité. “Jana Kroll truly did pioneering work here,” says Rosenmund, who is also a board member of the NeuroCure Cluster of Excellence.
The images were produced at the CFcryo-EM (Core Facility for cryo-Electron Microscopy), a joint technology platform operated by Charité, the Max Delbrück Center, and the Leibniz Research Institute for Molecular Pharmacology (FMP) that is directed by Dr. Christoph Diebolder. Also central to the study were Professor Misha Kudryashev, head of the In Situ Structural Biology lab at the Max Delbrück Center, and Dr. Magdalena Schacherl, Project Leader of the Structural Enzymology group at Charité.
Flash-frozen in ethane
To observe synapses in action, the team used mouse neurons genetically modified through optogenetics so they could be activated by a flash of light – prompting them to secrete neurotransmitters immediately. One to two milliseconds after a light pulse, the researchers flash-froze the neurons in liquid ethane at minus 180°C. “All cellular activity stops instantly with this ‘plunge freezing’ method, allowing us to visualize the structures using electron microscopy,” explains Kroll.
The method revealed another intriguing detail: “We found that most of the fusing vesicles were connected by tiny filaments to at least one other vesicle. As soon as one vesicle fuses with the membrane, the next one is already in position,” Kroll reports. “We believe that this direct form of vesicle recruitment enables neurons to send signals over a longer period of time and thus maintain their communication.”
Toward better epilepsy treatment
The vesicle fusion process visualized by the team takes place millions of times a minute in the human brain. Understanding it in detail has important clinical implications. “In many people with epilepsy or other synaptic disorders, mutations have been found in proteins involved in vesicle fusion,” explains Rosenmund. “If we can clarify the precise role of these proteins, it will be easier to develop targeted therapies for these so-called synaptopathies.”
“The time-resolved cryo-electron microscopy approach using light, as we’ve presented here, isn’t limited to neurons,” Kroll adds. “It can be applied across many areas of structural and cell biology.” She now plans to repeat the experiments at the Max Delbrück Center using human neurons derived from stem cells. That won’t be easy, she notes: “In the lab, it takes about five weeks for the cells to develop their first synapses – and they are extremely fragile.”
Text: Anke Brodmerkel
The image captures the moment during which a vesicle (arrow) fuses with the cell membrane. By superimposing several electron microscopy images – a process known as electron tomography – it is possible to see how many vesicles are waiting at the end of a nerve cell to release their biochemical messengers into the synaptic cleft. This space between two nerve cells can be seen as a double line in the image.
© Jana Kroll, Charité / Max Delbrück Center
Source: Joint press release by Charité – Universitätsmedizin Berlin and the Max Delbrück Center
Observing synapses in action
Research, Innovation, Living, Patient care, Education / 16.12.2025
Das neue Standortjournal buchinside ist erschienen
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
als Gary Lewin vor mehr als 15 Jahren die Funktion des Proteins STOML3 entdeckte, war er sofort fasziniert. Ein Molekül, das die Empfindlichkeit der sensorischen Neurone für Berührungsreize moduliert und damit auch das neuropathische Schmerzempfinden beeinflusst! Was wäre, wenn man es hemmen oder sogar ausschalten könnte? Läge darin der Schlüssel zu einer neuen Therapie? Millionen Menschen, die weltweit an solchen chronischen Schmerzen leiden und die bislang kaum Hoffnung auf Linderung haben, könnten davon profitieren.
Wie so oft bei großen Entdeckungen brauchte es viele Experimente, Ideen und Kreativität – und reproduzierbare Ergebnisse. Wissenschaft ist wie ein Puzzle: Erst wenn sich viele Teile zusammenfügen, entsteht das ganze Bild. So war es auch bei Gary Lewin, der am Max Delbrück Center die molekularen und physiologischen Grundlagen des Tastsinns und der Schmerzempfindung untersucht. Er und sein Team blieben dran. Denn ihm war klar: Hier liegt enormes Potenzial für ein vielversprechendes Medikament.
Der Campus Buch ist ein Ort, an dem großartige Ideen wachsen und bahnbrechende Entdeckungen gelingen. Hier, in den Teams der verschiedenen Zentren, wird auf höchstem Niveau geforscht: interdisziplinär, kollaborativ und stets mit Blick auf Translation und gesellschaftlichen Nutzen.
Uns geht es um innovative Lösungen: Wir wollen die Medizin von morgen mitgestalten. Wir wollen, dass unsere Wissenschaft die Welt ein Stück besser macht – mit neuen Diagnostiken zur Krankheitsprävention und Therapien, die die Lebensqualität verbessern und im besten Fall heilen. Kurz: Unsere fantastische Forschung soll zurück in die Gesellschaft wirken.
Wie gelingt das? Zum einen brauchen wir dazu exzellente Forscher:innen und ein kreatives Umfeld, in dem Menschen aus den unterschiedlichsten Disziplinen eng zusammenarbeiten und sich inspirieren. Zentral ist auch eine technologisch hervorragende Infrastruktur. All das bietet Berlin, bietet unser Campus in Buch – und zwar reichlich.
Alles ist also bereit – jetzt sollten wir es zusammenfügen, um unsere Vision greifbar zu machen: from bench to bedside, from lab to market. Dafür sollten wir unsere Forschung noch konsequenter unternehmerisch denken – und den Mut haben, Entdeckungen auch umzusetzen: Ideen schützen lassen, Geschäftsmodelle entwickeln, Lizenzen vergeben, Kapital einwerben, Start-ups gründen. So schlagen wir die Brücke vom Labor in die Praxis.
Wie das geht, zeigen viele Teams auf unserem Campus. Ich nenne gerne drei jüngere Beispiele erfolgreicher Spin-offs: Tubulis (FMP/Wirkstoffentwicklung gegen Eierstock- und Lungenkrebs), CARTemis (Max Delbrück Center/CAR-T-Zell-Therapien bei B-Non-Hodgkin-Lymphom) oder MyoPax (ECRC, Charité, Max Delbrück Center/Therapien gegen Muskelerkrankungen). Andere – und Gary Lewin ist da einer von vielen – bereiten die Ausgründung vor.
Der Umgang mit Patenten, das Einwerben von Venture Capital, der Kontakt mit Unternehmen – all das liegt uns Wissenschaftler:innen vielleicht nicht im Blut. Aber wir wachsen und lernen ständig! Und: Wir werden hervorragend unterstützt. Unter Leitung von Dr. Nevine Shalaby arbeitet das Team Innovation und Entrepreneurship am Max Delbrück Center eng mit den wissenschaftlichen Teams. Die Manager:innen beraten und begleiten Innovator:innen auf ihrem Weg – vom ersten Funken einer Idee bis zur Anwendung. Boost-Programme helfen, ein VC Day ist etabliert, ein Inkubator soll bald gezielt Spin-offs fördern.
Auch unser Campus bietet Raum für unternehmerisches Denken: In den BerlinBioCube sind Start-ups eingezogen. Beim „Talk im Cube“ vernetzen sich Forschende mit Business-Expert:innen. Gemeinsam bauen wir Brücken zu Industrie und Geldgebern.
Von all dem erzählt diese „buchinside“. Ich wünsche Ihnen Freude beim Lesen und viele neue Einblicke. Denn genau das brauchen wir: Wissen und Austausch. Ich freue mich sehr darauf, mitzuerleben, wie Entdeckungen und Innovationen in den kommenden Jahren aus Berlin-Buch heraus die Medizin der Zukunft prägen.
Prof. Dr. Maike Sander
Wissenschaftliche Vorständin
des Max Delbrück Center
Hier finden Sie die neue Ausgabe zum Download: https://berlin-buch.com/de/buchinside
Research, economic development, Innovation / 15.12.2025
Neuer Podcast zum Start-up PROSION Therapeutics am Zukunftsort Berlin-Buch
Die Zukunftsorte Berlin sprechen in einer neuen Folge ihres Podcasts mit Dr. Slim Chiha, CEO und Gründer von PROSION Therapeutics. Das Biotech-Start-up entwickelt eine neuartige Wirkstoffplattform, die bislang als unbehandelbar geltende Krankheiten erstmals gezielt beeinflussen kann.
Im Gespräch erklärt Dr. Chiha, wie anspruchsvoll der Übergang von der vorklinischen Forschung in die klinische Entwicklung ist, welche technologischen und regulatorischen Hürden sich dabei zeigen – und warum das Ökosystem rund um den Zukunftsort Berlin-Buch dafür ideale Bedingungen bietet.
Außerdem gibt Dr. Chiha Einblicke in aktuelle Projekte, neue therapeutische Anwendungsfelder und geplante Partnerschaften, die PROSION auf seinem Weg in die klinische Phase begleiten sollen.
Bei der Aufnahme des Podcasts wurde auch gefilmt, weshalb man auf einigen Kanälen das Gespräch mit Dr. Slim Chiha, Madlen Dietrich und Steffen Terberl auch im Video verfolgen kann.
Viel Freude beim Hören - und Sehen!
Hier finden Sie den Podcast:
Podigee: https://zukunftsorte-berlin-podcast.podigee.io/3-prosion-therapeutics-berlin-buch
YouTube-Video: https://youtu.be/2XhhjWaBCcI?si=7Y-aKsGAsoeJBuKi
Spotify: https://open.spotify.com/episode/2og7S8nLUkNMDGRT58kY0b?si=lrsw-hhwQI6jrx7Ir3wC-Q
Apple: https://podcasts.apple.com/us/podcast/prosion-therapeutics-berlin-buch/id1853867899?i=1000741316318
Quelle: Zukunftsorte Berlin
https://zukunftsorte.berlin/Innovation / 03.12.2025
Eckert & Ziegler und SK Biopharmaceuticals unterzeichnen Liefervertrag für Actinium-225
Eckert & Ziegler (ISIN DE0005659700, TecDAX) und SK Biopharmaceuticals, ein auf Therapien für Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS) spezialisiertes Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Südkorea, das ebenfalls im Bereich Radiopharmazeutika tätig ist, haben kürzlich einen Liefervertrag unterzeichnet. Das Unternehmen wird SK Biopharmaceuticals mit Actinium-225 (Ac-225) beliefern, um dessen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der radiopharmazeutischen Therapien voranzutreiben. Die Entwicklungspipeline von SK Biopharmaceuticals umfasst unter anderem SKL35501, ein innovatives Radiopharmazeutikum, das mit Ac-225 markiert wird und Potenzial in der Behandlung verschiedener Krebsarten, darunter Darm-, Brust-, Bauchspeicheldrüsen- sowie Kopf- und Halskrebs, hat. Mit der Sicherung einer zuverlässigen Versorgung mit dem Alpha-emittierenden Radioisotop von Eckert & Ziegler wird das Unternehmen dieses und weitere Programme aus seiner wachsenden Pipeline vorantreiben.
„Wir freuen uns, SK Biopharmaceuticals mit der Lieferung von GMP-konformem Ac-225 bei ihren vielversprechenden präklinischen und klinischen Programmen zu unterstützen“, erklärte Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender von Eckert & Ziegler. „Ac-225 ist nach wie vor eines der gefragtesten Radioisotope in der Entwicklung von Radiopharmazeutika der nächsten Generation, und wir sind froh, unseren Beitrag dazu leisten zu können, diese Krebstherapien voranzubringen.“
„Die Sicherstellung einer stabilen Versorgung mit Ac-225, dem wichtigsten Ausgangsmaterial für die radiopharmazeutische Therapie, ist eine Grundvoraussetzung für den Erfolg. Wir freuen uns, diese Vereinbarung mit Eckert & Ziegler geschlossen zu haben, einem zuverlässigen Anbieter mit langjähriger Erfahrung im Bereich hochwertiger Radioisotope für pharmazeutische Anwendungen“, sagte Donghoon Lee, CEO von SK Biopharmaceuticals. „Aufbauend auf unserer proaktiven globalen Partnerschaft und unserer diversifizierten Lieferkette werden wir einen großen Schritt nach vorne machen, um auf dem globalen Markt für Krebsbehandlungen Fuß zu fassen.“
Eckert & Ziegler beliefert weltweit führende Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen zuverlässig mit Gallium-68, Lutetium-177, Yttrium-90 und Actinium-225 in GMP-Qualität. Mit der Expertise in der Radioisotopenproduktion sowie in der globalen Logistik und bei CDMO-Dienstleistungen unterstützt das Unternehmen kontinuierlich die Entwicklung und Lieferung innovativer Radiopharmazeutika.
Über Eckert & Ziegler
Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.
Wir helfen zu heilen.
Über SK Biopharmaceuticals
SK Biopharmaceuticals Co., Ltd. ist Teil der SK Group, dem zweitgrößten Mischkonzern Südkoreas. Die SK Group ist ein Zusammenschluss weltweit führender Unternehmen, die Innovationen in den Bereichen Energie, fortschrittliche Werkstoffe, Biopharmazeutika und digitales Geschäft vorantreiben. SK hat seinen Sitz in Seoul und investiert weltweit in den Aufbau nachhaltiger Unternehmen mit dem gemeinsamen Ziel, die globalen Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Die Unternehmen der SK-Gruppe erzielen zusammen einen weltweiten Jahresumsatz von 151 Milliarden US-Dollar und beschäftigen weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter. Die SK Group gehört zu den 100 einflussreichsten Unternehmen des Jahres 2023 laut TIME. SK Inc., die Muttergesellschaft von SK Biopharmaceuticals, steigert den Wert ihres Portfolios kontinuierlich durch langfristige Investitionen in eine Reihe wettbewerbsfähiger Tochtergesellschaften in verschiedenen Geschäftsbereichen, darunter Pharmazeutika und Biowissenschaften, Energie und Chemie, Information und Telekommunikation sowie Halbleiter. Darüber hinaus konzentriert sich SK Inc. darauf, seine Wachstumsgrundlagen durch ein profitables und praktisches Management auf der Grundlage finanzieller Stabilität zu stärken und gleichzeitig seinen Unternehmenswert durch Investitionen in neue zukunftsträchtige Wachstumsgeschäfte zu steigern. Weitere Informationen über SK Inc. finden Sie unter https://sk-inc.com/en/main/mainpage.aspx. Weitere Informationen über SK Biopharmaceuticals finden Sie unter www.skbp.com/eng.
Quelle: Pressemitteilung Eckert & Ziegler SE
Eckert & Ziegler und SK Biopharmaceuticals unterzeichnen Liefervertrag für Actinium-225
Research, Innovation / 26.11.2025
Vom Wissenschaftler zum Unternehmer
Was braucht es, damit aus Forschung ein Start-up werden kann? Das weiß Klaas Yperman, unser erster „Entrepreneur in Residence“. Mit einem „Helmholtz Enterprise“-Grant entwirft er eine Roadmap, um aus Wirkstoffen des Teams um Gary Lewin ein Medikament gegen neuropathische Schmerzen zu entwickeln.
Von Gary Lewins Forschung zu neuropathischen Schmerzen hörte Dr. Klaas Yperman zum ersten Mal, als er gemeinsam mit seiner Frau, Dr. Alice Rossi, und einem guten Freund bei einem zwanglosen Abendessen saß. Rossi forschte als Postdoktorandin in Professor Lewins Arbeitsgruppe „Molekulare Physiologie der somatosensorischen Wahrnehmung“. Sie war Teil eines Teams, das potenzielle Wirkstoffe zur Behandlung neuropathischer Schmerzen untersuchte. Yperman, selbst Neurowissenschaftler, fand die Forschung faszinierend.
Zu diesem Zeitpunkt arbeitete er, ebenfalls als Postdoktorand, am Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP). Im Jahr 2023 kam Yperman als Innovationsmanager zum Max Delbrück Center. Die Abteilung „Innovation & Entrepreneurship“ prüft die Forschung des Zentrums mit Blick auf deren kommerzielles Potenzial – keine leichte Aufgabe angesichts der mehr als 80 Forschungsgruppen, sagt Yperman. Er wollte sich auf Lewins Forschung konzentrieren. Diese sei nicht nur interessant, sondern auch sehr weit fortgeschritten gewesen, sagt er: „Ich hatte mir den Markt angesehen und erkannt, dass wirklich ein Bedarf für neue Therapien gegen neuropathische Schmerzen besteht.“
Yperman packte die Idee nicht auf Eis, sondern brachte sie im Eis erst richtig in Schwung. „Ich wollte gerade in den Skiurlaub fahren, als ich sah, dass Helmholtz Enterprise ein Spin-off-Programm anbietet“, erinnert er sich lachend. „Ich dachte mir: Das ist genau das, was dieses Projekt braucht – jemanden, der sich ausschließlich um die geschäftliche Seite kümmert.“ Also packte er neben seinen Skiern auch den Laptop ein. „Jeden Abend während meines Urlaubs habe ich an diesem Antrag geschrieben“, erzählt Yperman. „Eingereicht habe ich ihn schließlich aus 3.000 Metern Höhe. Ich wollte nicht warten.“
Sein Engagement zahlte sich aus. Die Förderung wurde bewilligt und damit eröffnete sich ein neuer Weg: Yperman wurde der erste „Entrepreneur in Residence“ des Max Delbrück Center – mit der Aufgabe, einen Fahrplan zu erstellen, um Lewins Forschung zu Wirkstoffen gegen neuropathische Schmerzen in ein tragfähiges Start-up namens Allothera zu verwandeln.
Herr Yperman, wie sind Sie vom Innovationsmanager zum Entrepreneur in Residence geworden?
Als ich zum Max Delbrück Center kam, hatte das Team um Gary Lewin, wie ich fand, eines der innovativsten Forschungsprojekte. Es verfügte über eine hervorragende wissenschaftliche Grundlage, kombiniert mit einem dringenden therapeutischen Bedarf auf dem Gebiet der neuropathischen Schmerzen. Es gab nur niemanden, der sich in Vollzeit mit der Umsetzung dieses Projekts befasste.
Ich stieß dann auf das Spin-off-Programm von Helmholtz Enterprise – und mir wurde klar, dass damit jemand finanziert werden konnte, der sich zu hundert Prozent auf die geschäftliche Seite des Projekts konzentriert. Ursprünglich war gar nicht vorgesehen, dass ich diese Rolle übernehmen würde. Doch die Helmholtz-Jury sagte mir, entweder solle ich es selbst machen oder innerhalb von zwei Wochen jemanden finden – ansonsten würden sie die Förderung nicht genehmigen. Bei einem so engen Zeitrahmen hatte ich keine große Wahl: Ich nahm die Aufgabe an.
An welchem Projekt der AG Lewin arbeiten Sie konkret?
Das Team hat Wirkstoffe entwickelt, Small Molecules, die auf das Stomatin-ähnliche Protein 3, kurz STOML3, abzielen. Das Protein ist an der Wahrnehmung von Berührungen beteiligt. Wir sind noch in einem frühen Stadium, aber die präklinischen Daten sind vielversprechend.
Was bedeutet es in der Praxis, Entrepreneur in Residence zu sein?
Es bedeutet, dass ich Vollzeit daran arbeite, ein Start-up aufzubauen. Ich schreibe Förderanträge, erstelle die Roadmap, plane Meilensteine und finde heraus, wie die Finanzierung gelingt – sei es durch Fördermittel, Risikokapital oder Business Angels. Es geht darum, Wissenschaft in eine Strategie zu übersetzen: den Markt zu verstehen, zu wissen, an welcher Art von Medikament die Pharmaunternehmen interessiert sind – an einer Pille, einer Creme, einer Injektion – und Beziehungen zu Investor*innen und Kliniker*innen aufzubauen. Wir entwickeln nicht nur Medikamente. Wir erklären auch, warum die Welt sie braucht und wer sie kaufen wird.
Sie durften auch an einem Programm des Creative Destruction Lab, kurz CDL, teilnehmen. Wie war diese Erfahrung?
Unglaublich – und intensiv. CDL ist ein Mentoring-Programm, das Risikokapitalgeber*innen, Pharmastrateg*innen und erfahrene Unternehmer*innen zusammenbringt. Man stellt sein Projekt dort vor, setzt klare Ziele und erhält ein schonungslos ehrliches Feedback. Es ist hart, denn sie beschönigen dort wirklich nichts. Man hört Dinge wie: „Sie haben kein Geschäftsmodell.“ Oder: „Warum sollte jemand das finanzieren wollen?“ Aber genau das braucht man: die Ehrlichkeit von Leuten, die wissen, wovon sie reden. Von den 20 Personen, die letztes Jahr an dem Programm teilgenommen haben, sind nur sieben übriggeblieben. Das zeigt, wie streng der Prozess ist. Ich arbeite jetzt mit zwei Mentoren zusammen, die mir helfen, einen Fahrplan für unser Start-up Allothera zu entwickeln. Wir werden unser Allerbestes geben, um das CDL-Programm noch in diesem Jahr erfolgreich abzuschließen.
Was macht es so schwierig, akademische Forschung in ein Start-up zu verwandeln?
Viele Wissenschaftler*innen lieben die Forschung im Labor – und das ist großartig. Aber wenn sie ihre Entdeckung zum Leben erwecken wollen, müssen sie das Labor verlassen. Sie müssen über den Markt, regulatorische Aspekte, geistiges Eigentum und die Finanzierung nachdenken. Sie müssen auch wissen, wer für die weitere Entwicklung ihres Produkts bezahlen wird, wie Kliniker*innen es einsetzen werden und wie sie Investor*innen davon überzeugen können.
Wie hat Ihre bisherige Laufbahn Sie darauf vorbereitet?
Ich habe meinen Doktortitel in Pflanzenbiotechnologie am VIB, dem Vlaams Instituut voor Biotechnologie, in Belgien erworben und anschließend als Postdoc in der Neurobiologie am FMP in Berlin gearbeitet. Irgendwann wusste ich, dass reine Grundlagenforschung nichts für mich ist – sie ist mir zu einsam. Meine Frau war damals Beraterin im Bereich Life Sciences und brachte mir bei, wie man als Berater denkt: wie man Marktanalysen macht, Wettbewerber identifiziert und Werte evaluiert. Da wurde mir klar, dass Forschende die geschäftliche Seite leicht erlernen können. Man braucht nur Neugier und Lernbereitschaft.
Worauf liegt Ihr Fokus im Moment?
Gerade konzentriere ich mich hauptsächlich darauf, einen Fahrplan zu erstellen und strategische Verbindungen aufzubauen – zu Risikokapitalgeber*innen, Kliniker*innen und potenziellen Partner*innen. Ich nehme Kontakt zu Menschen auf, stelle ihnen unsere wissenschaftliche Grundlage und die Vision für das Unternehmen vor, höre mir ihr Feedback an und melde mich dann einige Monate später mit neuen Daten und Ideen zurück. Es geht darum, Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen. Außerdem erkunde ich neue Fördermöglichkeiten und strategische Kooperationen.
Das alles zählt zu den Soft Skills. Warum sind sie für Ihre Arbeit so wichtig?
Man kann über die beste Technologie der Welt verfügen. Doch wenn man nicht in der Lage ist, sie zu vermitteln, andere zu begeistern und Vertrauen zu seinem Team und seinen Investor*innen aufzubauen, wird man nicht weit kommen.
Die Fragen stellte: Gunjan Sinha
Living / 24.11.2025
Mitwirkende für Kinder- und Jugendhilfeausschuss gesucht – Bewerbungen bis 19. Dezember 2025 möglich
Das Jugendamt Pankow sucht für die IX. Wahlperiode engagierte Persönlichkeiten zur Mitarbeit im Kinder- und Jugendhilfeausschuss des Bezirks Pankow.
Gesucht wird eine Vertreterin oder ein Vertreter aus den Reihen der im Bezirk wirkenden anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, der Jugendverbände sowie der Jugend- und Wohlfahrtsverbände. Bürgerdeputierte wirken als stimmberechtigte Mitglieder an den Beratungen und Beschlüssen des Ausschusses mit. Die Amtszeit erstreckt sich über die Dauer der Wahlperiode bis voraussichtlich Herbst 2026.
Interessierte Personen müssen ihren Hauptwohnsitz in Berlin haben und im Bewerbungsschreiben folgende Angaben machen: Vollständiger Name und persönliche Kontaktdaten (inkl. E-Mail-Adresse), Zugehöriger Träger bzw. Verband sowie Themenschwerpunkte, die in die Ausschussarbeit eingebracht werden sollen.
Bewerbungsschluss ist Freitag, der 19. Dezember 2025. Bewerbungen sind an die folgende Postadresse zu richten: Bezirksamt Pankow, Jugendamt, Jugendamtsdirektorin, Berliner Allee 252–260, 13088 Berlin. Bewerbungen können auch per E-Mail eingereicht werden: claudia.kinzel@ba-pankow.berlin.de .
Living / 24.11.2025
Schweigen ist keine Option – Pankow zeigt Flagge gegen Gewalt an Frauen/FLINTA+
Gewalt gegen Frauen/FLINTA+ ist auch in Berlin kein Randphänomen: Die Zahl der von Gewalt betroffenen Frauen in Berlin ist im Jahr 2024 erneut weiter angestiegen: laut Senatsverwaltung für Inneres und Sport auf 42.751, das entspricht einem Anstieg von 7,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2023.
Anti-Gewalt-Flagge am Bürokomplex Fröbelstraße
Am Dienstag, dem 25. November 2025 um 16:30 Uhr hisst Bezirksbürgermeisterin Dr. Cordelia Koch vor dem Bürgeramt Prenzlauer Berg in der Fröbelstraße 17, 10405 Berlin, die Berliner Anti‑Gewalt‑Flagge zum Internationalen Tag gegen geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt. Auch an den Rathäusern Pankow und Weißensee wird Flagge gezeigt – für Solidarität, Mitgefühl und entschlossenes Handeln.
Begleitet wird das Flaggenhissen mit einer Mahnwache, die an die Opfer von Femiziden erinnert und deutlich macht: Schweigen ist keine Option – alle Frauen/FLINTA+ haben das Recht auf ein gewaltfreies Leben in Freiheit, Sicherheit und Würde.
Living / 19.11.2025
Neugestaltung der Grünfläche am Theodor-Fontane-Denkmal in Buch – Beteiligungsveranstaltung am 26. November
Der Bezirk Pankow plant die umfassende Neugestaltung der bislang wenig beachteten Grünfläche rund um das Denkmal Theodor Fontane in der Karower Straße in Buch. Die öffentliche Grünfläche Karower Straße liegt im historischen Zentrum von Buch nahe dem Schlosspark.
Die Bezirksstadträtin für Ordnung und Öffentlicher Raum, Manuela Anders-Granitzki sowie der Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und Bürgerdienste, Cornelius Bechtler, laden alle Interessierten herzlich zur öffentlichen Beteiligungsveranstaltung am Mittwoch, dem 26. November 2025, um 17:30 Uhr, ins Bucher Bürgerhaus, Franz-Schmidt-Straße 8, 13125 Berlin, ein. Dort werden erste Ideen vorgestellt, weitere Vorschläge eingeholt und gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern diskutiert. Bereits im Vorfeld werden die Kinder der Kita Kleine Raupe Nimmersatt in den Planungsprozess einbezogen und nach ihren Wünschen befragt.
Neuer Spielplatz als zentrales Anliegen
Ziel ist es, diesen Ort wieder zu einem attraktiven Aufenthaltsraum für alle Generationen zu machen und ihn gestalterisch so aufzuwerten, dass er zum Verweilen einlädt. Ein zentrales Anliegen der Planung ist die Schaffung eines neuen öffentlichen Spielplatzes für Kinder bis sechs Jahre. Hintergrund ist die derzeit unzureichende Versorgung mit Spielmöglichkeiten in der nahen Umgebung. Das Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks Pankow hat daher ein erfahrenes Grünplanungsbüro beauftragt, ein Gesamtkonzept zu entwickeln.
Neben der Aufenthalts- und Spielfunktion stehen auch Aspekte des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Mittelpunkt. Die Gestaltung soll insbesondere in den Sommermonaten für angenehme Bedingungen sorgen. Angedacht sind z.B. Neupflanzungen von Bäumen und Sträuchern zur Verbesserung des Mikroklimas oder begrünte Pergolen und gezielt platzierte Spielgeräte, die durch Schattenwurf zur Nutzbarkeit auch an heißen Tagen beitragen.
Mit diesem Projekt setzt der Bezirk Pankow ein starkes Zeichen für familienfreundliche Stadtentwicklung und nachhaltige Freiraumgestaltung. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus dem Städtebauförderprogramm Nachhaltige Erneuerung. Insgesamt werden für die Qualifizierung der Fläche ca. 550.000 Euro eingesetzt.
Innovation / 13.11.2025
Eckert & Ziegler Achieves Further Earnings Growth and Double-Digit Sales Growth in the Medical Segment
Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) increased sales in the first nine months of 2025 by 4% to €224.1 million compared to the same period last year. EBIT before special items from continuing operations (adjusted EBIT) rose by 9% to €50.8 million. Net profit (from continuing and discontinued operations) grew by 28% to €29.9 million, or €0.48 per share.
In the Medical segment, sales in the first nine months of the year amounted to €119.7 million, up around €15.2 million or 15% on the previous year's level. The business with pharmaceutical radioisotopes remains the most important source of revenue. Particularly noteworthy here are the developments in sales of generators, licensing, and contract manufacturing & development (CDMO).
The Isotope Products segment generated external sales of €104.4 million, down €6.6 million or approximately 6% compared to the first nine months of the previous year. Shifts between product groups toward lower-margin products have become apparent in comparison to the same period last year.
For the current fiscal year 2025, the Executive Board confirms its profit forecast published on March 27, 2025, with sales of approx. €320 million and an adjusted EBIT of approx. €78 million.
The complete quarterly report can be viewed here:https://www.ezag.com/Q32025en
3rd quarter of 2025:
- Sales of €75.3 million (previous year: €70.1 million)
- EBIT before special items of €15.4 million (previous year: €14.2 million)
- Net income of €8.5 million (previous year: €5.3 million)
First 9 months of 2025:
- Sales of €224.1 million (previous year: €215.5 million)
- EBIT before special items of €50.8 million (previous year: €46.7 million)
- Net income of €29.9 million (previous year: €23.4 million)
Forecast for 2025:
- Sales of approx. €320 million (confirmed)
- EBIT before special items of approx. €78 million (confirmed)
About Eckert & Ziegler.
Eckert & Ziegler SE, with more than 1.000 employees, is a leading specialist for isotope-related components in nuclear medicine and radiation therapy. The company offers a broad range of services and products for the radiopharmaceutical industry, from early development work to contract manufacturing and distribution. Eckert & Ziegler shares (ISIN DE0005659700) are listed in the TecDAX index of Deutsche Börse.
Source: Press Release Eckert & Ziegler
Eckert & Ziegler Achieves Further Earnings Growth and Double-Digit Sales Growth in the Medical Segment
Innovation / 13.11.2025
Ariceum Therapeutics Doses First Patient in SANTANA-225 Phase 1/2 Clinical Trial of 225Ac-SSO110 in Patients with Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer or Merkel Cell Carcinoma
Ariceum Therapeutics (Ariceum), a targeted radiotherapeutics company dedicated to setting new standards in cancer care, today announced that the first patient has been dosed in the SANTANA-225 Phase 1/2 study of 225Ac-SSO110 for the treatment of extensive stage small cell lung cancer (ES-SCLC) and Merkle Cell Carcinoma (MCC). 225Ac-SSO110 is a potentially first- and best-in-class Actinium-225-labelled antagonist of the somatostatin type 2 receptor (SSTR2). SSTR2 is highly overexpressed in neuroendocrine tumors relative to healthy tissue, making it an ideal target for radioligand therapies (RLTs).
The SANTANA-225 clinical trial (NCT06939036) is a global, open-label Phase 1/2 study that will assess the safety, tolerability, preliminary efficacy, and recommended Phase 2 dose of 225Ac-SSO110 in patients with ES-SCLC treated with checkpoint inhibitors (CPI) in first-line maintenance therapy or MCC patients treated with CPI in first-line therapy. The trial is expected to enroll approximately 20 patients in the dose escalation phase of the study, followed by expansion cohorts. In February 2025, 225Ac-SSO110 received Orphan Drug Designation (ODD) from the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for the treatment of ES-SCLC.
“RLTs are redefining precision oncology by enabling targeted delivery of radiation directly to tumor cells while minimizing exposure to healthy tissue,” said Germo Gericke, MD, Chief Medical Officer of Ariceum Therapeutics. “225Ac-SSO110 is the first SSTR2 antagonist RLT in clinical development, designed to deliver higher doses of alpha radiation directly to patients’ tumors while maintaining a favorable safety profile for individuals with neuroendocrine cancers, including ES-SCLC and MCC. Dosing the first patient in the SANTANA-225 trial is a significant step for our lead program and an important milestone towards addressing urgent patient needs in these aggressive cancers. We expect to report initial safety data from the SANTANA-225 trial in 2026, which may support expansion into additional neuroendocrine tumor indications and further validate the differentiated mechanism of action of 225Ac-SSO110.”
ES-SCLC is a deadly and aggressive cancer that represents a significant unmet medical need due to the limited number of treatment options available to patients. Two-thirds of SCLC patients are diagnosed at an advanced stage where the disease has already metastasized, resulting in a poor prognosis and a 5-10% five-year survival rate. MCC is a rare and aggressive type of skin cancer with limited treatment options that also has low survival rates in patients who do not respond to first-line CPI therapy. Both ES-SCLC and MCC are neuroendocrine tumors that frequently express SSTR2, making them compelling initial indications for SSTR2-targeted therapy. 225Ac-SSO110 is the first SSTR2-targeting antagonist radiolabeled with Actinium-225 to undergo human trials in combination with CPI for these neuroendocrine tumor indications, addressing areas of high unmet need and laying the foundation for potential expansion to other SSTR2-expressing cancers.
About Ariceum Therapeutics
Ariceum Therapeutics is a clinical-stage oncology company dedicated to redefining the future of care through targeted radiotherapeutics for patients with aggressive and hard-to-treat cancers. The company’s lead program, 225Ac-SSO110, a novel antagonist of the somatostatin type 2 receptor (SSTR2) with best-in-class potential, is currently being investigated in the Phase 1/2 SANTANA-225 study as the first maintenance radiotherapy for extensive stage small cell lung cancer (ES-SCLC) and Merkel Cell Carcinoma (MCC) –two diseases with limited options and poor prognosis. Ariceum is also developing ATT001, a novel radiolabeled I-123 PARP inhibitor designed to deliver subcellular precision radiotherapy to aggressive solid tumors.
Headquartered in Berlin, Ariceum operates across Germany, Switzerland, Australia, the United Kingdom, and the United States. The company is supported by leading global life sciences investors, including EQT Life Sciences, HealthCap, Pureos Bioventures, Andera Partners, and Earlybird Venture Capital.
For further information, please visit www.ariceum-therapeutics.com and follow us on LinkedIn.
Quelle: Ariceum Therapeutics
Ariceum Therapeutics Doses First Patient in SANTANA-225 Phase 1/2 Clinical Trial of 225Ac-SSO110 in Patients with Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer or Merkel Cell Carcinoma
Living, Education / 12.11.2025
Pankow eröffnet Kinderrechtepfad am Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November
Pankow eröffnet Kinderrechtepfad am Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November - Neues Bildungs- und Spielangebot in Prenzlauer Berg
Am 20. November 2025, dem Internationalen Tag der Kinderrechte, eröffnet das Jugendamt Pankow um 12:00 Uhr gemeinsam mit der Grundschule an der Marie, dem Kinder- und Jugendbüro Pankow sowie dem Deutschen Kinderhilfswerk den neuen Kinderrechtepfad „an der Marie“ in Prenzlauer Berg.
Kinderrechte an zehn Stationen auf spielerische Weise kennenlernen
Der Pfad lädt Kinder und Erwachsene ein, die Kinderrechte auf spielerische und anschauliche Weise kennenzulernen. An zehn Stationen stellen gelbe, von der Künstlerin Teresa Linke gestaltete Tafeln jeweils ein Kinderrecht vor und bieten Aufgaben und Anregungen für Kinder im Alter von etwa drei bis zehn Jahren – von Bewegungs- und Wahrnehmungsspielen bis hin zu Übungen zu Achtsamkeit, Empathie und Rücksichtnahme. Das Konzept ist an die allseits bekannten „Trimm-dich-Pfade“ angelehnt: Spazierende stoßen auf im öffentlichen Raum installierte Schilder mit Lern- und Spielangeboten – hier rund um das Thema Kinderrechte. Der Pfad erstreckt sich über den Spielplatz an der Marie, das Gelände der Grundschule an der Marie sowie den Abenteuerspielplatz an der Marie.
Schüler:innen der Kinderrechteschule „Grundschule an der Marie“ haben die Orte für die Tafeln gewählt und eröffnen gemeinsam mit der Jugendstadträtin Rona Tietje den Pfad für die Öffentlichkeit.
„Mit dem Kinderrechtepfad wollen wir in Pankow ein Zeichen für die Kinderrechte setzen und Kinder, aber auch Erwachsene, dazu einladen, mehr darüber zu erfahren. Denn die Kinderrechte gehen uns alle an!“, sagt Rona Tietje, Jugendstadträtin im Bezirk Pankow.
„Als erste Berliner Kinderrechteschule freuen wir uns ganz besonders, dass jetzt zehn der wichtigsten Kinderrechte auf „unserer Marie“ sichtbar sind!“, betont Gunnar Beyer, Schulleiter der Grundschule an der Marie.
„Der Kinderrechtepfad ist einzigartig, weil er von Kindern für Kinder entwickelt wurde – gemeinsam mit den Schüler:innen des Kinderparlaments der Grundschule.“, ergänzen Tina Hofmann und Britta Kaufhold vom Kinder- und Jugendbüro Pankow.
Der Kinderrechtepfad ist dauerhaft öffentlich zugänglich und kann jederzeit besucht werden. Interessierte sind herzlich zur Eröffnung eingeladen.
Eröffnungstermin:
Do., 20.11.2025, 12:00 Uhr
Spielplatz an der Marie, Marienburger Straße, 10405 Berlin
Research, Patient care / 10.11.2025
Neue Entwicklungsstörung entdeckt: Varianten des Gens UNC13A verursachen neurologische Beeinträchtigungen bei Kindern
Probleme beim Sprechen oder Laufen, Muskeln zittern und krampfen – Forschende um Noa Lipstein und Nils Brose haben in einer großen interdisziplinären Kooperation eine neue Entwicklungsstörung entdeckt, die auf Variationen im Gen UNC13A zurückzuführen ist. Die Erkenntnisse eröffnen nicht nur Behandlungsmöglichkeiten für Betroffene, sondern versprechen auch neue Ansätze für andere neurologische Erkrankungen wie Amyotrophe Lateralsklerose (ALS).
Forschende haben eine neue Entwicklungsstörung entdeckt: Varianten des UNC13A-Gens führen zu schweren neurologischen Beinträchtigungen. Das Team beschreibt drei unterschiedliche Krankheitsformen mit jeweils unterschiedlichen Symptomen mit unterschiedlichem Schweregrad, die auf verschiedenen molekularen Mechanismen beruhen. Künftig könnten sogenannte Antisense-Oligonukleotid-Therapien helfen, die Produktion krankmachender UNC13A Proteine zu unterdrücken und damit die Symptome bei zwei Formen der Krankheit abzuschwächen.
Eine E-Mail schreiben, zum Bus rennen, das Lied im Kopfhörer mitsummen – damit wir denken, fühlen oder handeln können, müssen unsere rund 100 Milliarden Nervenzellen miteinander kommunizieren. Über sogenannte Synapsen werden dabei Informationen mit Botenstoffen zwischen Zellen übertragen. Eine einzelne Nervenzelle kann bis zu 10.000 solcher Synapsen ausbilden – entsprechend zahlreich sind ihre zellulären Kommunikationspartner.
Ein Schlüsselprotein bei der synaptischen Signalübertragung ist das Protein UNC13A (Munc13-1), das daran beteiligt ist, Botenstoffe – Neurotransmitter genannt – freizusetzen. Darüber hinaus spielt UNC13A eine Rolle bei der Anpassungsfähigkeit von Synapsen, die für Lern- und Gedächtnisprozesse entscheidend ist.
Neue Entwicklungsstörung
Varianten des UNC13A‑Gens, das den Bauplan des Proteins UNC13A enthält, können zudem eine bisher unbekannte neurologische Entwicklungsstörung auslösen. Dies haben Forschende um Nils Brose vom Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften und Noa Lipstein, ehemals Mitarbeiterin in Broses Abteilung und jetzt Gruppenleiterin am Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie, gemeinsam mit den klinischen Genetiker*innen Anita Rauch (Universität Zürich, Schweiz) und Reza Asadollahi (University of Greenwich, UK) entdeckt. Ihre Erkenntnisse wurden jüngst in der Zeitschrift Nature Genetics veröffentlicht.
Im Rahmen weltweiter Kooperationen mit zahlreichen Kliniken identifizierte das Team bislang rund 50 Patient*innen, bei denen dieses Syndrom diagnostiziert wurde. Viele von ihnen haben so eine Erklärung für ihr Krankheitsbild erhalten.Das Spektrum der Beeinträchtigungen durch das veränderte Gen reicht dabei von verzögerter Entwicklung und geistigen Beeinträchtigungen über Sprach- und Bewegungsstörungen bis hin zu Zittern und Krampfanfällen. In einigen Fällen kommt es auch zum Tod im frühen Kindesalter.
Drei Formen der Entwicklungsstörung
Die Abteilung Molekulare Neurobiologie von Nils Brose erforscht seit vielen Jahren die Wirkweise des Proteins UNC13A. Nur diese langjährigen Anstrengungen ermöglichten es, die Ursachen der Entwicklungsstörung auf molekularer Ebene zu entschlüsseln. Mithilfe elektrophysiologischer Studien an Mäusen und dem Fadenwurm C. elegans konnte das Forschungsteam aufklären, wie sich verschiedene Varianten des UNC13A- Gens auf die Funktion von Nervenzell-Synapsen auswirken. In bislang 20 Fällen ist es auf diese Weise gelungen, die Krankheitsursachen aufzuklären.
„Die Symptome variieren, je nachdem, welche Funktion das UNC13A-Protein nicht mehr ausüben kann“, erklärt Lipstein. „Die krankheitsauslösenden Genvarianten lassen sich in drei Subtypen der Erkrankung zusammenfassen, bei denen jeweils andere Beeinträchtigungen von Nervenzellen auftreten. Sie rufen jeweils ein eigenes Krankheitsbild hervor und erfordern daher unterschiedliche therapeutische Ansätze, obwohl die Ursache im selben Gen liegt“, betont die Wissenschaftlerin.
Ansätze für neue Therapien
Die Ergebnisse der Forschenden machen Hoffnung für Therapien: „Antisense-Oligonukleotid-Therapien, die die Produktion krankmachender Proteine unterdrücken und so die relative Häufigkeit des normalen UNC13A-Proteins erhöhen, könnten die Krankheitssymptome bei zwei Formen der Entwicklungsstörung verringern“, sagt Brose. Die neuen Erkenntnisse können zudem Wege eröffnen, um häufigere neurologische Erkrankungen wie ALS, Frontotemporale Demenz (FTD) und die Alzheimer- Krankheit zu behandeln. Jüngste Studien zeigten, dass eine veränderte Produktion des UNC13A-Proteins ein Schlüsselfaktor für das Fortschreiten dieser Krankheiten ist.
„Unsere Studien machen den Wert langfristiger Grundlagenforschung deutlich. Die Identifizierung der genauen molekularen Grundlagen dieser neurologischen Entwicklungsstörung ist ein entscheidender Schritt zur Entwicklung von Behandlungsmethoden“, betont Lipstein.
Publikation: Asadollahi, R., Ahmad, A., Boonsawat, P. et al. Pathogenic UNC13A variants cause a neurodevelopmental syndrome by impairing synaptic function. Nat Genet (2025). https://doi.org/10.1038/s41588-025-02361-5
Abbildung: Nervenzellen (grün) bilden neuronale Netzwerke, in denen Informationen übertragen werden. Fehler in dieser Kommunikation können zu neurodegenerativen, neurologischen und neuropsychiatrischen Erkrankungen führen.
© Pia Venneker
Gemeinsame Pressemitteilung des Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie und des Max-Planck-Instituts für Multidisziplinäre Naturwissenschaften
Innovation / 07.11.2025
T-knife Therapeutics Presents Preclinical Data on PRAME-Targeted TK-6302 Highlighting its Potential as a Promising, Category-leading Therapy
– Comprehensive TK-6302 data demonstrate preclinical efficacy and safety, supporting clinical readiness, alongside established scalable manufacturing
– TK-6302 Clinical Trial Application planned in Q4 2025 for initiation of the Phase 1 ATLAS trial in 2026
San Francisco, CA and Berlin, Germany – November 7, 2025 - T-knife Therapeutics, Inc., a biopharmaceutical company developing T cell receptor (TCR) engineered T cell therapies (TCR-T) to fight cancer, today announced multiple presentations on TK-6302 were featured at the Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) Annual Meeting. TK-6302 is a differentiated, PRAME-targeted TCR-T that incorporates leading innovations, including a high-affinity TCR, a chimeric CD8 co-receptor that engages CD4 T cells and provides co-stimulation upon TCR engagement, and a FAS checkpoint converter that boosts T cell fitness and survival.
“We have conducted numerous preclinical studies evaluating TK-6302, our supercharged PRAME targeting TCR-T,” stated Peggy Sotiropoulou, Ph.D., Chief Scientific Officer of T-knife. “The competitively differentiated and consistent performance demonstrated across all analyses positions us with confidence as we prepare for the initiation of the ATLAS Phase 1 clinical trial. With the totality of the data, we have demonstrated preclinically that TK-6302 shows best-in-class anti-tumor efficacy and T cell fitness compared to peer company PRAME TCR-T approaches. Additionally, we have established our clinical manufacturing process with scalable production to support clinical development.”
Data Overview
A poster titled “Analysis of PRAME in advanced/metastatic solid tumors shows homogeneous expression and stability between lesions, across treatment lines, and upon exposure to checkpoint inhibitors” (Abstract 27) demonstrated that PRAME is expressed in multiple solid tumors and minimally present in healthy tissues, supporting its potential as a therapeutic target capable of driving deep, durable responses with a low risk of antigen-negative relapse.
A poster titled “TK-6302, a supercharged PRAME TCR-T cell therapy containing a high affinity TCR, a costimulatory CD8 coreceptor and a FAS-based switch receptor, demonstrates preclinical safety and efficacy,” (abstract 329) showcased preclinical studies demonstrating the anti-tumor activity, polyfunctionality, T cell fitness and favorable safety profile of TK-6302. TK-6302’s multi-mechanistic mode of action was further characterized through key observations:
- Supercharged PRAME CD4 and CD8 T cells directly kill tumor cells via the high-affinity TCR and chimeric CD8 co-receptor that engages CD4 T cells and provides co-stimulation upon TCR engagement (co-stim CD8 CoR).
- Supercharged PRAME CD4 T cells secrete cytokines to support CD8 T cell function and trigger global immune responses by recruiting and activating other immune cells, driving tumor control through antigen spreading, beyond HLA and target constraints.
- The co-stim CD8 CoR mediates TCR-T fitness and durable functional activity through optimal co-stimulation.
- The FAS-TNFR checkpoint converter enhances TCR-T cell engraftment and persistence via activation in the lymph nodes and prevention of FAS-L induced cell death in the tumor.
A poster titled “In-depth characterization of TK-6302, a supercharged PRAME TCR-T therapy, manufactured at-scale from healthy donors and patients,” (abstract 347) presented data demonstrating potent anti-tumor activity of TK-6302 across multiple assays, including physiologically relevant 3D tumor models that mimic solid tumor barriers, with high yield manufacturing performance. Additionally, transcriptomic profiling at harvest and following co-culture with cancer cells revealed a TK-6302 gene expression signature consistent with broad immune activation, enhanced tumor homing and sustained T cell fitness.
A poster titled “Preclinical assessment of genome editing safety in CRISPR-engineered PRAME-targeting TK-6302 TCR-T cells demonstrates editing precision and safety,” (abstract 330) reviewed comprehensive analyses of TK-6302 drug products manufactured at-scale with the clinical process, which showed high editing precision with full and correct integration of the transgene, and without concerning off-target or chromosomal aberrations.
Copies of the poster presentations can be found at: https://www.t-knife.com/technology/scientific-publications.
About T-knife Therapeutics
T-knife is a biopharmaceutical company dedicated to developing T cell receptor (TCR) engineered T cell therapies (TCR-Ts) to deliver broad, deep and durable responses to solid tumor cancer patients. The company’s unique approach leverages its proprietary platforms and synthetic biology capabilities to design the next-generation of supercharged TCR-Ts with best-in-class potential.
The company’s lead program, TK-6302, is a supercharged PRAME targeting TCR-T that includes novel enhancements to improve T cell fitness and persistence, to overcome the immunosuppressive tumor micro-environment, and to improve durability of response. The company plans to submit a Clinical Trial Application (CTA) in Q4 2025 and to initiate the ATLAS Phase 1 clinical trial of TK-6302 in 2026.
T-knife was founded by leading T cell and immunology experts utilizing technology developed at the Max Delbrück Center for Molecular Medicine together with Charité – Universitätsmedizin Berlin, is led by an experienced management team, and is supported by a leading group of international investors, including Andera Partners, EQT Life Sciences, RA Capital Management and Versant Ventures. For additional information, please visit the company’s website at www.t-knife.com.
Living, Education / 05.11.2025
Schüler*innenHaushalt 2026: Bis 30. November bewerben und Demokratie im Schulalltag erlebbar machen
Schüler*innenHaushalt 2026: Bis 30. November bewerben und Demokratie im Schulalltag erlebbar machen
Im Jahr 2026 haben erneut Schulen in Pankow die Möglichkeit, am Projekt Schüler*innenHaushalt teilzunehmen. Ziel des Projekts ist es, Schülerinnen und Schülern demokratische Mitbestimmung praxisnah zu vermitteln. Jede teilnehmende Schule erhält ein festes Budget von 2.000 Euro, über das die Schülerinnen und Schüler in einem demokratischen Prozess selbst entscheiden.
Voraussichtlich können bis zu zwei weitere Schulen im kommenden Jahr neu in das Projekt aufgenommen werden. Die Teilnahme im pädagogischen Begleitprogramm ist für eine Laufzeit von voraussichtlich drei Jahren vorgesehen. Bewerben können sich alle öffentlichen Schulen in bezirklicher Trägerschaft – darunter Grundschulen, Integrierte Sekundarschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen sowie Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt.
Servicestelle Jugendbeteiligung e.V. unterstützt die Schulen
Die pädagogische Begleitung erfolgt durch die Servicestelle Jugendbeteiligung e.V., die den Schüler*innenHaushalt in Berlin seit 2015 koordiniert. Sie unterstützt die Schulen durch Beratung, Materialien und Workshops, sodass die Schülerinnen und Schüler sowohl eigene Projektideen umsetzen als auch demokratische Prozesse verstehen und aktiv erleben können.
Wichtige Termin
- Bewerbungsschluss: 30. November 2025
- Rückmeldung zur Teilnahme: Ende Januar 2026
- Projektumsetzung: Februar bis November 2026
Detaillierte Informationen sowie die Bewerbungsunterlagen finden sich auf der Projektwebsite www.schuelerinnen-haushalt.de/ausschreibung
Patient care / 03.11.2025
Das Helios Klinikum Berlin-Buch begrüßt Priv.-Doz. Dr. med. Daniel Pink als neuen Chefarzt für Onkologie und Palliativmedizin
Bad Saarow / Berlin-Buch: Priv.-Doz. Dr. med. Daniel Pink betreut als Chefarzt für Onkologie und Palliativmedizin zukünftig beide Helios-Standorte
Zusätzlich zu seiner bisherigen Tätigkeit als Chefarzt der Klinik für Onkologie und Palliativmedizin am Helios Klinikum Bad Saarow übernimmt Priv.-Doz. Dr. med. Daniel Pink am 01. November 2025 im Rahmen einer zweimonatigen Übergangsphase die Position des Chefarztes der Onkologie und Palliativmedizin des Helios Klinikums Berlin-Buch. Am 01. Januar 2026 wird sich Prof. Dr. med. Peter Reichardt aus seinem Amt als bisheriger Bucher Chefarzt verabschieden und seinen Posten offiziell an Dr. med. Pink übergeben. Prof. Reichardt wird weiterhin am Helios Klinikum Berlin-Buch tätig sein und übernimmt in Ergänzung zu seiner Professur für Onkologie an der MSB Medical School Berlin die Leitung der Onkologischen Forschung und der Sarkomforschung, sodass auch weiter eine enge Zusammenarbeit mit Dr. med. Daniel Pink bestehen wird.
„Ich freue mich, die bereits enge Zusammenarbeit zwischen den Standorten Bad Saarow und Berlin-Buch weiter voranzutreiben. Unser Ziel ist es, für Patient:innen mit Tumorerkrankungen ein optimales regionales Behandlungsangebot und eine hochqualifizierte und wenn immer möglich wohnortnahe Betreuung anzubieten“, erklärt Chefarzt Dr. med. Pink.
Er wird gemeinsam mit seinem Team verstärkt daran arbeiten, die möglichst individualisierte Betreuung von Krebspatient:innen im Netzwerk der Helios Tumormedizin Berlin-Brandenburg optimal zu strukturieren und auszubauen. Die Zusammenarbeit in der Helios-Gruppe im Bereich der Tumormedizin aber auch überregional weiter zu intensivieren, gehört für Herrn Dr. Pink zu den Hauptzielen der Helios Fachgruppe Hämatologie / Onkologie, deren Leitung er ebenfalls im September 2025 übernommen hat.
Sein Studium der Humanmedizin absolvierte er an der Charité Berlin. Im Rahmen seiner Weiterbildung zum Facharzt für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie und seiner wissenschaftlichen Forschung war Dr. Daniel Pink zunächst in der Robert-Rössle-Klinik der Charité-Berlin Campus Buch sowie später dem Helios Klinikum Bad Saarow und der Universitätsmedizin Greifswald tätig. Seit 2014 leitet er als Chefarzt die Klinik für Onkologie und Palliativmedizin am Standort Bad Saarow. „Wir möchten unseren Patient:innen einen unkomplizierten und strukturierten Zugang zu allen hochspezialisierten und komplexen Behandlungsverfahren anbieten. Mit Dr. med. Pink haben wir für diese Aufgabe einen erfahrenen und hochqualifizierten Experten gewonnen, der die Region gut kennt und hervorragende Netzwerkarbeit leistet. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm am Standort Berlin-Buch“, bestätigt Carmen Bier, Klinikgeschäftsführerin des Helios Klinikums Berlin-Buch.
Weiterhin sind auf Personalebene zusätzliche Anpassungen geplant. So wird die langjährige leitende Oberärztin Dr. med. Antje West in Bad Saarow zur Standortleiterin ernannt und ihr Spektrum an Leitungsaufgaben somit erweitert.
Weitere Informationen über die Onkologie und Palliativmedizin des Helios Klinikums Berlin-Buch finden Sie auf hier.
Foto: (V.l.n.r.) Freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit: Der bisherige Chefarzt der Klinik für Onkologie und Palliativmedizin, Prof. Dr. med. Peter Reichardt, Klinikgeschäftsführerin Carmen Bier und der neue Chefarzt der Klinik für Onkologie und Palliativmedizin, Priv.-Doz. Dr. med. Daniel Pink. (Foto: Dirk Pagels / Helios)
Das Helios Klinikum Berlin-Buch ist ein modernes Krankenhaus der Maximalversorgung mit über 1.000 Betten in mehr als 60 Kliniken, Instituten und spezialisierten Zentren sowie einem Notfallzentrum mit Hubschrauberlandeplatz. Jährlich werden hier mehr als 55.000 stationäre und über 144.000 ambulante Patienten mit hohem medizinischem und pflegerischem Standard in Diagnostik und Therapie fachübergreifend behandelt, insbesondere in interdisziplinären Zentren wie z.B. im Brustzentrum, Darmzentrum, Hauttumorzentrum, Perinatalzentrum, der Stroke Unit und in der Chest Pain Unit. Die Klinik ist von der Deutschen Diabetes Gesellschaft als „Klinik für Diabetiker geeignet DDG“ zertifiziert. Zudem ist die Gefäßmedizin in Berlin-Buch dreifach durch die Fachgesellschaften der DGG (Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin), der DGA (deutsche Gesellschaft für Angiologie) und der DEGIR (deutsche Gesellschaft für interventionelle Radiologie) als Gefäßzentrum zertifiziert.
Gelegen mitten in Berlin-Brandenburg, im grünen Nordosten Berlins in Pankow und in unmittelbarer Nähe zum Barnim, ist das Klinikum mit der S-Bahn (S 2) und Buslinie 893 oder per Auto (ca. 20 km vom Brandenburger Tor entfernt) direkt zu erreichen.
Helios gehört zum Gesundheitskonzern Fresenius und ist Europas führender privater Gesundheitsdienstleister mit rund 128.000 Mitarbeitenden. Zu Fresenius Helios gehören die Helios Gruppe in Deutschland sowie Quirónsalud in Spanien und Lateinamerika. Rund 26 Millionen Menschen entscheiden sich jährlich für eine medizinische Behandlung bei Helios. 2024 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von mehr als 12,7 Milliarden Euro.
In Deutschland verfügt Helios über mehr als 80 Kliniken, rund 220 Medizinische Versorgungszentren (MVZ) mit etwa 570 kassenärztlichen Sitzen, sechs Präventionszentren und 27 arbeitsmedizinische Zentren. Helios behandelt im Jahr rund 5,5 Millionen Menschen in Deutschland, davon mehr als 4 Millionen ambulant. Seit seiner Gründung setzt Helios auf messbare, hohe medizinische Qualität und Datentransparenz und ist bei über 90 Prozent der Qualitätsziele besser als der bundesweite Durchschnitt. In Deutschland beschäftigt Helios rund 78.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 7,7 Milliarden Euro. Sitz der Unternehmenszentrale ist Berlin.
Quirónsalud betreibt 57 Kliniken, davon sieben in Lateinamerika, rund 130 ambulante Gesundheitszentren sowie über 300 Einrichtungen für betriebliches Gesundheitsmanagement. Jährlich werden hier rund 20 Millionen Patient:innen behandelt, davon mehr als 19 Millionen ambulant. Quirónsalud beschäftigt rund 50.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von mehr als 5 Milliarden Euro.
www.helios-gesundheit.de
Living / 30.10.2025
Pankower Frauenpreis 2026 – Einreichungen bis 8. Dezember 2025 möglich
Vom 1. November bis einschließlich 8. Dezember 2025 können Vorschläge und Eigenbewerbungen für den Pankower Frauenpreis 2026 im Bezirksamt Pankow eingereicht werden.
Ehrung für gleichstellungspolitisches Engagement
Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März ehrt der Pankower Frauenpreis seit dem Jahr 2020 Einzelpersonen, Frauenprojekte, Initiativen oder Unternehmen in Pankow, die sich im Bezirk für die Rechte von Frauen und Mädchen einsetzen und die Geschlechterdemokratie fördern. Ausgezeichnet wird das besondere gleichstellungspolitische Engagement, welches beispielsweise auf die Einhaltung und Förderung der Rechte von Frauen und Mädchen abzielt, marginalisierte Frauengruppen unterstützt oder innovativ-nachhaltige Gleichstellungsprojekte entwickelt. Darin inkludiert sind alle Personen, die sich als Frau oder Mädchen verstehen.
Vorschläge und Bewerbungen
Vom 1. November bis 8. Dezember 2025 können Vorschläge oder Eigenbewerbungen mit einer ausführlichen Begründung im Bezirksamt Pankow eingereicht werden, vorzugsweise per E-Mail an die Gleichstellungsbeauftragte Ulrike Spieler (gleichstellung@ba-pankow.berlin.de).
Über die Vergabe des Pankower Frauenpreises entscheidet eine für die Dauer der laufenden Wahlperiode eingesetzte Jury. Die Preisverleihung findet voraussichtlich am 26. März 2026 im Rahmen einer öffentlichen Festveranstaltung statt.
Der Pankower Frauenpreis ist mit 1.000 Euro dotiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Kontakt:
Gleichstellungsbeauftragte im Bezirksamt Pankow – Ulrike Spieler
Tel.: (030) 90295 2305, E-Mail: gleichstellung@ba-pankow.berlin.de
Die Auslobungsunterlagen mit den vollständigen Kriterien sind zu finden unter:
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/gleichstellung/artikel.126006.php
Research / 21.10.2025
Why APOE4 raises Alzheimer’s risk
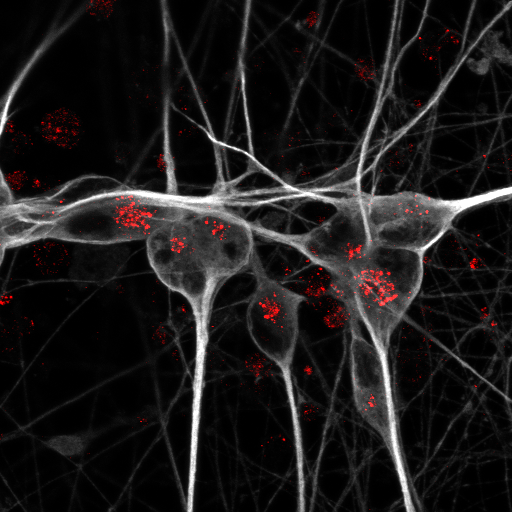
Researchers at the Max Delbrück Center and Aarhus University have found a mechanism through which the gene variant APOE4, long linked to a high risk of developing Alzheimer’s disease, impairs neuronal function in the aging brain. The research was published in “Nature Metabolism.”
The gene variant APOE4 has long been known as the strongest genetic risk factor for late-onset Alzheimer’s disease, raising the risk about twelve-fold as compared to non-carriers. Yet its close relative, APOE3 – the most common variant in humans – does not appear to increase susceptibility to the disease. The reason for this stark difference has been unclear.
Now, a study published in “Nature Metabolism” may explain the mechanism: Neurons exposed to APOE3 protein can use long-chain fatty acids as an alternative source of energy when glucose is scarce. But this vital metabolic pathway is blocked in the APOE4 brain.
“The ability to use glucose diminishes in the aging brain, forcing nerve cells to use alternative sources for energy production,” explains Professor Thomas Willnow, Group Leader of the Molecular Cardiovascular Research lab at the Max Delbrück Center and senior author of the paper. Willnow also holds a professorship in the Department of Biomedicine at Aarhus University. “APOE4 appears to block nerve cells from utilizing lipids as an alternative energy source when their supply of glucose decreases.”
Experiments in mice and human neurons
The brain consumes around a fifth of the body’s glucose supply. Yet as we age, its ability to metabolize glucose drops. This decline is a hallmark of both normal aging and Alzheimer’s disease, and starts decades before symptoms of dementia become apparent.
ApoE, the protein encoded by the APOE gene, belongs to a family of fat-binding proteins, called apolipoproteins. In the central nervous system, ApoE is mainly released by brain cells called astrocytes. It helps to deliver lipids to nerve cells.
To understand why the APOE4 variant so dramatically raises the risk of Alzheimer’s disease compared to APOE3, co-first authors Dr. Anna Greda, assistant professor at the Willnow lab at Aarhus University, and Dr. Jemila Gomes, who did her PhD in Aarhus and is now a postdoc in the Willnow lab in Berlin, collaborated with the Technology Platforms for Pluripotent Stem Cells and Electron Microscopy at the Max Delbrück Center. They used genetically engineered mice that carry human APOE3 or APOE4 genes. They found that APOE3 interacts with a receptor called sortilin to deliver fatty acids into neurons. By contrast, APOE4 disrupts sortilin’s function, preventing uptake of lipids by neurons.
To confirm the relevance of their findings for human brain health, the scientists then turned to human stem cell-derived neurons and astrocytes carrying different APOE variants. Again, they observed that APOE3 allowed neurons to metabolize long-chain fatty acids, while the presence of APOE4 shut down this ability.
“By using transgenic mouse models and stem-cell-derived human brain cell models, we discovered that the pathway enabling nerve cells to burn lipids for energy production doesn’t work with APOE4, because this APOE variant blocks the receptor on nerve cells required for lipid uptake,” explains Greda.
New treatments for Alzheimer’s
“Our research suggests that the brain is highly dependent on being able to switch from glucose to lipids as we age. It seems that individuals, who are carriers of the APOE4 gene, may be compromised to do so, increasing their risk of nerve cell starvation and death during aging,” Gomes adds. Still, “this work opens new avenues for interventions that could improve lipid-based energy use in APOE4 carriers.”
There are already marketed drugs that specifically target the body’s ability to utilize lipids, Willnow says. Such drugs can now be studied for their potential to treat people with APOE4. As a proof, the researchers showed that treating neurons with the drug bezafibrate restored fatty acid metabolism in APOE4-expressing cells. Of course, such drugs need to be tested in clinical trials, Willnow adds, “but I am hopeful that our research suggests new treatment options for this devasting disease.”
Text: Gunjan Sinha / Vibe Bregendahl Noordeloos, Aarhus University
Research / 17.10.2025
A potential new drug for stiff hearts
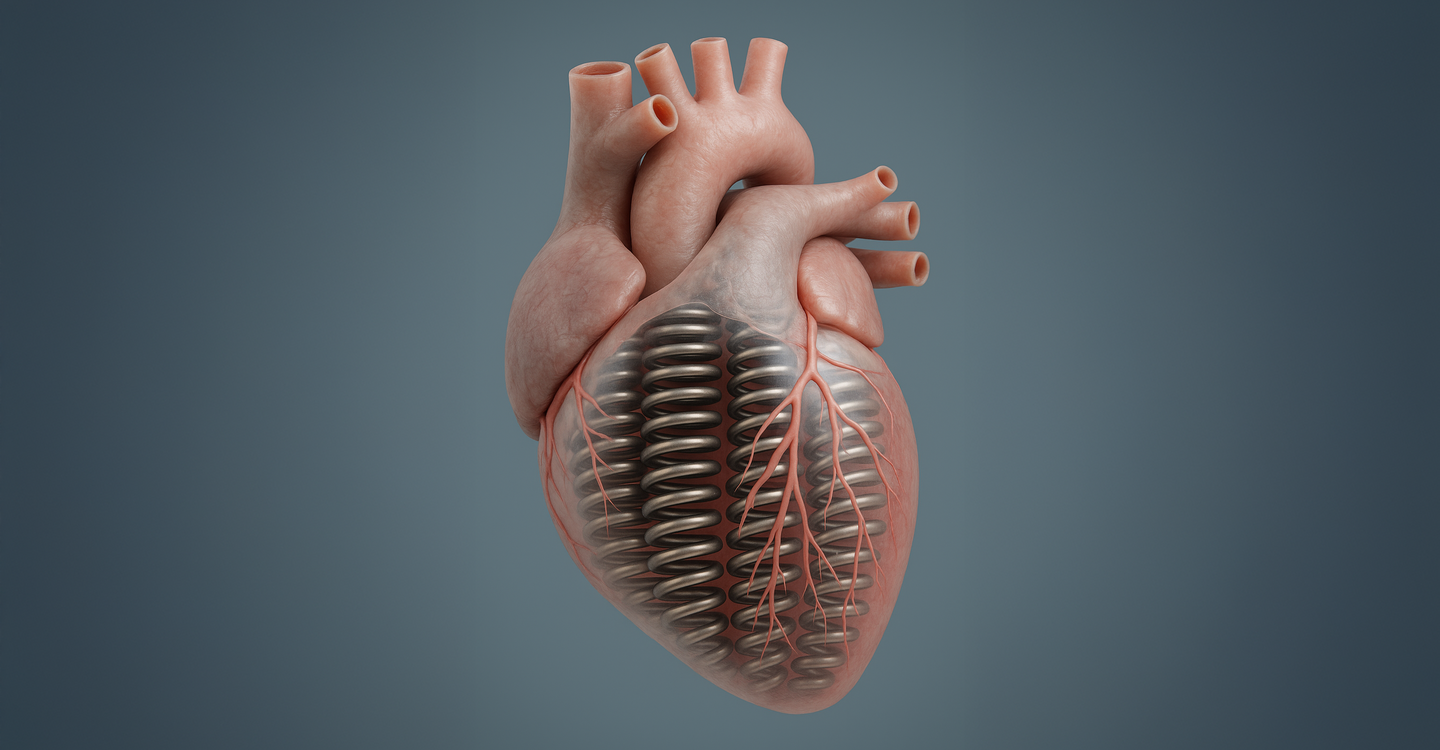
Michael Gotthardt at the Max Delbrück Center and collaborators are developing a drug to treat a common type of heart failure characterized by impaired cardiac filling. In “Cardiovascular Research,” his group and a US team showed the therapy improves cardiac function in a mouse model of the disease.
As we age, our muscles tend to stiffen, including one of the most vital muscles in our bodies: the heart. This is why older adults often suffer from a specific type of heart failure whereby the organ continues to pump blood, but becomes too stiff to relax and to fully fill between beats.
“There’s currently no effective medication that lowers mortality in this form of heart failure – heart failure with preserved ejection fraction, or HFpEF,” says Professor Michael Gotthardt, Group Leader of the Translational Cardiology and Functional Genomics lab at the Max Delbrück Center in Berlin. For more than a decade, Gotthardt’s research has focused on uncovering the molecular mechanisms of HFpEF and developing therapeutic strategies to counteract them.
In the journal “Cardiovascular Research,” he and a team led by Professor Henk Granzier from the College of Medicine, Tucson at the University of Arizona – a longtime collaborator – report that a drug they developed, called RBM20-ASO, improves heart muscle elasticity and cardiac filling in a mouse model that better reproduces the multifactorial pathology of human HFpEF than any previously established model. “After treatment with RBM20-ASO, the mice’s hearts were markedly more compliant and capable of expanding and filling with blood after contracting,” Gotthardt explains.
Elastic forms of the protein titin
“Most people with HFpEF have comorbid conditions such as obesity, high blood pressure, elevated blood lipids or high blood sugar,” says Dr. Mei Methawasin, first author of the study who now leads her own group at the University of Missouri at Columbia. “For the first time, we tested the drug in mice that not only developed HFpEF, but also had these comorbidities – to better simulate the human disease.”
The drug is an antisense oligonucleotide (ASO) – a short, single-stranded nucleic acid molecule designed to reduce the amount, and therefore the activity, of the splicing regulator RBM20. This factor plays a critical role in determining whether heart muscle cells produce a more elastic or stiffer version of the giant protein titin, which functions as a molecular spring in cardiac muscle. Gotthardt and colleagues had previously demonstrated that RBM20-ASO prompts heart cells to express more of the elastic titin variant – similar to what’s seen in very young hearts – completely reversing HFpEF-like symptoms in genetic animal models of the disease.
High doses not required
“The current study also aimed to determine the optimal dose of the drug to minimize side effects, including immune system disturbances,” says Methawasin. The team found that reducing RBM20 levels by about half was enough to improve the heart's diastolic function – its ability to fill with blood – without impairing its pumping strength, or systolic function.
“Our treatment significantly reduced left ventricular stiffness and abnormal thickening of the heart muscle, even in the presence of persistent comorbidities,” adds Gotthardt. Moreover, side effects in treated animals were moderate. The researchers believe they can reduce these effects even further by increasing the dosing interval – an approach they plan to test in future studies.
“Our results suggest that using ASOs to modulate RBM20 protein levels could be a viable alternative or complementary therapy for HFpEF – one capable of restoring diastolic function and limiting further organ damage, either as a standalone or adjunctive treatment” says Gotthardt. Supported by the Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung and the German Research Foundation, he is planning to bring this treatment to HFpEF patients in collaboration with colleagues from the Deutsches Herzzentrum der Charité in Berlin. Before clinical translation, however, the therapeutic strategy will undergo further evaluation in a porcine model to validate its safety and efficacy.
Text: Anke Brodmerkel
Source: Press Release Max Delbrück Center
A potential new drug for stiff hearts
Research / 23.09.2025
Volker Haucke receives the Ernst Schering Prize 2025
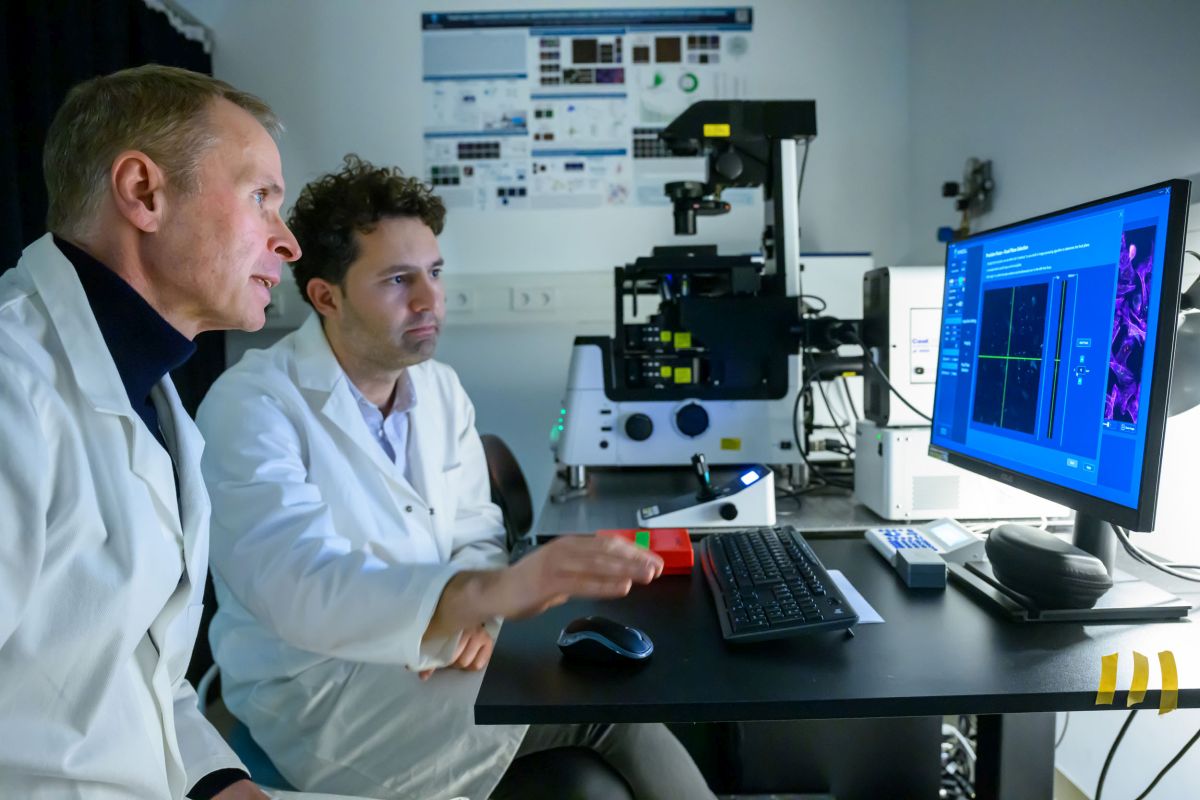
The Ernst Schering Prize 2025, endowed with 50.000 euros, is awarded to Prof. Dr. Volker Haucke, Director at the Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP) and Professor of Molecular Pharmacology at Freie Universität Berlin.This prestigious science award honors his groundbreaking discoveries on the function of signaling lipids, which control the cellular responses to messengers, hormones, and nutrients, thereby shaping central processes in cell communication.
Dysfunctions in lipid signaling are associated with a wide range of diseases—from stroke to neurodegeneration and cancer. Prof. Haucke’s research thus provides critical biomedical insights of far-reaching clinical relevance. From numerous remarkable nominations, an international jury selected him for this award.
At the core of Haucke’s scientific work lies the role of membrane lipids, known as phosphoinositides. Acting as molecular switches, they regulate the transport of messengers and cellular components. His pioneering studies on vesicle transport and neuronal signaling have fundamentally advanced our understanding of cellular communication in the brain.
A systems biology perspective on diseases
Prof. Haucke emphasizes the importance of a systems biology perspective for biomedical progress: “Those who seek biomedical progress must not be content with simple causal chains.” Different diseases may be rooted in the same cellular mechanisms, even if triggered by distinct genes. “If we understand these common mechanisms, drugs that are already approved could prove effective for other diseases as well—faster, more targeted, and with lower risk.” In neuroscience in particular, this approach opens up new perspectives on complex disorders such as Alzheimer’s, Parkinson’s, and rare genetic diseases.
Beyond theory, Prof. Haucke and his team are also making practical progress. They have developed novel compounds that specifically influence key processes such as cell division and blood clotting. These discoveries open up promising therapeutic options, particularly in the fields of cancer and vascular medicine.
“Through his discoveries, Prof. Volker Haucke has not only revolutionized our understanding of cellular mechanisms, but also paved the way for innovative therapeutic approaches in medicine,” says Prof. Max Löhning, Chairman of the Foundation Council. “He is an outstanding example of how basic research can translate into societal impact.”
New perspectives on the brain
Prof. Dr. Detlev Ganten, Founding Director of the Virchow Foundation and nominator for the prize, highlights one aspect in particular: “Among Volker Haucke’s many important research findinmgs, I am especially fascinated by his findings on the question: What makes the brain a thinking organ? Each of the 100 billion neuronal cells in the human brain has 7,000 points of contact (synapses) to other, far-distant neuronal cells. Volker Haucke has discovered that this extensive synaptic network in the brain is created by signaling lipids that make intelligent, networked thinking possible in the first place.”
The Ernst Schering Prize is awarded annually by the Schering Foundation and honors outstanding scientists worldwide whose groundbreaking research has generated new inspiring models or led to fundamental shifts in biomedical knowledge. Previous laureates include Nobel laureates Christiane Nüsslein-Volhard, David MacMillan, Carolyn Bertozzi, and Svante Pääbo.
Dr. Jörg Maxton-Küchenmeister, Managing Director of the Schering Foundation, emphasizes: “Through his pioneering work on lipid signaling, Prof. Volker Haucke has fundamentally transformed our understanding of key cell processes and opened up new pathways to treating major diseases such as cancer or neurodegenerative disorders. Moreover, his commitment to sustainable lab work deserves special recognition.”
With the Ernst Schering Prize 2025, Prof. Haucke receives a significant recognition of his outstanding scientific achievements and his contribution to advancing the frontiers of biomedical research. The award ceremony will take place on 24 November 2025 in Berlin.
Innovation / 20.09.2025
Eckert & Ziegler Gains Approval for GalliaPharm® in Japan
Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH (Eckert & Ziegler), a leading provider of isotope technology for nuclear medicine and radiopharmaceutical applications, has received marketing authorization in Japan from Japan’s Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) for its GalliaPharm® 68Ge/68Ga Radionuclide Generator, through Novartis Pharma K.K. which will oversee product distribution and safety information management as the Designated Marketing Authorization Holder for GalliaPharm® in Japan.
This authorization opens the door for broader use of Gallium-68–based diagnostics in Japan through the clinical use of the Novartis kit Locametz® for radiopharmaceutical preparation of 68Ga-PSMA-11, which has also been granted approval.
GalliaPharm® is an established GMP-grade generator for Gallium-68, used internationally in the preparation of radiopharmaceuticals for positron emission tomography (PET) imaging, particularly in enabling PSMA imaging for prostate cancer detection. With the approval now in place, healthcare providers in Japan will be able to access a dependable and proven tool for producing Gallium-68 radiopharmaceuticals, supporting more precise imaging and potentially facilitating earlier diagnosis.
“This regulatory clearance marks a significant step for our medical division,” said Dr. Deljana Werner, Global Director Quality and Regulatory Affairs for the Medical Division of Eckert & Ziegler SE. “Introducing GalliaPharm® to Japan means we can equip local nuclear medicine specialists with the same high-quality generator technology that has supported diagnostic imaging advancements in many other regions.”
The entry of GalliaPharm® into Japan reflects Eckert & Ziegler’s ongoing commitment to expanding access to reliable isotope technologies, tailored to the requirements of local markets, and to fostering innovation in molecular imaging worldwide.
About Eckert & Ziegler SE
Eckert & Ziegler SE, with more than 1,000 employees, is a leading specialist in isotope-related components for nuclear medicine and radiation therapy. The company offers a broad range of services and products for the radiopharmaceutical industry, from early development work to contract manufacturing and distribution. Eckert & Ziegler SE shares (ISIN DE0005659700) are listed in the TecDAX index of Deutsche Börse
Source: Press Release Eckert & Ziegler
Eckert & Ziegler Gains Approval for GalliaPharm® in Japan
Research, Innovation, Patient care, Education / 18.09.2025
Talk in the Cube: IP STRATEGIES IN BIOTECHNOLOGY
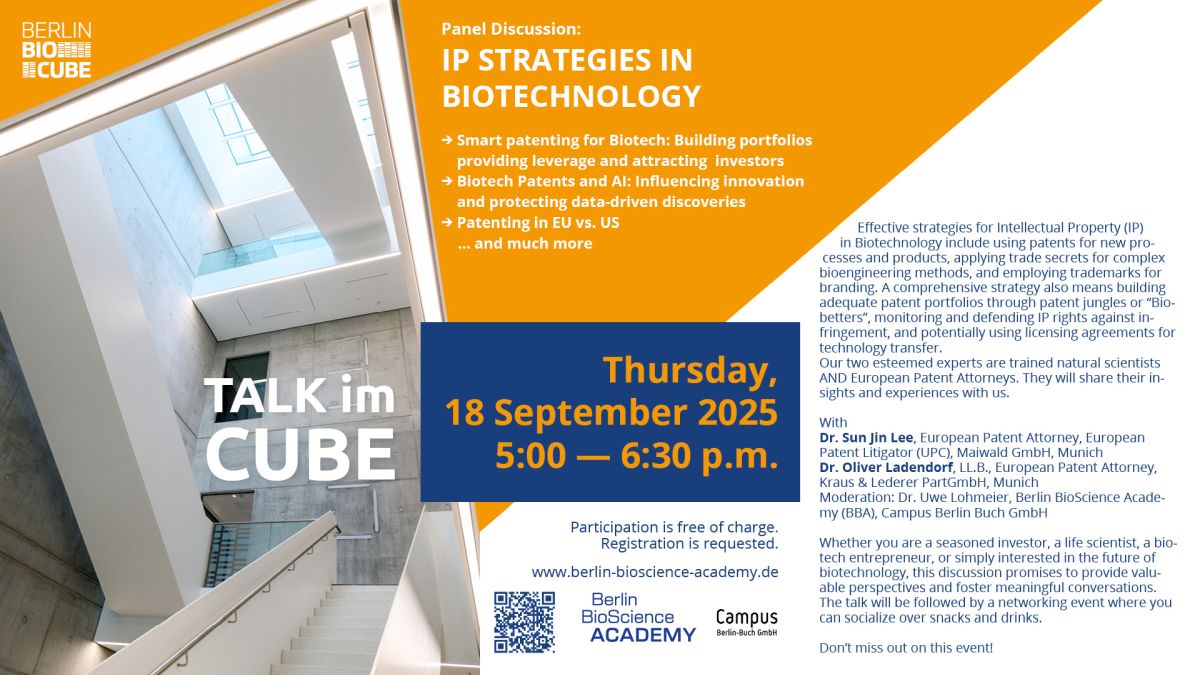
We are excited to continue the Talks in the Cube with an expert discussion focused on Strategies for Intellectual Property Rights in Biotechnology.
Effective strategies for Intellectual Property (IP) in Biotechnology include using patents for new processes and products, applying trade secrets for complex bioengineering methods, and employing trademarks for branding. A comprehensive strategy also means building adequate patent portfolios through patent jungles or "Biobetters", monitoring and defending IP rights against infringement, and potentially using licensing agreements for technology transfer.
Our two esteemed experts who are trained natural scientists AND European Patent Attorneys. They will share their insights and experiences with us.
A Panel Discussion with
Dr. Sun Jin Lee, European Patent Attorney, European Patent Litigator (UPC), Maiwald GmbH, Munich
Dr. Oliver Ladendorf, LL.B., European Patent Attorney, Kraus & Lederer PartGmbH, Munich
Dr. Uwe Lohmeier, Berlin BioScience Academy (BBA), Campus Berlin Buch GmbH (Moderation).
Topics planned to be addressed
- Smart patenting for Biotech: Portfolios providing leverage and attracting investors
- Licensing of innovative technologies: Patents for organoids and CRISPR/Cas
- Biotech Patents and AI: Examples to influence innovations and to protect data-driven discoveries.
The talk will be followed by a networking event where you can socialize over snacks and drinks.
Target audience
Founders & scientists from start-ups, small and medium-sized life science companies and scientific institutions.
Costs
Participation is free of charge. Registration is requested.
When
Thursday, 18 September 2025
5:00 p.m. - 7:00 p.m.
Where
BerlinBioCube (Building D95), Campus Berlin-Buch, Robert-Rössle-Straße 10, 13125 Berlin
Quelle: BerlinBioscience Academy
Further information and registration
Research, Innovation, Living, Patient care, Education / 14.09.2025
Mikrotom, Mikroskop, Mikrowaage - Campusmuseum öffnet am Tag des offenen Denkmals
Entdecken Sie am 14. September 2025 die Sammlung des Campusmuseums und tauchen Sie ein in die Entwicklung der Mikroskope aus der Berlin-Brandenburger Produktion.
Im Erdgeschoss des Oskar-und-Cécile-Vogt-Hauses sind wissenschaftliche Geräte aus einem Jahrhundert biomedizinischer Forschung ausgestellt, die Etappen der Medizin- und Forschungsgeschichte nachzeichnen. Entdecken Sie am 14. September 2025 beim Tag des offenen Denkmals die Sammlung des Campusmuseums und tauchen Sie mit Dr. Jochen Müller ein in die Entwicklung der Mikroskope aus der Berlin-Brandenburger Produktion. Der Campus Berlin-Buch beteiligt sich erstmals.
10:00 bis 15:00 Uhr
Museum für Wissenschaftsgeschichte auf dem Campus Berlin-Buch
Die Geschichte der medizinischen Forschung in Berlin-Buch zeigt in eindrucksvoller Weise das Campusmuseum des Campus Berlin-Buch. Im Oskar-und-Cécile-Vogt-Haus sind wissenschaftliche Geräte aus einem Jahrhundert biomedizinischer Forschung ausgestellt. Die integrierte Ausstellung `Unsichtbar-Sichtbar-Durchschaut` zeigt die einzigartige Verbindung von Wissenschaft und optischer Industrie, die sich in der Region Berlin/Brandenburg am Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelte.
Lernen Sie das Campusmuseum auf einem Rundgang mit Dr. Jochen Müller, Kurator der Mikroskopie-Ausstellung, kennen.
Sie finden das Museum im Oskar-und-Cécile-Vogt-Haus (Haus B55), Seiteneingang Nordseite. Das Museum ist direkt zugänglich.
Anmeldung nicht erforderlich
16:00 Uhr
Die Geschichte des Campus Berlin-Buch
Ein Rundgang durch die Geschichte des Campus Berlin-Buch! Lassen Sie sich auf einem Rundgang mit Jochen Müller in längst vergangene Zeiten entführen – von der Krankenhausstadt und den ersten Forschungseinrichtungen in Buch über die Institute der Akademie der Wissenschaften der DDR bis hin zu den Neugründungen nach 1989.
Dauer: circa 60 Minuten. Anmeldung nicht erforderlich
Start: Am Oskar-und-Cécile-Vogt-Haus (Haus B55), Haupteingang
Geführt durch: Dr. Jochen Müller
Veranstaltungsort: Campus Berlin-Buch, Robert-Rössle-Straße 10, 13125 Berlin
Tag des offenen Denkmals auf dem Campus Berlin-Buch
Weitere offene Denkmäler in Berlin-Buch
- IV. Städtische Irrenanstalt, später Genesungsheim (Sa, 13.09.)
- Barocke Schlosskirche Buch (So, 14.09.)
- Ehemalige Städtische Zentrale Buch (So, 14.09.)
Details hier: https://denkmaltag.berlin.de/bezirke?bid=43
Der Tag des offenen Denkmals® ist die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Seit 1993 wird sie von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht, bundesweit koordiniert. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist für das Konzept des Aktionstags verantwortlich, legt das jährliche Motto fest und stellt ein umfassendes Online-Programm sowie zahlreiche kostenlose Werbemedien zur Verfügung. Sie unterstützt die Veranstalter mit bundesweiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie einem breiten Serviceangebot. Der Tag des offenen Denkmals ist der deutsche Beitrag zu den European Heritage Days. Mit diesem Tag schafft die Deutsche Stiftung Denkmalschutz große Aufmerksamkeit für die Denkmalpflege in Deutschland. Vor Ort gestaltet wird der Tag von unzähligen Veranstaltern – von Denkmaleigentümern, Vereinen und Initiativen bis hin zu hauptamtlichen Denkmalpflegern, ohne die die Durchführung des Tags des offenen Denkmals nicht möglich wäre. Der Tag des offenen Denkmals ist eine geschützte Marke der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.
Die App zum Tag des offenen Denkmals® kann ganzjährig genutzt werden, um Neues über die DSD zu erfahren. Ab August sind in jedem Jahr die Events und Denkmale, die Teil des größten Kulturevents Deutschlands sind, zu finden. Routenplanung, Favoritenliste und eine übersichtliche Karte runden die Planung des persönlichen Aktionstags ab. Jetzt kostenfrei in den Stores für Android und iOS hier herunterladen: www.tag-des-offenen-denkmals.de/app.
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist die größte private Initiative für Denkmalschutz in Deutschland. Sie setzt sich kreativ, fachlich fundiert und unabhängig für den Erhalt bedrohter Denkmale ein. Insgesamt konnte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz dank der aktiven Mithilfe von über 200.000 Förderern bereits rund 7.500 Denkmale mit mehr als einer drei viertel Milliarde Euro in ganz Deutschland unterstützen. Sie finanziert ihre Arbeit vor allem durch private Zuwendungen und Spenden.
Campus Berlin-Buch
Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin-Buch
Education / 04.09.2025
Auf Tuchfühlung mit der Zukunft im Futurium
Das Gläsernes Labor ist beim Mitmachtag im Zeichen der Wissenschaft am 4. Oktober dabei
Auf Tuchfühlung mit der Zukunft heißt es am 4. Oktober im Futurium in Berlin-Mitte. Zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller laden zu einer Entdeckungsreise rund um die Frage Wie könnte sie wohl aussehen – die Welt von morgen? ein, präsentieren einige der unzählige Ideen dazu und bieten einen Blick in die Labore der Zukunft!
Besucherinnen und Besucher können einen spannenden Tag voller Entdeckungen in der faszinierenden Welt von morgen erleben, experimentieren, Fragen stellen, an Erfindungen tüfteln. Mit Multitouchtischen, VR-Brillen, Quiz und vielem mehr gibt es für neugierige Kids genauso viel zu erkunden wie für wissensdurstige Erwachsene – von Peilsendern für Geier über die Geheimnisse der Sprache bis hin zur biologischen Vielfalt des Kohls.
Die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. bietet gemeinsam mit dem Gläsernen Labor spannende Einblicke in die aktuelle medizinische Forschung. Ein interaktiver Stand lädt zum Experimentieren, Mitmachen und Entdecken ein: Welche Verbindung besteht zwischen Darmmikrobiom und Herz? Was sagt die Handkraft über den Alterungsprozess aus? Mittels einer VR-Brille können Besucherinnen und Besucher das Herz erkunden, mehr über die Herzgesundheit erfahren und lernen, was bei einem Herzinfarkt geschieht oder wie ein EKG funktioniert. Ein unterhaltsames Quiz fordert zum Wissenscheck auf. Das Gläserne Labor ist das gemeinsame Schülerlabor der Einrichtungen des Campus Berlin-Buch und eines von 33 Schülerlaboren der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V., der größten Wissenschaftsorganisation Deutschlands.
Sonnabend, 4. Oktober 2025 ab 10 Uhr
Veranstaltungsort: Foyer, Lab, Ausstellung im Futurium, Alexanderufer 2, 10117 Berlin
Eintritt: kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Für Familien und Kinder
Das Futurium lädt in freundlicher Zusammenarbeit mit seinen Gesellschaftern: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR), Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Fraunhofer-Gesellschaft, Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V., Joachim Herz Stiftung, Leibniz-Gemeinschaft, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V. – Nationale Akademie der Wissenschaften ein.
Die Gesellschafter des Futuriums – Partner und Unterstützer – geben exklusive Einblicke in ihre Visionen und zeigen, wie sie die Zukunft aktiv mitgestalten. Erfahren Sie, woran heute schon geforscht und gearbeitet wird und was schon bald Realität sein könnte. Von Multitouchtischen zur Zukunft der Landwirtschaft über VR-Brillen, die ins Inneres des Herzens schauen, bis zu Quizzen, Geiern mit Sendern und der biologischen Vielfalt des Kohls.
Quelle: Futurium
Weitere Informationen zur Veranstaltung
Living / 03.09.2025
Kunst- und Kulturförderung im Bezirk Pankow: Bis 15. Oktober Mittel für Projekte und Infrastruktur für 2026 beantragen
Der Fachbereich Kunst und Kultur im Bezirksamt Pankow unterstützt die freie Kunst- und Kulturszene mit verschiedenen Förderinstrumenten. Zuwendungsanträge für Mittel der Projekt- und Infrastruktur-förderung im Haushaltsjahr 2026 können bis zum 15. Oktober 2025 gestellt werden.
Projektförderung mit Augenmerk auf mehr Barrierefreiheit
Im Rahmen der Projektförderung werden Vorhaben von hoher künstlerischer Qualität bezuschusst, die zur Vielfalt und Lebendigkeit des kulturellen Lebens im Bezirk beitragen. Die Möglichkeit der Förderung besteht für Vorhaben aus allen künstlerischen Sparten, die an einem Veranstaltungsort in Pankow präsentiert werden. Künstler:innen, Einzelpersonen sowie Initiativen und Vereine können pro Projekt bis zu 10.000 Euro beantragen. Darüber hinaus sind erstmals zusätzliche Ausgaben für mehr Barrierefreiheit möglich. Der Fachbereich ermutigt Künstler:innen mit Beeinträchtigungen, Neurodivergenzen und chronischen Krankheiten zum Antrag. Insgesamt stehen Fördermittel in Höhe von voraussichtlich 155.000 Euro zur Verfügung. Eine weitere Antragsfrist für das Jahr 2026 ist nicht vorgesehen.
Infrastrukturförderung setzt auf Diversitätsentwicklung, Antidiskriminierung und Barrierefreiheit
Die Infrastrukturförderung richtet sich an freie Kunst- und Kultureinrichtungen in Pankow, die keine regelmäßige Förderung erhalten. Ziel ist die Optimierung im Organisationsbetrieb sowie eine strukturelle Stärkung der Freien Szene im Bezirk. Es können Mittel für technische Neuanschaffungen beantragt werden. Auch eine Finanzierung von Qualifizierungen und Beratungen ist möglich. Maßnahmen zu Diversitätsentwicklung, Antidiskriminierung und Barrierefreiheit sind besonders förderfähig. Bauliche Maßnahmen sind ausgeschlossen. Die maximale Antragssumme beträgt 7.500 Euro pro Jahr pro Einrichtung, insgesamt stehen voraussichtlich 30.000 Euro zur Verfügung.
Ausführliche Förderkriterien, Antragsunterlagen sowie weitere Informationen zu beiden Fördermöglichkeiten finden sich auf den Webseiten des Fachbereichs Kunst und Kultur Pankow:
www.berlin.de/kunst-und-kultur-pankow/foerderung/
Am Dienstag, dem 9. September 2025, findet von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung zur Antragstellung für beide Programme statt.
Anmeldungen sind unter kulturfoerderung@ba-pankow.berlin.de möglich.
Living / 03.09.2025
Bezirksamt Pankow stärkt den Verkehrsüberwachungsdienst – mehr Verkehrssicherheit und höhere Einnahmen erwartet
Die Einrichtung von sechs zusätzlichen Stellen beim Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) des Ordnungsamtes hat das Bezirksamt Pankow jetzt beschlossen. Mit dieser Entscheidung setzt der Bezirk ein klares Zeichen für mehr Verkehrssicherheit und eine effektivere Kontrolle im ruhenden Verkehr.
Mehr Sicherheit und Beitrag zur Konsolidierung
Falsch parkende Fahrzeuge auf Geh- und Radwegen gefährden die Sicherheit aller, insbesondere von Kindern, älteren Menschen und Radfahrenden. Mit der personellen Verstärkung des VÜD können diese Verstöße künftig noch konsequenter geahndet und so die Sicherheit im Straßenraum deutlich erhöht werden. Durch die Aufstockung des Personals erwartet der Bezirk zugleich spürbare Mehreinnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung und aus Bußgeldern für ordnungswidriges Parken. Diese Mittel fließen unmittelbar in den Bezirkshaushalt und tragen damit zur Konsolidierung der Finanzen sowie zur Sicherung wichtiger Aufgaben in Pankow bei. Das Bezirksamt setzt mit der Entscheidung ein wichtiges Signal: Mehr Personal in diesem Bereich bedeutet mehr Sicherheit, mehr Ordnung und zusätzliche Einnahmen für den Bezirk.
Patient care / 02.09.2025
Staatssekretärin Haußdörfer besucht Immanuel Krankenhaus Berlin
Bei dem Besuch am Standort Buch standen die weitere Differenzierung des Leistungsangebots, die Rolle des Gesundheitscampus Buch sowie die Herausforderungen durch die generalistische Pflegeausbildung im Mittelpunkt.
Ellen Haußdörfer, Staatssekretärin für Gesundheit und Pflege in der Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege, hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2026 alle Krankenhäuser in Berlin zu besuchen, um sich ein Bild von funktionierenden Strukturen und bestehenden Herausforderungen zu machen. Am 25. August 2025 war sie aus diesem Anlass im Immanuel Krankenhaus Berlin am Standort Buch zu Gast.
Bei einem Rundgang und anschließenden Gesprächen standen die weitere Differenzierung des Leistungsangebots, die Rolle des Gesundheitscampus Buch sowie die Herausforderungen durch die generalistische Pflegeausbildung im Mittelpunkt.
Roy J. Noack (Geschäftsführer), Dr. Udo Schneider (Chefarzt für Rheumatologie, Klinische Immunologie und Osteologie) und Martin Baumann (stellvertretender Pflegedirektor) betonten, dass das Krankenhaus mit seinen drei Fachkliniken bereits seit vielen Jahren auf eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie auf die Verzahnung von stationären und ambulanten Angeboten setzt. Damit sei es gut vorbereitet, den Anforderungen der Krankenhausreform zu begegnen.
Mit fast 75 Jahren Erfahrung in der Rheumatologie an den Standorten Wannsee und Buch und einem Marktanteil von rund 70 Prozent bei stationären rheumatologischen Fällen im Land Berlin sieht sich das Immanuel Krankenhaus Berlin für die Zukunft hervorragend aufgestellt.
Gleichzeitig bestehen Herausforderungen: Zum einen erschweren fachlich nicht nachvollziehbare infrastrukturelle Vorgaben, etwa bei der Diagnostik, die Einordnung in die neuen Leistungsgruppen – trotz etablierter Kooperationspartner am Standort. Zum anderen erweisen sich die mit der „Pflegepersonalregelung 2.0“ vorgegebenen Pflegepersonaluntergrenzen teilweise als wenig praktikabel, gerade vor dem Hintergrund des generellen Personalmangels in der Pflege.
Allen Beteiligten – auch den Mitarbeitenden, die beim Rundgang spontan in den Austausch kamen – war es ein wichtiges Anliegen, den Dialog fortzusetzen und den guten Kontakt zu pflegen.
Mehr Informationen zum Standort Berlin-Buch des Immanuel Krankenhaus Berlin
Quelle: Immanuel Krankenhaus Berlin
Research / 29.08.2025
Professorship awarded to Ashley Sanders

Ashley Sanders has been awarded a full professorship from Charité –Universitätsmedizin Berlin. The tenured position will enable her and her team to expand their research on developing personalized therapies for inflammatory bowel disease and other conditions.
Dr. Ashley Sanders, Group Leader of the Genome Instability and Somatic Mosaicism lab at the Berlin Institute for Medical Systems Biology of the Max Delbrück Center (MDC-BIMSB), has been awarded a W3 professorship from Charité – Universitätsmedizin Berlin in the Faculty of Medicine. This prestigious recognition honors Sanders’contributions to the field of single-cell DNA sequencing, where she has helped redefine our understanding of genomic structure and variability.
“The professorship is a complete game-changer for me and my team,” says Sanders, who has been a junior group leader at the Max Delbrück Center since only 2021.
Through her research, Sanders has expanded the scope of single-cell genomics beyond RNA analysis to include DNA. She helped develop Strand-seq, a technique that enables scientists to detect structural variants – such as inversions, duplications, and deletions – in the DNA of individual cells. Her work has revealed that that somatic genomic mosaicism is more common than previously thought – challenging the longstanding assumption that all cells in a person’s body share an identical DNA sequence. Moreover, Sanders’ research suggests that structural variation in our cellular DNA may contribute to the development cancer, inflammatory bowel and autoimmune diseases. Such insights, she hopes, will lay the groundwork for personalized medicine.
Her professorship officially begins on September 1, 2025. “It’s a tremendous honor,” Sanders says with excitement. “We now have the stability and long-term perspective to fulfill the vision we started with.”
Text: Gunjan Sinha
Further information
The pioneer of single cell sequencing (profile of Ashley Sanders)
Genome instability and somatic mosaicism
www.mdc-berlin.deEducation / 26.08.2025
Neuer Bildungscampus der Akademie der Gesundheit in Greifswald eröffnet
Am 22. August 2025 hat die Akademie der Gesundheit e.V. einen wichtigen Meilenstein gefeiert: Mit der feierlichen Eröffnung des neuen Bildungscampus in Greifswald ist die Akademie der Gesundheit e.V. nun erstmals auch in Mecklenburg-Vorpommern vertreten. In Anwesenheit von rund 50 Gästen aus Politik, Gesundheitswesen und Bildung sowie Grußworten der Dezernentin Bereich "Soziales, Jugend und Gesundheit" beim Landkreis Vorpommern-Greifswald Karina Kaiser wurde der neue Standort an der Siemensallee offiziell eröffnet.
Gleichzeitig fand die feierliche Immatrikulation der ersten 25 Bildungsteilnehmenden, welche gebürtig aus Deutschland, Indien und der Schweiz kommen, zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann statt – ein bedeutender Moment für die Lernenden und das engagierte Team vor Ort. Unter der Leitung von Corinna Stefaniak startet der Campus mit einem erfahrenen vierköpfigen Lehrerteam und modernen, praxisnah gestalteten Räumlichkeiten. Perspektivisch bietet der Standort Platz für bis zu 120 Auszubildende und vielfältige Fort- und Weiterbildungsangebote sowie Qualifizierungsmaßnahmen.
Research, Patient care / 21.08.2025
Klaus Rajewsky honored for a lifetime of achievements

The European Federation of Immunological Societies is awarding Klaus Rajewsky of the Max Delbrück Center its first-ever Lifetime Achievement Award. The 88-year-old Rajewsky, who remains active in research, is being recognized for his pioneering work in cellular and molecular immunology.
It all started with twelve rabbit cages in Cologne – and a position as a stand-in for a scientific assistant. In 1964, at the age of 27, Klaus Rajewsky arrived at the newly established Institute for Genetics, founded by Max Delbrück, after studying medicine in Frankfurt and Munich and spending two years conducting research in Paris. His primary tasks were to produce antibodies in rabbits and to secure funding for his own studies. “I was the only immunologist there, and the others seemed to find my antibodies useful,” Professsor Rajewsky recalls.
By the time he left the University of Cologne 38 years later to join Harvard Medical School in Boston – sidestepping mandatory retirement in Germany – his department had become the institute’s largest and was internationally recognized among immunologists and molecular biologists. Since 2011, the 88-year-old Rajewsky has headed the Immunoregulation and Cancer research group at the Max Delbrück Center. His career spans more than six decades, during which he uncovered many of the genetic mechanisms that govern the immune system and contribute to disease.
The European Federation of Immunological Societies (EFIS) is now recognizing Rajewsky’s life’s work. To mark its 50th anniversary, EFIS – the umbrella organization of 26 national immunology societies across Europe – is awarding its first Lifetime Achievement Award. Rajewsky is being honored a pioneer in the field of cellular and molecular immunology.
“Groundbreaking research, transformative innovations”
“When I learned about the award, it was a very moving moment for me,” Rajewsky says. “EFIS is a large community of immunologists – and the fact that they chose me, someone who started out so small, for their first Lifetime Achievement Award is really wonderful.” He received the award on August 17, 2025, in Vienna during the Congress of the International Union of Immunological Societies.
Rajewsky was nominated by the German Society for Immunology (DGfI), which he co-founded in 1967. EFIS cited his groundbreaking research, transformative innovations, and his mentorship of generations of immunologists as reasons for the award. It highlighted his foundational work on antibody-producing B cells and the development of a gene-targeting system that for the first time allowed researchers to switch individual genes on or off in specific tissues or at specific times. “Traditional gene targeting, by contrast, would alter all cells in the organism,” Rajewsky explains. Researchers from around the world came to his lab in Cologne to learn this CRE/loxP-based method.
EFIS also praised Rajewsky for adopting and refining cutting-edge technologies such as microRNA analysis and the CRISPR/Cas9 gene-editing tool early on in immunological research. Just three years ago, his team published a modified version of CRISPR/Cas9 in the journal Science Advances that offers significantly greater precision than earlier versions – potentially making it especially well-suited for correcting genetic diseases caused by a single mutation.
Still much to do
The publication is just one among a long list of scientific papers to which Rajewsky has contributed – more than 500, by his estimate. Together with colleagues and a pathologist, he was also the first to identify that the previously mysterious Hodgkin lymphoma arises from B cells at a specific developmental stage. Rajewsky “has been a tireless promoter of collaborative science and international exchange,” EFIS said in a statement about the award. “As a mentor, he has trained and inspired generations of immunologists in Germany, across Europe, and internationally.”
His work is far from over. “Right now, we’re looking at certain inherited immunodeficiencies in which T cells don’t function properly,” he says. These cells can be genetically repaired. Rajewsky and his current ten-person team have shown in mouse models that the animals can be cured of these deadly inherited conditions. Their experiments with human cells have also been successful. “These are very rare conditions in humans, though – which makes it difficult to secure funding for clinical trials,” Rajewsky notes. But perhaps the wealth of experience he has collected over his 60-year career will help him to ultimately move this research forward.
Text: Anke Brodmerkel
Further information
www.mdc-berlin.deResearch, Patient care / 15.08.2025
Boosting vaccine efficacy as we age
Can an aging immune system be coaxed into responding to vaccination like its’ younger self? In “Nature Aging,” Sebastian Hofer, Katja Simon and colleagues discuss emerging interventions that may boost older adults’ response to vaccines. They are also recruiting volunteers for a clinical trial of their own.
As we age, our immune systems weaken. This decline – known as immunosenescence –makes older people more vulnerable to infections and less responsive to vaccines, creating a self-reinforcing vicious cycle. While lifestyle-related and age-associated diseases such as obesity and diabetes contribute to this decline, the core problem lies in how aging alters immune cells and their internal maintenance systems.
In a review article published in “Nature Aging,” Dr. Sebastian Hofer, a postdoc in the Cell Biology of Immunity lab of Professor Katja Simon at the Max Delbrück Center, and colleagues in the U.K. discuss how we may be able to boost vaccine immunity in older adults by incorporating knowledge gleaned from the latest research on the biology of aging. Traditionally, vaccine makers have relied on technological approaches, such as adding compounds to vaccines to elicit a stronger immune response – but these are not always effective.
In recent years, it has become clear that there are other approaches that potentially complement technological fixes, and may be more practical than developing novel vaccines for different age groups, says Simon. Researchers studying the biology of aging, for example, have shown that certain drugs such as metformin, used to treat type 2 diabetes, and rapamycin, commonly given to organ transplant recipients, can extend life and health span in insects, rodents and other animals. They do so in part by acting on the immune system. Other research has also shown that exercise and restricting calories in both humans and animals can slow the decline in immune cell function as we age. Such research has been complemented by a better understanding of the cellular mechanisms behind this decline in immunity, Hofer adds.
In the following interview, Hofer and Simon discuss how incorporating this knowledge into vaccination efforts might help to improve our aging body’s response to vaccines. To wit, they are recruiting volunteers for a clinical trial to test specifically whether dietary intervention might improve vaccine response.
Can you explain immunosenescence and how immunity wanes with age?
Katja Simon: Immunosenescence is a broad term for the gradual decline of the immune system as we get older. Chronic diseases are more common in older people and these contribute to a decline in immune function. But a central hallmark of immune aging that happens even in the absence of chronic disease is a decline in the ability of immune cells to clean out damage and waste, along many other molecular alterations. This particular process is called autophagy and it’s a fundamental recycling process that takes place in every cell of the body. A decline in “autophagy flux” – the efficiency of the cells’ recycling cycle – contributes to a weakened immune response in older adults. Our lab, has spent years studying autophagy and how restoring it in aging immune cells may enhance immunity.
Of all the interventions shown to extend lifespan in animals such as drugs or lifestyle changes, do we know how they work?
Sebastian Hofer: Scientists have a good idea of how interventions like caloric restriction and rapamycin may extend lifespan – at least in animals – but the picture in humans is still evolving. Many interventions tested in the field of aging biology seem to work by nudging cells into a kind of protective, energy-saving mode: they reduce inflammation, slow metabolism, and boost autophagy. Restricting calories does this naturally, while drugs like rapamycin mimic some of those effects by targeting specific cellular pathways. These changes help cells repair damage, stay resilient, and function better as we age. However, while the biology is promising, especially in lab animals, we’re still learning how well these interventions work in people – and who and which tissues might benefit the most.
Have any of these interventions been tried to improve vaccine response in older adults?
SH: While more and more researchers are applying knowledge from aging biology to the design of clinical trials, based on our review of the literature, rapamycin appears to be the only one sufficiently tested regarding its impact on vaccine response. These studies suggest that rapamycin can enhance vaccine efficacy in older adults by tuning the immune system to respond more robustly. Rapamycin works by blocking a protein called mTOR, which acts like a master switch in cells that controls growth and energy use. When mTOR is inhibited, cells shift into a more cautious, repair-focused state – reducing inflammation, improving autophagy, and making immune cells more responsive to stimuli.
You are currently recruiting volunteers for a clinical trial to test whether dietary intervention can boost immune response to vaccines. Can you provide more details?
SH: The pilot trial, named VITAL, will recruit 24 volunteers over the age of 60. Half will be asked to eat their meals within an 8-hour window, and nothing in between. We want to see if a 4-week phase with intermittent fasting can improve the immune response to influenza and COVID vaccines compared to the non-fasting group. Our trial is based on preclinical evidence showing that short-term dietary interventions can rejuvenate immune function – possibly by improving autophagy. And we are focusing on the seasonal influenza vaccine because studies have shown that a significant proportion of people over the age of 60 respond poorly to flu vaccines. People in our trial will also be outfitted with technology and administered blood tests to monitor their adherence to the fasting protocol.
Why did you choose a dietary intervention over a drug like rapamycin?
SH: Since fasting is non-pharmacological and physiological, it's an attractive strategy from both a safety and accessibility perspective. Also, this type of trial, which is almost never done in a commercial setting, is also well suited for a government funded institute like our own. Moreover, tackling the complex problems of immune system aging will also likely benefit from interventions that target multiple molecular pathways at once, such as restricting calories. But we are also studying other interventions. The Simon lab for example has shown in a clinical trial that the dietary supplement spermidine can also boost immune response to vaccines in older people. The research is currently pending publication, but our findings suggest that spermidine also may help improve COVID vaccine response in older populations.
Why is this such an important public health issue?
KS: Our populations are aging and we know that after the age of 60 to 65, people are more susceptible to infections. The 60 plus demographic group globally was the most severely affected by the COVID-19 pandemic and it is also the age group with the highest risk of death from infection with influenza. Unfortunately, data consistently show that the effectiveness of various protective vaccines decreases with age, especially in those who need protection the most. We are likely also facing a future of more frequent outbreaks of new infectious diseases. A straightforward and easily implemented intervention that improves immunity and vaccine efficacy in this group could save a lot of lives.
Sebastian Hofer, Katja Simon and their team are currently recruiting people over the age of 60 for their clinical trial to test whether intermittent fasting can boost response to influenza and COVID vaccination. For more information or to volunteer for the trial, please contact Sebastian (Sebastian.hofer@mdc-berlin.de) or the Clinical Research Unit at the ECRC (vital@charite.de).
Further information
Research, Patient care, Education / 14.08.2025
Promoting awareness of health research

During a week-long course at the Gläsernes Labor, 24 teenagers delved into genetics, immunology, and allergic disease. The course marked the beginning of a new collaboration with the Max Delbrück Center, Charité – Universitätsmedizin Berlin, the German Center for Child and Adolescent Health and others.
Dr. Aleix Arnau Soler, you’re a scientist in the Molecular Genetics of Allergic Diseases lab at the Max Delbrück Center and helped launch this project week in July 2025. How did it come about?
Dr. Aleix Arnau Soler: I took part in a science communication workshop organized by our communications department in 2024. The goal was to develop initiatives for our Life Science Learning Lab “Gläsernes Labor” that integrate new developments in research. I’m also affiliated with the German Center for Child and Adolescent Health (DZKJ), a government-funded network established in 2024 to strengthen research in pediatric and adolescent medicine. The DZKJ is working on strategies to actively involve children and families in health research.
What does that look like in practice?
For example, engaging with children directly, sparking their interest in research, and showing them how we investigate the causes of diseases. Because this work focuses on child health, the DZKJ wants to start conversations with kids and their parents early on. They were looking for partners to help put these ideas into action...
...and you were already involved with the Life Science Learning Lab on the Berlin-Buch campus.
Exactly. The Gläsernes Labor – with its experienced education team, established teaching formats, and strong ties to the campus research community – was an ideal partner. So the DZKJ teamed up with the Max Delbrück Center, Charité - Universitätsmedizin Berlin (Pediatric Clinic), the German Rheumatology Research Center (DRFZ) and the Gläsernes Labor, to design a course on genetics and immunology, including immune response and allergy treatment. These are issues that affect many people, including children and teens. The participants had the chance to explore the science in these areas in a real research setting – and hopefully came away with a deeper appreciation for the importance of health and health research.
How did you select participants for the project week?
The students came from the Robert Havemann Gymnasium in Berlin, which has an ongoing partnership with the Gläsernes Labor. One group focused on genetics, the other on immunology. They carried out hands-on experiments like DNA isolation, PCR, and electrophoresis. At the end of the week, they created posters to present their findings at school. Our lab hosted the immunology group. We showed them a diagnostic test for allergies, for example, and walked them through a key step in the DNA isolation protocol: adding alcohol to a blood sample, which causes the DNA to form a visible “cloud.” The students were highly engaged and clearly enjoyed the experience. I completely understand – back when I was in school, it would have been unthinkable to get that kind of inside look at how research is done at a scientific institute.
Will the collaboration continue?
The DZKJ is currently undergoing evaluation for its next funding period. Once that process is complete, I expect the partnership will be extended for several more years, allowing us to develop new program formats. One idea for the future: patients with conditions such as obesity, cystic fibrosis, or hearing loss who are being treated at Charité could be offered tailored courses that provide research-based insights into their conditions – why they occur and how to manage them. I think that would be a powerful way to bring science closer to people and, at the same time, give us an opportunity to learn more about what people need or expect from research.
Interview: Wiebke Peters
Further information
- 25 years of the Life Science Learning lab
- Gläsernes Labor
- Education for students and teachers
- German Center for Child and Adolescent Health
Photo: Dr. Aleix Arnau Soler and PhD student Alisa Iakupova gave students from the Robert Havemann High School an insight into allergy research in the laboratory. © Prof. Dr. Young-Ae Lee, Max Delbrück Center
Source: Max Delbrück Center
Promoting awareness of health research
Research, Patient care / 08.08.2025
Targeting sleeping tumor cells
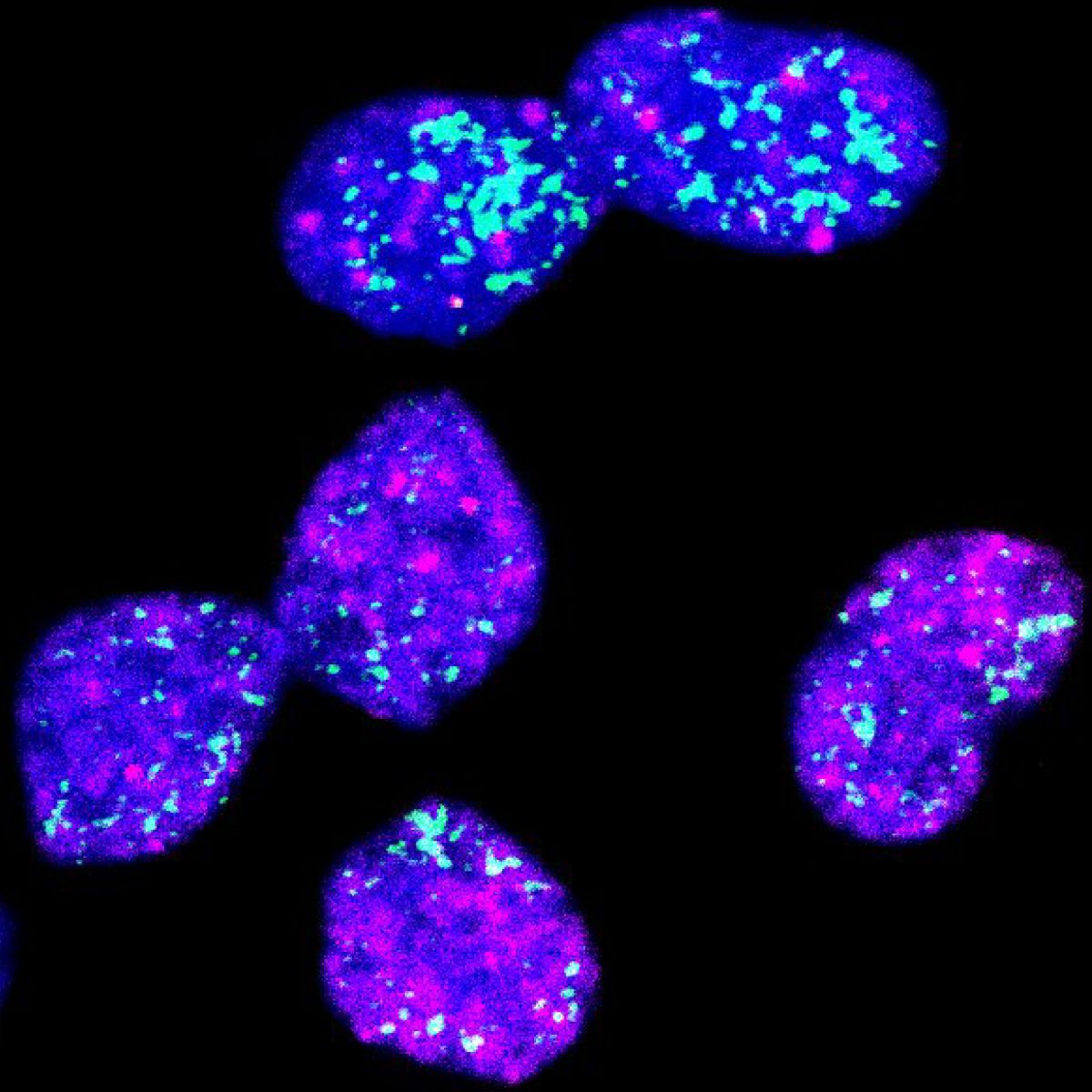
Neuroblastoma, a cancer mainly affecting children, is often difficult to treat. A team led by Jan Dörr and Anton Henssen at the Experimental and Clinical Research Center report in “Cancer Discovery,” a potential reason treatment sometimes fails and a new strategy to combat particularly resistant tumors.
Neuroblastoma can be a particularly insidious cancer. In about half of all cases, tumors regress, even without therapy. In the other half, tumors grow very quickly. These tumors often respond well to chemotherapy at first, but usually return after one to two years. A characteristic feature of such aggressive neuroblastoma cells is an abnormally high number of copies of the oncogene MYCN.
A team led by Dr. Jan Rafael Dörr and Professor Anton Henssen from the Experimental and Clinical Research Center (ECRC), a joint institution of Charité – Universitätsmedizin Berlin and the Max Delbrück Center, has now discovered that the location of the MYCN gene plays an important role in the aggressiveness of neuroblastoma: If it is located outside chromosomes, cancer cells enter a dormant state and thereby render themselves immune to therapy. In "Cancer Discovery," a journal of the American Association for Cancer Research, the research team propose a new treatment strategy that targets these dormant tumor cells. Their approach has already proven successful in a mouse model.
The study’s first authors are Dr. Giulia Montuori, a scientist at the Department of Pediatric Oncology and Hematology at Charité, where Dörr and Henssen also work as pediatric oncologists, and Fengyu Tu, who conducts research under the supervision of Dr. Benjamin Werner and Dr. Weini Huang in both London and China. Henssen, Werner and Huang are members of the international Cancer Grand Challenges team eDyNAmiC, which is funded by Cancer Research UK and the U.S. National Cancer Institute. Dr. Fabian Coscia’s Spatial Proteomics research group at the Max Delbrück Center also played a key role. The study is a prime example, say Dörr and Henssen, of how international collaboration between clinical and research teams can benefit patients.
Cancer genes on tiny DNA rings
Neuroblastoma is one of the most common cancers in children. The tumors develop from cells of the sympathetic nervous system, can occur anywhere in the body, and mostly affect children under the age of five. “Neuroblastomas with the MYCN oncogene have been particularly hard to treat,” says Dörr, Head of the ECRC research group Tumor Heterogeneity and Therapy Resistance in Pediatric Tumors. “We wanted to find out exactly what the gene does in cancer cells, how it might influence the expression of other genes and how tumors can be destroyed more effectively in the future,” he explains.
Henssen, Head of the ECRC research group Genomic Instability in Pediatric Tumors, has previously shown that these oncogenes are often not located on chromosomes in cell nuclei, but rather on many small, ring-shaped DNA molecules inside tumor cells. “When these cells divide, this DNA is distributed randomly to daughter cells – unlike chromosomal DNA,” Henssen explains. As a result, neuroblastomas can contain a mix of cells, some with high numbers of MYCN genes and others with very few.
The sleeping cells escape treatment
Dörr and his team investigated the tumor cells further. “Together with Fabian Coscia's group, we succeeded in separating cells with many MYCN copies from those with few copies, thanks to a method described for the first time in the study, and then investigating how the composition of the proteins and the phenotype of these cells differ from one another,” Dörr explains.
In experiments with cultured tumor cells, mouse models and patient samples, the researchers were then able to show that only aggressive cells with many MYCN copies are destroyed by chemotherapy. “Tumor cells with few MYCN copies, on the other hand, survive and merely enter into a kind of deep sleep,” explains Dörr. However, they can awaken from this deep sleep through wake-up calls that are not yet fully understood, and then contribute to the cancer recurring.
A new strategy for brain tumors, too
“There are drugs that specifically target senescent, or sleeping, cells,” says Dörr. In mouse models, he and his team demonstrated that combining chemotherapy – which eliminates fast-growing cells with many MYCN copies – with a second drug that targets senescent cells can significantly improve treatment outcomes for neuroblastoma. “Our approach is likely suitable only for tumors in which the MYCN gene or other oncogenes are located on extrachromosomal DNA,” says Dörr. For tumors with chromosomal oncogenes, different strategies will be needed.
Next, the team plans to systematically search for additional compounds that can selectively attack dormant tumor cells in human tissue while sparing healthy cells. “This approach could also be relevant for other cancers that involve genes located on extra-chromosomal ring-shaped DNA,” Henssen adds – including dreaded brain tumors.
Text: Anke Brodmerkel
Source: Joint press release by the Max Delbrück Center and Charité – Universitätsmedizin Berlin
Targeting sleeping tumor cells
Research / 07.08.2025
Wie Immunzellen kommunizieren
Mit einer neuen Technologie können Forschende die Kommunikation der Immunzellen entschlüsseln – und ablesen, wie unser Körper auf Infektionen reagiert, Fehlfunktionen zu Autoimmunleiden führen und warum Immuntherapien nur manchen Menschen helfen. Das berichtet ein Team um Simon Haas in „Nature Methods“.
Ein gesundes Immunsystem ist darauf trainiert, Infektionen und Krebszellen zu erkennen und zu zerstören. Diese Abwehr beruht auf einem komplexen Kommunikationssystem auf zellulärer Ebene, in dem verschiedene Immunzellen jeweils eine spezialisierte Aufgabe erfüllen: Infektionserreger erkennen, andere Immunzellen darauf aufmerksam machen und schädliche Zellen oder Erreger beseitigen. Problematisch wird es, wenn die Kommunikation zwischen verschiedenen Zelltypen gestört ist. Dann kann es zu einer Vielzahl von Krankheiten kommen.
In „Nature Methods“ stellt nun ein interdisziplinäres Team aus Wissenschaftler*innen des Berlin Institute of Health in der Charité (BIH), des Max Delbrück Center, des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), des Heidelberg Institute for Stem Cell Technology and Experimental Medicine (HI-STEM) und der Queen Mary University in London, UK, eine neue Technologie vor, die diese Kommunikation belauschen kann.
Vorhersagen, wer von einer Immuntherapie profitiert
Krebszellen zum Beispiel entwickeln häufig Strategien, um den Informationsaustausch im Immunsystem gezielt zu stören oder zu umgehen – auf diese Weise können sie der Immunüberwachung entgehen und ungehindert wachsen. „Moderne Immuntherapien haben die Behandlung bestimmter Krebsarten grundlegend verändert, indem sie die Kommunikation zwischen Immunzellen wiederherstellen oder gezielt verstärken“, erklärt Professor Simon Haas, ein Letztautor der Studie.
Haas leitet eine Arbeitsgruppe im gemeinsamen Forschungsfokus „Single-Cell-Ansätze für die personalisierte Medizin“ des Berlin Institute of Health in der Charité (BIH), des Max Delbrück Center und der Charité – Universitätsmedizin Berlin und ist außerdem Chair für Einzelzelltechnologien und Präzisionsmedizin am Precision Healthcare University Research Institute (PHURI) der Queen Mary University London. Sein Labor ist am Berliner Institut für Medizinische Systembiologie des Max Delbrück Center (MDC-BIMSB) angesiedelt.
Dr. Daniel Hübschmann, ebenfalls Letztautor und Gruppenleiter am Heidelberg Institute for Stem Cell Technology and Experimental Medicine (HI-STEM) ergänzt: „Allerdings sprechen nicht alle Patient*innen gleichermaßen gut auf diese Therapien an. Bislang fehlen verlässliche Methoden, um vorherzusagen, welche Patient*innen besonders davon profitieren werden.“
Eine Basis für maßgeschneiderte Krebstherapien
In Kooperation haben die Wissenschaftler*innen eine Technologie entwickelt, die dank eines besseren Verständnisses von Immunzell-Kommunikation viele dieser Hürden überwindet. Mit dieser Methode kann man Millionen von Zell-Zell-Interaktionen schnell und kostengünstig messen, sowohl in Forschungslaboren als auch in der Klinik.
Ermöglicht wurde die innovative Entwicklung durch eine enge interdisziplinäre Kooperation über die klassischen Grenzen von Medizin, Informatik und Biowissenschaften hinweg – maßgeblich getragen von den Doktorand*innen und Erstautor*innen Dominik Vonficht, Lea Jopp-Saile, Schayan Yousefian und Viktoria Flore. Die Wissenschaftler*innen nutzten die neu-entwickelte Technologie, um das Verhalten und die Kinetik von Immuntherapien zu untersuchen und Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie diese Therapien auf der Ebene der Zell-Zell-Interaktionen wirken. Dabei konnten sie zeigen, dass der Ansatz auch die Vorhersage individueller Therapieansprechen ermöglicht und somit eine zentrale Grundlage für personalisierte Immuntherapien und gezielte Therapieentscheidungen schaffen kann.
Darüber hinaus konnten Wissenschaftler*innen mithilfe ihrer neuen Technologie hochaufgelöst darstellen, wie Zellen des Immunsystems bei Virusinfektionen und Autoimmunerkrankungen miteinander interagieren. Auf dieser Grundlage entwickelten sie dynamische Karten der Immunzellnetzwerke. Sie veranschaulichen erstmals, wie die Immunabwehr in verschiedenen Geweben koordiniert wird.
Gemeinsam mit klinischen Partnern arbeitet das Team nun daran, diese Erkenntnisse aus der translationalen Forschung in die Praxis zu bringen, etwa um Behandlungserfolge besser vorherzusagen und personalisierte Therapien gezielter einzusetzen.
Weiterführende Informationen
AG Haas
Forschungsfokus „Single-Cell-Ansätze für die personalisierte Medizin“
Wenn der Blutkrebs erstmals streut
Literatur
Dominik Vonficht, Lea Jopp-Saile, Schayan Yousefian, Viktoria Flore et al. (2025): Ultra-high-scale cytometry-based cellular interaction mapping. Nature Methods, DOI: 10.1038/s41592-025-02744-w
www.mdc-berlin.de
02.08.2025
REINSCHAUEN: RBB HEIMATJOURAL ÜBER BERLIN-BUCH
Das rbb Heimatjournal hat das Gläserne Labor besucht und dabei Schülerinnen und Schüler des Robert-Havemann-Gymnasiums bei Projektwochen zu Seltenen Erkrankungen und Immunologie begleitet. Sendetermin ist der 2. August ab 19:00 Uhr auf dem rbb.Reinschauen und Neues aus Berlin-Buch entdecken.
Die Projektwochen im Gläsernen Labor wurden vom Deutschen Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit (DZKJ) gefördert. In der Kindheit und Jugend werden grundlegende Weichen für ein gesundes Leben gestellt, weshalb Prävention, Diagnose und Therapie von Erkrankungen in diesen Entwicklungsphasen eine entscheidende Rolle spielen. Das Deutsche Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit (DZKJ) fördert die interdisziplinäre Erforschung von Ursachen häufiger und seltener Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter sowie die Entwicklung innovativer Therapien und Präventionsstrategien. Es sorgt dafür, die Öffentlichkeit für das Thema Kinder- und Jugendgesundheit zu sensibilisieren und Forschungsergebnisse schneller in die Praxis zu transferieren.
Aufklärung und Prävention als wichtige Säule
Das DZKJ fördert das öffentliche Wissen über Erkrankungen und deren Prävention: Wer Erkrankungen und mögliche Ursachen kennt, kann besser auf seine Gesundheit achten. Das Gläserne Labor auf dem Campus Berlin-Buch bot daher seit Mai 2025 in Kooperation mit dem DZKJ Arbeitsgemeinschaften und Projektwochen für Schüler:innen an, die verschiedene Erkrankungen thematisieren. Dabei wurde ein Bezug zu vier Forschungsschwerpunkten des DZKJ hergestellt: Adipositas und Metabolismus, Entwicklung des Zentralen Nervensystems und neurologische Erkrankungen, seltene genetische Erkrankungen sowie die Erforschung der Immunantwort und Behandlung von Allergien.
www.glaesernes-labor.deInnovation / 29.07.2025
Eckert & Ziegler Selected as US Manufacturer for Archeus’ Next-Generation Radiopharmaceutical ART-101
Eckert & Ziegler (ISIN DE0005659700) has entered a Master Service Agreement with Archeus Technologies (Archeus), a company developing multiple differentiated radiopharmaceutical therapies, for contract manufacturing of its novel investigational compound ART-101. The agreement supports Archeus’ upcoming Phase 1 clinical trial of ART-101 in the United States, with manufacturing to be performed at Eckert & Ziegler’s state-of-the-art GMP facility in Boston, MA.
ART-101 is a next-generation small molecule that targets prostate-specific membrane antigen (PSMA) and is in development for the imaging and treatment of prostate cancer. Preclinical studies suggest ART-101 may offer enhanced pharmacology and tolerability compared to existing PSMA-targeted therapies.
“We are pleased to partner with Archeus on the clinical development of ART-101,” commented Dr. Harald Hasselmann, Chief Executive Officer of Eckert & Ziegler SE. “Our GMP-certified Boston facility is ideally equipped to support their early-phase development needs. This collaboration reflects our broader commitment to advancing next-generation targeted radiotherapies through high-quality manufacturing and clinical supply services.”
“Eckert & Ziegler’s GMP infrastructure, operational reliability, and radiopharmaceutical manufacturing expertise enable Archeus to quickly and confidently advance ART-101 into first-in-human trials this year,” added Evan Sengbusch, Ph.D., Chief Executive Officer of Archeus Technologies.
The collaboration is an important milestone in the ongoing efforts of both companies to advance the development of innovative solutions in the radiopharmaceutical field. Eckert & Ziegler operates several CMO sites worldwide and offers a range of other services along the entire value chain including the supply of high-quality radioisotopes.
About Eckert & Ziegler
Eckert & Ziegler SE, with more than 1,000 employees, is a leading specialist in isotope-related components for nuclear medicine and radiation therapy. The company offers a broad range of services and products for the radiopharmaceutical industry, from early development work to contract manufacturing and distribution. Eckert & Ziegler shares (ISIN DE0005659700) are listed in the TecDAX index of Deutsche Börse.
Source: Press Release Eckert & Ziegler
Eckert & Ziegler Selected as US Manufacturer for Archeus’ Next-Generation Radiopharmaceutical ART-101
Innovation / 28.07.2025
Eckert & Ziegler: Capital Increase Entered in the Commercial Register. Share Split in Preparation.
The Annual General Meeting of Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700) resolved on June 18, 2025, to increase the share capital using company funds by € 42,343,864 to € 63,515,796.
The capital increase was entered in the commercial register on 25 July 2025 and thus became effective. As a result, the company's share capital increased from € 21,171,932 to € 63,515,796.
The company will report on the exact details of the share split once the technical details have been finalized with the banks.
The share split aims in particular to increase the liquidity of the share and thus facilitate the tradability of Eckert & Ziegler shares.
About Eckert & Ziegler.
Eckert & Ziegler SE with more than 1.000 employees, is a leading specialist for isotope-related components in nuclear medicine and radiation therapy. The company offers a broad range of services and products for the radiopharmaceutical industry, from early development work to contract manufacturing and distribution. Eckert & Ziegler shares (ISIN DE0005659700) are listed in the TecDAX index of Deutsche Börse.
Source: Press Release Eckert & Ziegler
Eckert & Ziegler: Capital Increase Entered in the Commercial Register. Share Split in Preparation
Research, Patient care / 25.07.2025
Gezieltere Hilfe bei Erdnussallergie
Eine orale Immuntherapie hilft vielen Kindern mit einer Erdnussallergie. Bei manchen führt sie allerdings auch zu schweren allergischen Reaktionen. Im Fachblatt „Allergy“ erläutert ein Team um Young-Ae Lee, welche Gründe das haben kann – und wie sich die Behandlung individueller gestalten lässt.
Eine Erdnussallergie gehört zu den häufigsten und gefährlichsten Allergien gegen Nahrungsmittel. Zuweilen reichen schon geringste Mengen der eiweißreichen Hülsenfrüchte aus, um allergische Reaktionen wie Juckreiz und Schwellungen oder sogar eine lebensbedrohliche Anaphylaxie auszulösen. Lange Zeit gab es dagegen nur eine Maßnahme: Es galt, Erdnüsse so akribisch wie möglich zu meiden. Da viele Lebensmittel Spuren von ihnen enthalten können, war – und ist – das eine schwierige Aufgabe, auch für die Eltern der betroffenen Kinder. Notfallmedikamente müssen stets in Reichweite sein.
Seit Kurzem gibt es für Kinder mit einer Erdnussallergie die Möglichkeit einer oralen Desensibilisierung. „Einige Kinder, die eine solche Therapie erhalten, sprechen auf die Behandlung allerdings kaum oder gar nicht an“, sagt Professorin Young-Ae Lee, die Leiterin der Arbeitsgruppe „Molekulare Genetik allergischer Erkrankungen“ am Max Delbrück Center. „Bei einigen führt das Präparat, das steigende Dosierungen der Erdnussallergene enthält, auch zu anaphylaktischen Reaktionen.“
Warum Kinder auf die Therapie so unterschiedlich ansprechen und wie sich diese künftig womöglich sicherer und effektiver gestalten lässt, beschreibt ein Team um Lee und Professorin Kirsten Beyer, die Leiterin der Sektion Kinderallergologisches Studienzentrum der Charité – Universitätsmedizin Berlin, jetzt in der Fachzeitschrift „Allergy“. Erstautor der Publikation ist Dr. Aleix Arnau-Soler aus Lees Gruppe. „Wir haben in unserer Studie nach molekularen Veränderungen im Immunsystem von Kindern gesucht, die eine orale Immuntherapie bekamen – und sie auch gefunden“, erklärt Arnau-Soler.
Immunzellen des Darms spielen eine Schlüsselrolle
Für ihre Studie untersuchten die Forschenden das Blut und die darin enthaltenen Immunzellen von 38 Kindern. Die Proband*innen waren im Mittel sieben Jahre alt und erhielten an der Charité aufgrund einer Erdnussallergie eine orale Desensibilisierung. Arnau-Soler und seine Kolleg*innen bestimmten vor und nach der Therapie unter anderem die Blutkonzentrationen von Allergie-Antikörpern, den Immunglobulinen, und von Entzündungsbotenstoffen, den Zytokinen.
Zudem untersuchten die Wissenschaftler*innen, welche Mengen der Erdnussproteine das Immunsystem der Kinder vor und nach der Behandlung jeweils tolerierte – inwieweit die Desensibilisierung also erfolgreich gewesen war. Darüber hinaus nutzten die Forschenden moderne Omics-Technologien, um zu verstehen, welche Gene in den kindlichen Immunzellen bei gutem Therapieansprechen aktiv werden, wenn die Zellen im Labor mit Erdnussproteinen in Kontakt kommen.
„Kinder, die gut auf die Behandlung ansprachen, schienen schon vor Beginn der Therapie ein weniger reaktives Immunsystem zu haben. In ihrem Blut fanden wir niedrigere Immunglobulin- und Zytokin-Werte“, berichtet Arnau-Soler. Diese Ergebnisse könnten dem Forscher zufolge dabei helfen, bereits im Vorfeld der Desensibilisierung herauszufinden, welche Kinder von ihr besonders profitieren und welche ein höheres Risiko für Nebenwirkungen haben.
Darüber hinaus konnten die Forschenden zwischen den Immunzellen von Kindern, die eher gut oder eher schlecht auf die Behandlung ansprachen, gemeinsame Unterschiede in der Genexpression und dem DNA-Methylierungsmuster ausmachen. Letzteres ist an der Regulation der Genaktivität entscheidend beteiligt. „Die Unterschiede spielen vor allem bei bestimmten Immunzellen eine wichtige Rolle, die im Blut eher selten, umso häufiger aber im Darm zu finden sind und dort wichtige Aufgaben übernehmen“, sagt Arnau-Soler. Es handelte sich dabei sowohl um spezielle T-Zellen, die zum erworbenen Immunsystem gehören, als auch um Immunzellen, die Teil der angeborenen Körperabwehr sind.
Neue Biomarker ermöglichen eine personalisierte Therapie
„Unsere Ergebnisse öffnen die Tür für personalisierte Ansätze, um eine Erdnussallergie – an der in den Industriestaaten immerhin drei Prozent aller Kinder leiden – künftig effektiver und zugleich sicherer zu behandeln“, sagt Lee. „Wir haben jetzt potenzielle Biomarker, um schon vor Beginn der Therapie herauszufinden, wie gut ein Kind auf diese anspricht und welche Risiken mit ihr in dem jeweiligen Fall verbunden sind.“ Denkbar sei auch, die Länge der Behandlung und die jeweils verabreichten Mengen der Erdnussallergene in Zukunft an das individuelle Immunprofil der Patient*innen anzupassen.
Derzeit bemühen sich die Forschenden darum, ihre Ergebnisse in einer weiteren Studie zu bestätigen. Auch die im Blut gefundenen Immunzellen des Darms möchten sie nun weiter untersuchen. „Zeitgleich arbeiten wir an einem Prognosemodell, um künftig mit einem einfachen Bluttest die orale Desensibilisierung besser auf das einzelne Kind abzustimmen“, ergänzt Arnau-Soler. Das würde der Erdnussallergie viel von ihrem Schrecken nehmen.
Text: Anke Brodmerkel
Weitere Informationen
- Kinderallergologisches Studienzentrum der Charité
- AG Lee
- Molekulare Genetik allergischer Erkrankungen
Literatur
Aleix Arnau-Soler, et al. (2025): „Understanding the Variability of Peanut-Oral Immunotherapy Responses by Multi-Omics Profiling of Immune Cells“. Allergy, https://doi.org/10.1111/all.16627
www.mdc-berlin.de
Research, Patient care / 18.07.2025
Summer Science Day 2025: Uniting under one goal

Lab tours, lively talks, music and awards – Summer Science Day 2025 brought the Max Delbrück Center community together like never before. In addition to food and games, this year's new format created space to spark dialogue across our diverse teams.
On July 3, the Max Delbrück Center celebrated Summer Science Day 2025 – transforming the campus into a vibrant hub of scientific exploration and community engagement. This year, in addition to a festive program of food, music and games, the event featured lab tours, presentations, workshops and information booths to foster exchange among our diverse staff. People who work in administration had the opportunity to learn about how research is done at our center, and vice-versa. The program was specifically designed to support goals set out in our new Strategy 2030.
“Summer Science Day is about uniting our institute under a shared vision,” said Professor Maike Sander, Scientific Director of the Max Delbrück Center in her opening talk. “We aim to advance predictive systems medicine and everyone plays a vital role in making that happen.”
“We have already grown together,” added Kirstin Bodensiek, Acting Administrative Director of the Max Delbrück Center. “With this new event format, we are continuing to build bridges to foster greater exchange from the bottom up. That’s not only who we are, but also who we want to be.”
Talks, workshops, games
On a pleasantly warm summer day, the Max Delbrück Center staff could choose from over 50 different activities that included: gathering information at booths about what the different departments do, join games such as Immune Cell Bingo and a Pub Quiz, or simply linger over lunch at picnic tables set out on the large lawn at Campus Buch.
At one workshop, for example, participants used precision lasers, normally used to extract single cells from tissues, to inscribe their names onto individual rice grains. And during a lab tour of the Advanced Light Microscopy Platform, visitors gained insight into imaging technologies that researchers use to visualize cellular structures and processes.
Head of Technical Facility Management Ralph Streckwall gave a tour of our new demonstrator lab, where interdisciplinary research teams will come together to translate our discoveries into innovative therapies – the lab is scheduled to be begin operations in September. And Sustainability Officer Christian Panetzky gave a talk about steps Max Delbrück labs are taking to reduce their environmental impact. And as part additional sustainability efforts, staff were invited to contribute to building a new raised garden bed using repurposed old microscope cases as a frame.
Honoring our own
Capping the event were two different awards honoring employees who have shown outstanding effort this year. This first recognized people who work behind the scenes on various projects, but who remain in the background. These “Silent Heroes” are often the backbone of campus operations and deserve recognition, said Dr. Jean-Yves Tano from Friends of the Max Delbrück Center, which sponsored the award that comes with a small cash prize.
The first place “Silent Hero” award went to Dr. Timkehet Teffera Mekonnen from our events team. “She is the kind of person who shows up every day not to be seen, but to really make a difference. She does it quietly, steadily, with warmth and fun,” said Science Manager Anne Merks, who honored Mekonnen by reading aloud comments from people who supported her nomination. “Timi is that the rock that every team needs, the epitome of above and beyond. Whatever life and circumstance might throw at her, she just takes it and deals with it, calm, collected and with a smile,” wrote another person.
Jana Richter, Technical Assistant in the lab of Professor Philipp Junker, took second place for always being available to her team to get a job done. “She often says that for her little sheep, she will do anything. And everyone who works with her says that this is true,” said Johanna Berenike Kroll, a PhD student in the Junker lab who nominated Richter. Michaela Herzig, who will be leaving the Max Delbrück Center this year, won 3rd place for her 15 years of service in building the graduate program. “She has been very instrumental in many different projects,” said Tano. “We are really happy to have had her here.”
This year also featured a “Marvelous Mentor” award. “This award shines a light on something we all know makes a huge difference in science – but is often not recognized enough: great mentorship,” said Dr. Grietje Krabbe from our Strategy Department. The award recognizes people committed to supporting junior staff by offering genuine care, an inclusive environment and encouraging strategic action, she added. Other criteria include adapting mentoring style to individual needs and leading by example. Of the nine nominees, the jury chose Dr. Daria Bunina, Group Leader of the Systems Biology of Cardiovascular Diseases lab, as winner of the award. Bunina and all nominees received certificates, because all of them are equally great, Krabbe said.
“The first Summer Science Day at the Max Delbrück Center, far exceeded our expectations,” Bodensiek said. “The program was diverse, inspiring, and rich with creativity. Most of all, the lively exchange of ideas and experiences throughout the day was a powerful reminder of the strength and vibrancy of our community.”
Text: Gunjan Sinha
Further information
www.mdc-berlin.de
Research / 17.07.2025
Gewinnerteams des Campus von „Wer radelt am meisten?“ ausgezeichnet
Im Wettbewerb 2025 hat der Campus Berlin-Buch den vierten Platz belegt. Am 16. Juli wurden unsere besten Teams campusintern ausgezeichnet
Der diesjährige Wettbewerb „Wer radelt am meisten?“ ist entschieden. Die Einrichtungen des Campus Berlin-Buch/MDC Mitte haben in der Unternehmenswertung aller 23 teilnehmenden Unternehmen den 4. Platz belegt. Sieger sind in diesem Jahr die Berliner Wasserbetriebe vor der Berliner Energieagentur und der BVG.
Unsere 182 Radlerinnen und Radler des Wissenschafts- und Biotechcampus/MDC-Mitte radelten vom 1. Mai bis 30. Juni gemeinsam 117.693,4 Kilometer. Vom Campus Berlin-Buch kommt auch der drittbeste Einzelfahrer in der Gesamtwertung aller Unternehmen: Kai von Krbek von der Campus Berlin-Buch GmbH fuhr im Wettbewerbszeitraum 4.798,1 km mit dem Fahrrad. Eine tolle Leistung! Insgesamt wetteiferten bei uns sieben Kleinteams, elf mittlere Teams und zwei Megateams.
Von Berlin bis Istanbul, über Chicago hinaus und bis Rio de Janeiro
Am 16. Juli wurden die besten unserer 20 Campus-Teams in drei Kategorien ausgezeichnet. Das Zweierteam „8:50“ vom Max Delbrück Center fuhr zusammen über 1.700 km – was etwa der Luftlinie zwischen Berlin und Istanbul entspricht. Die EPO-Raketen der EPO Berlin-Buch GmbH radelten zu viert und wären theoretisch weiter als bis Chicago – aber nicht ganz bis nach Denver gekommen. Die FyoniBioneers der FyoniBio GmbH waren zu zwölft und legten umgerechnet etwa eine Strecke bis Rio de Janeiro zurück.
Kleinteam (bis 3 TN)
8:50
1.751,7 km / 875,9 km
Juan, Anna-Lena, Max Delbrück Center
Mittlere Teams (4-10 TN)
EPO-Raketen
7.867,2 km / 1.966,8 km
Maria, Ole, Nils, Diana, EPO Berlin GmbH
Megateams (ab 11 TN)
FyoniBioneers
9.395,3 km / 782,9 km
Robert, Renée, Patrick, Anke, Monique, Sven-Clemens, Mandy, Lars, Joanna, Beate, Abdullah, Andrea; FyoniBio GmbH
Wir danken allen, die beim Wettbewerb mitgeradelt sind, für ihren Enthusiasmus, ihr Dranbleiben und ihre Extrarunden!
Bis zum nächsten Jahr – denn es geht um den mehrwert-Pokal!
Euer Team von CampusVital
Quelle: CampusVital
CampusVital
Research / 16.07.2025
Our inventors meet Berlin’s venture capitalists

The first VC Day at the Max Delbrück Center brought together our budding entrepreneurs with the CLIC incubator and top venture capital working in Berlin biotechnology for a day of pitching, exchange and networking.
Next-generation CAR T-cell therapies engineered to disrupt tumor microenvironments; deep phenotyping of neurodegenerative diseases to develop new drugs – these were among the spinoff projects pitched by our scientists last week during VC Day.
Twelve inventors supported by the Innovation and Entrepreneurship team were invited to present their projects in 5-minute pitches to a room of representatives from venture capital (VC) firms and BIH’s new Clinical Incubator (CLIC). The presentations, covering innovations in data science and diagnostics to therapeutics and engineering, were each followed by ten minutes of targeted feedback from the experts. Six VCs participated, including Apollo Health Ventures – a transatlantic early-stage biotech – and bmp Ventures – an early-stage German life sciences VC– in partnership with global shared lab facilities network BioLabs.
Early venture capital exposure
VCs are firms that invest in high-potential start-ups in exchange for equity, aiming for a financial return on their investment. Pitching to VCs generally occurs later in the development process, once a start-up has formed and is seeking seed funding.
Unconventionally, VC Day at the Max Delbrück Center gave inventors the unique opportunity to pitch at any stage of development – from early translational research to more advanced spinoff projects. This idea emerged through conversations that Dr. Nevine Shalaby, head of the Max Delbrück Center’s Innovation and Entrepreneurship department, had with VCs in her network. “They told me, ‘Actually we love to listen to projects early in development because that’s when we can give useful feedback to help shape the project from a business perspective,” Shalaby recalls.
As with any skill, practice improves performance. “We wanted to give our scientists the opportunity to pitch, receive expert feedback, improve, and repeat,” Shalaby adds. Feedback at such an early stage, “encourages scientists to think about how they can develop their translational project with a commercial mindset.” Advice was tailored to each project. VC representatives offered insight on timelines, target markets, and business models – key elements of a solid commercial strategy.
Dr. Klaas Yperman, one of the department’s innovation managers, also participated in the event as the business lead of a neuropathic pain therapy spinoff. Involvement of funders from a project’s earliest stages helps to build trust and long-term relationships that can lead to future investment, he says. “VCs often want to see a project develop over time through multiple interactions before they commit to investing.”
Informal setting
The participating inventors and VCs benefited from the small group format. Each pitch received feedback from multiple perspectives, and informal networking during breaks allowed for deeper conversations. “Having a small internal event allowed us to engage directly with the VCs,” says Yperman, “This wouldn’t have been possible in a large, 100-person setting.”
The benefits of the network created between Max Delbrück Center’s inventors and industry partners extended beyond those present in the room. “Even if your project didn’t fit a particular VC’s portfolio, they might say, ‘I know someone at another firm who could be interested – I’ll introduce you,’” explains Yperman. By showcasing some of the up-and-coming innovation talent from the Max Delbrück Center, the event also helped put the center on the map for Berlin’s biotech funders.
Training Berlin’s next biotech entrepreneurs
“The VCs that I spoke to were very impressed with the quality of the scientists’ pitches,” says Shalaby. Several pitches sparked follow-up discussions.
It’s an exciting time for innovation and translation, she adds. Upcoming activities include a workshop funded by H3 Health to train spinoff founders on how to navigate the regulatory path from lab to market. Meanwhile, preparations are underway for the opening of a knowledge hub that will serve as an incubator to support spin-off projects, not only by providing laboratory space, but also entrepreneurship training, networking and venture-building opportunities at Max Delbrück Center’s Campus Buch later this year.
Text: Anita Waltho
Innovation / 16.07.2025
Eckert & Ziegler: Outstanding Training Quality Once Again Awarded
Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700) has been recognized by the Berlin Chamber of Industry and Commerce (IHK) for the exceptional quality of its training program for the fourth time in a row. The Berlin-based healthcare company already held the award for “Excellent Training Quality” from 2019 to 2020, from 2021 to 2023 and from 2023 to 2025. In addition to successfully fulfilling all mandatory criteria, Eckert & Ziegler also scored highly in the voluntary and excellence criteria thanks to its long-standing commitment to training.
“Our trainees have the opportunity to gain valuable practical experience in a future-oriented growth area and take on varied tasks that allow them to be creative, contribute their own ideas, and take on responsibility," explains Dr. Harald Hasselmann, CEO of Eckert & Ziegler SE. “With a retention rate of around 70%, we also offer young talent real career prospects after completing their training. After all, well-trained specialists are essential for the success of a company.”
The Chamber of Industry and Commerce evaluated the training program at Eckert & Ziegler based on more than 30 including mandatory and excellence criteria. Among others, the framework conditions for trainees and training supervisors as well as the implementation and supervision of the individual training programs were evaluated. Particularly convincing were the individual work schedules of the trainees, which were adapted to the training plans, as well as the measures for team building and maintaining the trainee team across the various training professions. Eckert & Ziegler also scored highly for involving trainees in independent projects at an early stage, thereby enhancing their social skills.
Eckert & Ziegler trains industrial clerks, chemical laboratory assistants, IT specialists for system integration, and mechatronics engineers. There are still places available for the training program starting on September 1, 2026. We look forward to receiving your applications.
About Eckert & Ziegler.
Eckert & Ziegler SE with more than 1.000 employees, is a leading specialist for isotope-related components in nuclear medicine and radiation therapy. The company offers a broad range of services and products for the radiopharmaceutical industry, from early development work to contract manufacturing and distribution. Eckert & Ziegler shares (ISIN DE0005659700) are listed in the TecDAX index of Deutsche Börse.
Source: Press Release Eckert & Ziegler
Eckert & Ziegler: Outstanding Training Quality Once Again Awarded
Innovation / 15.07.2025
Biosynth Expands Berlin Site with a New Commercial Bioconjugation Suite

The new suite extends GMP bioconjugate production for intermediates and active pharmaceutical ingredients from early clinical phase through to late clinical phases and commercial supply.
Biosynth, a leading developer and supplier of critical raw materials and services for life sciences and diagnostics, is pleased to announce the opening of its expanded GMP bioconjugation facility at its existing Berlin site. This strategic expansion significantly enhances Biosynth's specialized manufacturing capabilities in conjugate vaccines and conjugate drugs, activated PEGs, and polymer-based drug delivery excipients as part of its global manufacturing network.
Thomas Eisele, Chief Operations Officer, stated, "We are thrilled to officially open the new expansion to our bioconjugation facility in Berlin, which represents a significant enhancement to our existing operations. This suite enables the scalable, diverse high-quality conjugation services that our customers need to advance to the next generation of therapies.”
Frank Leenders, General Manager for the Berlin site, commented, "The construction of our new facility, including class D and C cleanrooms, represents a natural evolution of our Berlin operation, in many ways we are growing alongside our customers. The additional refurbishment of our existing facility enhances our GMP manufacturing capabilities, reinforcing our commitment to meeting the evolving needs of our customers."
"Conjugation chemistry, advanced polymers and bioconjugation production are critical areas for many of our life science customers,” added Marie Leblanc, Executive Vice President, Life Sciences. “Being able to support projects fully from initial bioconjugate process development to commercial GMP supply enables us to provide specialized conjugation solutions for diagnostics and therapeutics, strengthening our position as a trusted partner in the Life Science industry.”
About Biosynth
Biosynth is a leading supplier of critical raw materials and services for the life sciences industry. With a deep commitment to quality, Biosynth serves pharmaceutical, diagnostics and life sciences research customers through its global network of R&D and production sites. Headquartered in Switzerland, Biosynth partners with customers worldwide to accelerate innovation and ensure reliability at every stage of development and manufacturing. For more information, please visit www.biosynth.com.
Photo: (v.l.) Prof. Dr. Gianfranco Pasut, Universität Padua, Italien; Dr. Sebastian Kopitzki, Production Supervisor, Biosynth GmbH, Berlin; Dr. Severin Fischer, Staatssekretär, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Berlin; Dr. Frank Leenders, General Manager, Biosynth GmbH, Berlin; Dr. Marie Leblanc, Executive Vice President of Life Sciences, Biosynth; Matt Gunnison, Chief Executive Officer, Biosynth (Photo: Pierre Adenis/Biosynth)
Research, Innovation, Patient care / 11.07.2025
Beispielhafte Zusammenarbeit im NCT Berlin
Captain T Cell, eine Ausgründung aus dem Max Delbrück Center, kann ab 2027 seine TCR-T-Zelltherapie erstmals in einer klinischen Studie prüfen. Möglich wird das durch eine Förderung des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen und die enge Zusammenarbeit mit der Charité – Universitätsmedizin Berlin.
Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT), eine langfristig angelegte Kooperation zwischen dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), Partnern in der Universitätsmedizin und weiteren Forschungspartnern, fördert einen vielversprechenden Therapieansatz für Patient*innen mit fortgeschrittenen soliden Tumoren: Die von Captain T Cell entwickelte TCR-T-Zelltherapie wird ab 2027 in einer multizentrischen Studie erstmals klinisch geprüft. Studienleiterin ist Dr. Antonia Busse, Oberärztin an der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie der Charité am Campus Benjamin Franklin. Die Charité ist Sponsor der Studie und verantwortet diese rechtlich.
Fortgeschrittene, schwer behandelbare Tumorerkrankungen gehören weltweit zu den häufigsten Todesursachen – direkt nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Während CAR-T-Zelltherapien bei Blut- und Lymphdrüsenkrebs bereits große Erfolge erzielen, sind vergleichbare Immuntherapien bei soliden Tumoren – etwa in der Lunge, der Blase, im Weichgewebe oder im Kopf-Hals-Bereich – bislang deutlich weniger wirksam.
Die ToMA4TA1-Studie wird die TCR-T-Zelltherapie bei bis zu 24 Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen, soliden Tumoren klinisch prüfen. Die Studie soll die Sicherheit, die optimale Dosierung sowie erste Hinweise auf die Wirksamkeit der Therapie untersuchen. Sie wird vom NCT Berlin gesteuert, beteiligt sind außerdem die NCT-Standorte Dresden, Heidelberg, SüdWest, WERA und West sowie zusätzlich das Klinikum Nürnberg als Partner außerhalb des NCTs. Jahrzehntelange, vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderte Forschungsarbeiten am Max Delbrück Center und am Berlin Institute of Health in der Charité (BIH) haben die Grundlage dafür geschaffen.
Meilenstein für den NCT Standort Berlin
Der Studie ist eine gemeinsame Initiative des Biotech-Start-ups Captain T Cell, einer erfolgreichen Ausgründung aus dem Max Delbrück Center, und der Charité. „Die Förderung ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung personalisierter Krebstherapien und gleichzeitig ein Meilenstein für den Aufbau des neu gegründeten NCT Standorts Berlin, der hier wissenschaftlich im Lead ist und dessen Forschungstätigkeit nun weiter Fahrt aufnimmt“, sagt Professor Ulrich Keilholz, Sprecher und geschäftsführender Direktor des NCT Berlin. Die Zusammenarbeit der Wissenschafler*innen von Captain T Cell und führenden Krebszentren deutscher Universitätskliniken bezeichnet Ulrich Keilholz als „beispielhaft für den Ansatz des NCTs, in deutschlandweiten Kooperationen Krebsforschung auf höchstem Niveau voranzutreiben“.
Die TCR-T-Zelltherapie basiert auf T-Zellen, die mit einem gentechnologisch veränderten T-Zellrezeptor (TCR) ausgestattet sind. Dieser Rezeptor erkennt ein Eiweiß, das in verschiedenen soliden Tumoren vorkommt und als vielversprechendes Angriffsziel für Immuntherapien gilt: das Tumorantigen MAGE-A4. Diese T-Zellen können nicht nur Oberflächenmerkmale von Tumorzellen erkennen, sondern auch versteckte Strukturen innerhalb der Krebszellen. Zudem wurden sie molekular so trainiert, dass sie im feindlichen Umfeld des Tumors besser überleben und länger aktiv bleiben als andere Immunzellen.
Eine weitere, wichtige Besonderheit: Die in der ToMA4TA1-Studie verwendeten T-Zellen werden erstmals gezielt für Patient*innen mit HLA-A1 Gewebemerkmalen entwickelt und optimiert. Die vor Kurzem in den USA zugelassene erste TCR-T-Zelltherapie – ebenfalls eine MAGE-A4-spezifische Therapie – richtet sich hingegen nur an Menschen mit der Gewebemerkmal-Variante HLA-A2, wodurch viele potenzielle Patient*innen ausgeschlossen bleiben. Für sie eröffnen sich nun neue Möglichkeiten.
Eine neue Perspektive für Patient*innen
„Leider sehen wir in der Klinik viele Menschen, für die es keine etablierten Therapiemöglichkeiten mehr gibt und für die wir dringend neue Behandlungsoptionen benötigen“, erläutert Antonia Busse. „Neuartige TCR-T-Zelltherapien bieten in solchen Fällen die Chance auf relevante Therapieerfolge – selbst bei Krankheitsverläufen, die bisher als kaum behandelbar galten.“
„Die vorklinischen Daten sind vielversprechend und stimmen uns optimistisch, dass wir eine substanzielle Wirkung erzielen können“, ergänzt Dr. Felix Lorenz, Geschäftsführer (CEO und CSO) von Captain T Cell. „Es ist ein bedeutender Moment für unser Team, dass unsere TCR-T-Zelltherapie nun erstmals in einer klinischen Studie eingesetzt wird. Unser Ziel ist es, Patientinnen und Patienten ohne verbleibende Behandlungsoptionen eine neue Perspektive zu eröffnen.“
Patientenbeteiligung von Anfang an
Die Einschätzung teilt Ulla Ohlms, Sprecherin des Patientenforschungsrats am NCT Berlin und von Anfang an in die Studienentwicklung eingebunden: Als Patientenvertreterin müsse sie nicht in die Funktionsweise komplizierter Antigene eintauchen, betont sie. „Unsere Aufgabe ist es vielmehr, zu schauen, ob und welchen Nutzen Patienten von dieser Therapie haben könnten. Bei ToMA4TA1 handelt es sich um ein „proof of concept“. Hier werden also neue therapeutische Möglichkeiten erprobt, damit Patientinnen und Patienten weiterleben können, wenn zuvor alle anderen Therapien versagt haben: Das verstehe ich unter echtem Nutzen“, sagt Ohlms.
Text: Sandra Giannakoulis-Markus, NCT Berlin
Weiterführende Informationen
Living / 10.07.2025
Start der Auftaktmaßnahme zur Entwicklung des Pankeparks
Es ist so weit, die Baumaßnahmen der Auftaktmaßnahme Pankepark werden Mitte Juli 2025 beginnen und Ende des Jahres abgeschlossen sein. Der Pankepark ist ein teilweise sehr naturnaher Grünzug zwischen dem Flüsschen Panke, der S-Bahntrasse, dem Bahnhof Buch und der Autobahn. Er soll langfristig zu einem Gesundheits- und Sportpark für alle Generationen weiterentwickelt werden.
Als Auftakt für das Projekt wird die Fläche zwischen dem Zugang zum S-Bahnhof Buch und der Tennisanlage umgestaltet. Künftig werden sich alle Bewegungsbegeisterten an einer Calisthenics-Anlage, einer Tischtennisplatte und auf einer Boulefläche sportlich betätigen können. Zudem werden der Wegebelag der Promenade an der Panke erneuert und entlang des Weges neue Sitzmöglichkeiten gebaut. Zur Gewährleistung der klimaangepassten Gestaltung werden zusätzlich schattenspendende Bäume gepflanzt.
Einschränkungen während der Bauphase
Während der Bauzeit muss die Promenade westlich der Panke im Bereich der Tennisanlage und des Sportplatzes vorübergehend gesperrt werden. Eine ausgeschilderte Umleitung führt über den östlichen Weg entlang der Panke.
Zu Beginn der Arbeiten bleibt der südliche Zugang zum Sportplatz bis Mitte August geschlossen, der nördliche Zugang ist in dieser Zeit weiterhin nutzbar. Ab Mitte August kehrt sich dies um: Dann bleibt vorübergehend nur noch der südliche Zugang geöffnet.
„Mit dem Start der Bauarbeiten machen wir einen wichtigen Schritt hin zu einem attraktiven und lebendigen Pankepark. Unser Ziel ist es, Orte zu schaffen, an denen sich Menschen gerne aufhalten, sich begegnen und bewegen können – offen für alle Generationen. Besonders freut mich, dass wir dabei auch dem Klimaschutz Rechnung tragen und mit einer naturnahen Gestaltung auf die Herausforderungen des urbanen Raums reagieren“, freut sich Manuela Anders-Granitzki, Bezirksstadträtin für Ordnung und Öffentlicher Raum.
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus dem Städtebauförderprogramm Nachhaltige Erneuerung. Insgesamt werden für die Neugestaltung des Bereiches ca. 655.000 Euro eingesetzt.
Weitere Infos unter: https://www.nachhaltige-erneuerung.berlin.de/buch/pankepark-nord
Research / 09.07.2025
The cellular engineer

Molecular machines carry out many vital processes inside our cells. When their components – protein building blocks – are faulty, it can lead to disease. Structural biologist Oliver Daumke investigates how these machines are built, what makes them work, and what goes wrong when they malfunction.
For Professor Oliver Daumke, a cell is like an engine room – molecular machines made up of protein building blocks are continuously at work. These protein machines transport nutrients into the cell or help neutralize unwanted invaders among other tasks. It is a precisely choreographed dance of countless miniature processes.
For most of his scientific career, Daumke has been peering into this engine room of life to understand the components of these molecular machines. Using X-ray crystallography and cryo-electron microscopy, he deciphers the identities of the amino acids that make up chains of proteins of interest, and then investigates how these chains fold into 3D machines that are smaller than the wavelength of visible light.
“Like the blade of a pocketknife”
Opening his laptop, Daumke plays a short, animated film showing the choreography of a 3D model of GBP1 – a critical protein for the innate immune response in humans. GBP1 targets bacterial invaders like salmonella, latches onto them, encapsulates them, and disrupts their outer membranes so they can no longer replicate. “We discovered how the GBP1 machine positions itself on bacterial membranes to destroy them,” Daumke says. “Its protein structure changes dramatically when bound to bacteria and begins to form a uniform shell around the pathogen.”
The molecular choreography of GBP1 unfolds on the monitor in front of us, as it would take place in human cells following an infection. Two protein building blocks bind to two energy carrier molecules, called GTP, and connect head-to-head. Other proteins use the energy of GTP to open a molecular lever. “Like the blade of a pocket knife,” notes Daumke. They then combine with thousands of other unfolded GBP1 proteins to form what looks like spokes of a wheel, which in turn stack up with many other wheels to form tubes. These tubes attach themselves to the membrane of the bacterium – and make it permeable. Other, as yet unknown, immune defense molecules can then penetrate the bacterium and render it harmless.
Daumke’s eyes light up, as if seeing the animation for the first time. “That unfolding motion is absolutely spectacular,” he says. Understanding the molecular mechanism behind how GBP1 works fascinates him. While this is basic research, it has clinical implications – it could lead to drugs that boost the immune response to bacterial infections.
Small changes, major diseases – and paths toward cures
At the Max Delbrück Center, Daumke’s team is often pulled into projects that have found a faulty protein that is linked to disease. “Mutations in our genes can impair their function,” he says. “In the worst case, changing a single amino acid can cause a devastating illness.”
For example, when mutations make the dynamin protein overactive, it can lead to centronuclear myopathy – a fatal muscle disease. Vital for normal cell function, overactive dynamin disrupts muscle structure. Structure-function analyses help pinpoint which amino acids are responsible for such malfunctions — and how they might be corrected.
Daumke has spent 12 years studying the dynamin family of proteins, which play key roles in endocytosis – a process cells use to ferry substances inside. Partner proteins guide dynamin to the site on the cell membrane where, for example, iron molecules are to be taken up via a process called membrane invagination. Around 40 dynamin units then form a ring- like structure around neck of the invagination site. “Dynamin works like a ratchet, tightening the neck further and further until the invagination can be separated together with the iron molecules and then taken into the cell,” says Daumke. He first determined the structure back in 2011 and then created a comprehensive computer model of the process using his findings in 2021.
Such structural insights can have direct medical applications. Daumke’s team, for example, modified the structure of an antibody in such a way that it could be injected. The antibody is currently being tested in patients with multiple myeloma – a type of incurable bone marrow cancer. “The antibody is still in clinical trials, but in one patient, the cancer has completely disappeared,” Daumke says. The antibody could serve as the basis of a new therapy.
A life in service of protein machines
Asked what defines him as a scientist, Daumke points to persistence, an obsession with detail, and a willingness to challenge his own knowledge. Those qualities may explain his long-standing fascination with the highly complex science of protein structure and function.
As a student at the University of Cologne, he studied a transporter protein that moves peptides across membranes. For his doctorate at the Max Planck Institute of Molecular Physiology in Dortmund, he determined the 3D structure of Rap1GAP, and discovered a completely new mechanism through which the protein switches off a molecular signal in cells. During his postdoc at the Laboratory of Molecular Biology in Cambridge – a cradle of structural biology – he unraveled the workings of EHD2, a protein that forms a ring on cellular membranes to help to stabilize pores within the cell.
Daumke joined the Max Delbrück Center in 2007 as head of a junior research group. Since 2013, he has been Senior Group Leader of the Structural Biology of Membrane-Associated Processes lab. He also holds a professorship at Freie Universität Berlin. Today, his team includes 15 researchers.
Seeing the whole cell
Cryo-electron microscopy, which won the 2017 Nobel Prize in Chemistry, has greatly accelerated structural biology research. The technology allows scientists to visualize highly complex proteins and their spatial arrangement. Samples are flash-frozen in liquid nitrogen and imaged from multiple angles with electron beams, producing detailed 3D reconstructions. Daumke’s lab has been using this technology since 2017.
For a long time, structural biologists had been taking the approach of reducing complexity by looking at proteins in isolation using X-ray crystallography. Cryo-EM opened the door to studying proteins in their native cellular environment. Daumke's team also combines the method with light microscopy to tag proteins and locate them inside cells.
“Many proteins are dependent on other cellular partners or membranes to function,” he says. “To understand how these protein machines really work, you have to look at the whole picture.” This approach is known as integrative structural biology. The ability to view an entire cell, also enables scientists to better understand the effects of genetic mutations and address them therapeutically.
AI-powered predictions
The second big change in Daumke’s field is artificial intelligence. Google’s AlphaFold platform has calculated the structure of 200 million proteins in three-dimensional space and made them freely accessible to the scientific community. “This means that it is often no longer necessary to determine structures ourselves,” says Daumke. What can take several years in the laboratory, AlphaFold does in just a few minutes. However, many questions can still only be answered experimentally: how proteins are modified after they are synthesized, for example, how they interact, or how they move.
But this does not mean that structural biologists are becoming obsolete – quite the opposite. Combining integrative methods with AI is making it possible to answer entirely new questions. The ultimate goal? A full simulation of a cell with all its moving, interlocking parts. "How an entire cell works, in which thousands of protein machines work simultaneously, and how it is all coordinated, is a big question. Many disciplines must come together to solve this,” says Daumke. He wants to make a contribution by using the latest technologies to look even deeper into the engine room of the cell and trace the miniature processes of life – cog by cog.
Text: Mirco Lomoth
Source: Max Delbrück Center
The cellular engineer
Research, Innovation, Patient care / 08.07.2025
Cutting the environmental impact of research

From reducing freezer usage to plastic waste, Max Delbrück Center labs have been implementing strategies from the LEAF program for sustainable research. As more labs join the program, they are not only contributing to reaching our sustainability goals, they are also improving research quality.
Consuming 5 to 10 time more energy per square meter than standard office spaces, biomedical research labs have a substantial carbon footprint. Equipment like −80 degree C freezers use as much energy per year as a small German household, according to a 2023 study published in PLOS. Additionally, bioscience research is responsible for nearly 2% of global plastic waste.
The Max Delbrück Center is no exception. We produce the equivalent of about 20,000 tons of CO2 each year – by working here, one is effectively doubling their CO2 footprint. But under Sustainability Officer Christian Panetzky and his predecessor Dr. Michael Hinz, we have started to implement several measures to reduce our energy consumption. Our goal is to become greenhouse gas neutral by 2038.
Making our labs greener
Among these measures is compliance with the Laboratory Efficiency Assessment Framework (LEAF), a sustainability initiative developed by University College London aimed at enhancing laboratory environmental performance. LEAF offers an online platform to guide labs through actions that focus on consuming less energy and water and reducing plastic waste. Laboratories anywhere can achieve Bronze, Silver or Gold certifications based on the number and complexity of sustainability actions they implement.
This year, the first four of our labs attained Bronze: Sander, Poulet, and both Rajewsky labs. “Bronze is about taking small steps to get used to certain practices,” says Dr. Alexis Shih in the Pancreatic Organoid Research and Disease Modeling lab of Professor Maike Sander. The lab for example, and cleaned out its sample inventory and as a result, was able to decommission three refrigerator/freezers. The Poulet lab was also able to reduce its energy use by sharing freezers with other labs. And since 2024, all labs have actually adjusted their ultra-low freezer temperature to -70 degrees C, because they had found that a 10 degree difference did not affect performance.
“Many of the actions involve looking at what equipment uses a lot of energy and trying to find ways to reduce the impact,” Shih adds. Data storage, for example, also consumes a lot of energy. Shih now tries to backup only data that is absolutely necessary and avoids duplicating files. Many labs have also implemented other sustainability actions tailored to their specific work, such as choosing to purchase sterile pipette tips that are packaged in boxes that can be partially recycled.
Reducing environmental impact isn’t the only benefit of LEAF. One task on the Bronze certification list, for example, requires labs to do periodic checks of all instruments and reagents to ensure they are adequately calibrated and labeled and that none are expired. Experiments that fail because of avoidable mistakes use a lot of resources, Shih adds, because they must be repeated. “Any researcher would want to ensure the quality and reproducibility of their research. It’ just good science.”
Tools and changing people’s mindset
To calculate energy usage and plastic waste, the LEAF platform offers online calculators. But Katrin de la Rosa's team, led by Lisa Spatt and Mikhail Lebedin, have taken the exercise even further. They measured the energy consumption of every device equipped with a standard plug in their lab. To their surprise, they found that the 230V devices alone consume well over 220 kWh per week – the same amount of energy required to fully charge two Teslas. This value does not include the largest energy consumers such as ultra-low temperature freezers and building services equipment.
In fact, ventilation systems usually account for the largest chunk of a lab’s energy use. That’s because many Max Delbrück Center labs exchange air eight times an hour as part of a safety feature. The certified labs in our more modern facilities, however, can control the air exchange manually, which ensures the highest setting is used only when necessary. This is especially important during weekends, when the labs are largely empty.
But perhaps the biggest change wrought by the program is in the way that people think. The Poulet lab, for example, uses isoflurane gas to anesthetize research animals. Isoflurane is also a potent greenhouse gas. With some investigation, Dr. Svenja Steinfelder, Lab Manager in the Poulet lab, figured out a way to return excess gas collected in a filter system back to the supplier. It can then be reprocessed into new isoflurane gas. While this measure is not part of LEAF certification, the process of going through the LEAF check list has made her think about all the additional ways the lab can conserve resources, she says.
“Achieving Bronze does not take a lot of effort,” adds Steinfelder. “Much of the focus is on raising people’s awareness of our energy usage and to get people thinking about ways to conserve.”
Expanding LEAF to other labs
“The Bronze tier is a brilliant way to get our lab teams thinking about the impact of their day-to-day work and where they can optimize – without piling extra work on anyone,” says Panetzky. “Frankly, every one of our labs could hit Bronze with very little effort.”
By the end of 2026, Panetzky and his team would like at least half of all Max Delbrück Center labs certified Bronze. To achieve that goal, Panetzky’s team will approach labs systematically and encourage them to join LEAF. At the Summer Science Day on July 3, as well as at the quarterly Sustainability Ambassadors meeting, to which each lab and department is requested to send a delegate, results will be showcased.
Although there are currently no plans to make LEAF compliance mandatory in Germany, labs applying for international grants will quickly notice that funding institutions such as Cancer Research U.K. and the Wellcome Trust among others, now require a green-lab certificate just to submit an application, Panetzky notes.
Going for Gold
All labs should of course aspire to Silver or Gold LEAF status, Panetzky says, which are more demanding. Labs are required to implement best practices for using fume hoods and safety cabinets, check the energy efficiency of software code, or cut and reuse consumables even further, among other measures.
“Getting all labs on board will take real initiative and more time,” he adds. “This is a long-term goal and perhaps we can encourage it by rewarding the extra effort. Letting labs keep a share of any energy and resource savings they generate could be the way to go. Incentives like that turn sustainability into a win-win for science and the budget.”
Text: Gunjan Sinha
Further information
- Sustainable Development at the Max Delbrück Center
- Driving sustainable transformation by Christian Panetzky
- Greening the lab
- Interview with former Sustainability Officer Michael Hinz
Living / 07.07.2025
Bezirk Pankow zeigt am 8. Juli die Flagge der „Mayors for Peace“ an der Fröbelstraße
Das Bezirksamt Pankow zeigt Flagge für eine atomwaffenfreie und friedliche Welt. Kriege, Klimawandel und eine weltweite Bedrohung der Demokratien: Vor diesem Hintergrund findet am 8. Juli der Flaggentag der „Mayors for Peace“ (Bürgermeister:innen für den Frieden) statt. Auch in diesem Jahr setzen rund 600 Städte in Deutschland mit dem Hissen der „Mayors for Peace“ Flagge vor den Rathäusern ein deutliches Zeichen gegen Kriege und für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen. Am Verwaltungsstandort in der Fröbelstraße 17, 10405 Berlin weht die Flagge am Dienstag, dem 8. Juli 2025.
Wer sind die „Mayors for Peace“?
Die Organisation wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet. Das weltweite Netzwerk setzt sich vor allem für die Abschaffung von Atomwaffen ein, greift aber auch aktuelle Themen auf, um Wege für ein friedvolles Miteinander zu diskutieren. Mehr als 8.390 Städte in 166 Ländern gehören dem Netzwerk an, darunter 895 Städte in Deutschland.
Was ist der Flaggentag?
Am Flaggentag erinnern die „Mayors for Peace“ an ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag vom 8. Juli 1996. Der Gerichtshof stellte fest, dass die Androhung des Einsatzes und der Einsatz von Atomwaffen generell gegen das Völkerrecht verstoßen. Zudem stellte der Gerichtshof fest, dass eine völkerrechtliche Verpflichtung besteht, „in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen und zum Abschluss zu bringen, die zu nuklearer Abrüstung in allen ihren Aspekten unter strikter und wirksamer internationaler Kontrolle führen.“
Research, Innovation, Patient care / 03.07.2025
Deep Tech Award 2025: Berliner Unternehmen ausgezeichnet, darunter PRAMOMOLECULAR
Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe vom 02.07.2025
Am 2. Juli 2025 wurden fünf Berliner Unternehmen mit dem Deep Tech Award ausgezeichnet. Der Preis würdigt besonders innovative und gesellschaftlich relevante Technologien aus der Hauptstadt in fünf Kategorien: Künstliche Intelligenz, Photonik & Quantentechnologien, Robotik, Sustainable & Social Impact und Web3 – DLT, Blockchain, NFT & Metaverse.
In der Kategorie Sustainable & Social Impact gewann PRAMOMOLECULAR, ein Biotech-Unternehmen mit Sitz am Zukunftsort Campus Berlin-Buch. Auch dieses Unternehmen ist eine Ausgründung der Technischen Universität Berlin (Zukunftsort Berlin Campus Charlottenburg). Das Biotech-Unternehmen PRAMOMOLECULAR setzt auf innovative siRNA-Therapien zur gezielten Behandlung schwer therapierbarer Erkrankungen wie Bauchspeicheldrüsenkrebs. Durch patentierte Transportmoleküle kann die Wirkung punktgenau entfaltet werden, ohne gängige Verpackungsmechanismen und mit hoher Effizienz.
Die Gewinner erhielten jeweils 10.000 Euro. Die Preisverleihung fand anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Awards im Säälchen am Holzmarkt statt.
Hier gelangen Sie zur gesamten Pressemitteilung.
https://zukunftsorte.berlin/news/deep-tech-award-2025/Research / 01.07.2025
Maike Sander elected member of EMBO

The European Molecular Biology Organization has elected Scientific Director of the Max Delbrück Center Maike Sander to its membership. She will join a community of more than 2,100 leading life scientists who guide the organization and help shape the future of life science research.
Professor Maike Sander, Scientific Director of the Max Delbrück Center and Vice President of Helmholtz Health, has been elected member of the European Molecular Biology Organization (EMBO) – one of the largest molecular biology organizations in Europe. She is one of 69 new EMBO Members and Associate Members who have been selected this year for their outstanding achievements in the life sciences.
EMBO members are nominated and elected by existing members. Among other tasks, members guide and support EMBO activities. They evaluate funding applications, serve on EMBO Council and committees, or join the editorial boards of EMBO Press journals. Members also help shape the direction of life science research, support early-career scientists, and strengthen research communities.
“It’s an honor to join the EMBO community, whose members have shaped breakthroughs in the life sciences. I look forward to contributing to the EMBO mission and advancing research that improves human health,” says Sander.
The new members will be formally welcomed at the next EMBO Members’ Meeting in Heidelberg, Germany, on 22-24 October 2025.
Leading the charge against diabetes
Sander’s research has focused on uncovering the molecular mechanisms that govern how insulin producing beta cells form and function. Her aim is to develop novel therapies to treat diabetes.
Beta cells are located inside islets, cell clusters in the pancreas that house several different types of hormone-secreting cells. She and her team have developed approaches to grow islet cell organoids from human pluripotent stem cells, which they use to study why beta cells become dysfunctional in diabetes. They modify the organoids to mimic different conditions and use single-cell genomics and other tools to chart the molecular signals that cue cells to produce insulin – and to understand what disrupts this process in disease.
Her lab recently developed an organoid model of stem cell-derived pancreatic islets with integrated vasculature, which more closely resembles the native environment of beta cells in the human body. Further research aims to improve this model even more. By using microfluidic chips to expose organoids to immune cells, she aims to better understand how immune cells destroy beta cells in Type 1 diabetes. Uncovering how beta cells are destroyed in Type 1 diabetes – and why they stop making insulin in Type 2 diabetes – she hopes will lead to better diabetes treatments.
Professor Maike Sander is Scientific Director of the Max Delbrück Center and Vice President of Helmholtz Health. She is an elected member of the German National Academy of Sciences Leopoldina, the Association of American Physicians, and the American Society of Clinical Investigation. She is a recipient of the Grodsky Award of the Juvenile Diabetes Research Foundation, the Alexander von Humboldt Foundation Research Award, and the 2022 Albert Renold Prize by the European Society for the Study of Diabetes.
Further information:
Sander Lab
First vascularized model of stem cell islet cells
Profile of Maike Sander
EMBO press release (with all new 2025 members)
Research, Innovation, Patient care, Education / 29.06.2025
Enormer Besucheranstieg: Mehr als 36.000 Berlinerinnen und Berliner feiern 25 Jahre Lange Nacht der Wissenschaften
Zum 25. Jubiläum hat die Lange Nacht der Wissenschaften 2025 in Berlin am Samstag mehr als 36.0000 Besucher:innen angezogen – deutlich mehr als in den vergangenen Jahren und ein eindrucksvoller Beleg für das enorme Interesse an und die Bedeutung der Forschung und Wissenschaft in der Stadt.
Als Verein der Langen Nacht der Wissenschaften freuen wir uns schon jetzt auf die nächste LNDW, die für den 06.06.2026 geplant ist“, sagte Dr. Christine Quensel, Vorstandsvorsitzende des LNDW e. V. und Geschäftsführerin der Campus Berlin-Buch GmbH (Datum vorbehaltlich von Änderungen).
Das Wissenschaftsevent mit dem umfangreichen und vielfältigen Programm feierte in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum: Seit 25 Jahren begeistert die LNDW ihre Gäste mit faszinierenden Einblicken in Forschung und Innovation – ein Vierteljahrhundert voller Staunen, Lernen und Erleben. Das Festival, das 2001 in Berlin erstmals zehntausende Besucher:innen anlockte, wird inzwischen auch in vielen anderen Städten gefeiert.
Eröffnet wurde die Jubiläumsveranstaltung in diesem Jahr auf dem Campus Berlin-Buch von der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege, Dr. Ina Czyborra, sowie Dr. Christina Quensel.
Dr. Christina Quensel zeigte sich hoch erfreut über das große Interesse und die spürbare Begeisterung der Besucherinnen und Besucher für wissenschaftliche Themen:
„Ich bin sehr beeindruckt, wie wissensdurstig unsere Gäste sind – ganz gleich, ob sie aus Berlin, Brandenburg oder von weit herkommen. Für mich zeigt die Lange Nacht der Wissenschaften gerade in Zeiten der Digitalisierung, in der vieles auch virtuell möglich scheint, wie wichtig echte Begegnungen und Forschung zum Anfassen und Mitmachen sind. Wir alle und natürlich zuallererst unsere Gäste haben erlebt, wie wertvoll es ist, wenn Wissenschaft verständlich und nahbar wird. Und sie haben gesehen, wie wichtig die Wissenschaft für diese Stadt ist – als Motor für Innovation und wirtschaftlichen Fortschritt.
Für das große Interesse unserer über 36.000 Besucher:innen sage ich ganz persönlich: Herzlichen Dank! Und selbstverständlich auch ein großer Dank an die vielen aktiven Wisschenschaftler:innen in den mehr als 50 Einrichtungen, die dabei waren. Wir alle freuen uns schon jetzt auf die LNDW am 06.06.2026 – und darauf, noch mehr Menschen für Wissenschaft zu begeistern.“
Mit Experimenten, Wissenschaftsshows, Vorträgen, Laborführungen und vielen anderen Formaten wurde ein vielseitiges Programm geboten: Die Lange Nacht der Wissenschaften gab Einblicke in Naturwissenschaft und Technik, Geisteswissenschaften, Bildung und Forschung, Mensch und Gesellschaft, Medizin und Gesundheit sowie Kunst und Kultur. Sie griff zudem wichtige Themen unserer Zeit auf – wie Klimawandel, Ernährung, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz.
Die nächste LNDW ist für den 06.06.2026 geplant (vorbehaltlich von Änderungen).
Fotos von der Langen Nacht der Wissenschaften 2025 finden Sie hier.
Informationen zur Langen Nacht der Wissenschaften:
Die Lange Nacht der Wissenschaften (LNDW) findet seit 2001 jährlich statt. Organisiert und finanziert wird die Lange Nacht der Wissenschaften weitgehend von den beteiligten wissenschaftlichen Einrichtungen selbst. Darüber hinaus wird sie von zahlreichen Partner:innen unterstützt.
Ein besonderer Dank gilt der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege und unserer Spenderin, der Technologiestiftung Berlin.
Die Lange Nacht der Wissenschaften online:
www.langenachtderwissenschaften.de
www.facebook.com/LangeNachtDerWissenschaftenBerlin
www.instagram.com/lndwberlin
www.linkedin.com/company/lange-nacht-der-wissenschaften-berlin
Research, Innovation, Patient care, Education / 28.06.2025
Das war die Lange Nacht der Wissenschaften 2025!
Seit 25 Jahren gibt es die Lange Nacht der Wissenschaften in Berlin – und wir am Max Delbrück Center und auf dem Campus Berlin-Buch waren von Anfang an dabei. Am 28. Juni haben wir mit Forschungsbegeisterten, vielen Familien und prominenten Gästen das Jubiläum gefeiert.
Ein Vierteljahrhundert! Was 2001 als Initiative einzelner Berliner Wissenschaftsinstitutionen begann, ist inzwischen zu einem stadtweiten Festival der Forschung geworden. „Die Lange Nacht ist wohl einer der schönsten Termine des Jahres, zumindest für mich“, sagte Dr. Ina Czyborra, die Berliner Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege, bei der Eröffnung auf dem Campus Buch. „Und Sie gehören zu den Organisator*innen der ersten Stunde! Der Campus Buch ist ein zentraler Motor für den Fortschritt in der Gesundheitsversorgung – das freut mich als Senatorin besonders. Wir sollten uns immer wieder vor Augen führen, wie sehr uns die Wissenschaft seit Jahrtausenden voranbringt statt der Anti-Eliten-Erzählung zu glauben, die es nicht nur in den USA gibt.“
Die Lange Nacht zeige jedes Jahr aufs Neue, wie sehr Wissenschaft die Stadt Berlin prägt, betonte Kirstin Bodensiek, die Administrative Vorständin (interim) des Max Delbrück Center. „Wer hier hinter die Kulissen blickt, kann sehen, wie die Medizin von morgen entsteht.“
Damit die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung wirklich in die Klinik kommen, seien Unternehmen unerlässlich, ergänzte Dr. Christina Quensel, Geschäftsführerin der Campus Berlin-Buch GmbH (CBB) und Vorsitzende der Langen Nacht. Auf dem Campus gebe es etwa 70 Unternehmen, die meisten wurden aus den Forschungszentren ausgegründet. „Und ja, es ist immer noch Berlin – auch wenn wir außerhalb des Autobahnrings liegen und die S-Bahn heute nicht bis Buch fährt. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben!“
Ab 17 Uhr konnten Familien, Forschungsbegeisterte und prominente Gäste dann in den Laboren hinter die Kulissen schauen, eine Lichtshow, Magie, ein Pub-Quiz und eine Lesung erleben, selbst Experimente machen, durch ein Arterienmodell gehen oder VR-Exkursionen ins Herz unternehmen.
Foto: Von links nach rechts: Dr. Henry Marx, Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung in Berlin, Olaf Schulz, Vorstand der Berliner Sparkasse, Dr. Ina Czyborra, Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege in Berlin, Dr. Christina Quensel, Geschäftsführerin der Campus Berlin-Buch GmbH, Kirstin Bodensiek, Administrative Vorständin (interim), Professorin Dorothea Fiedler, Direktorin des Leibniz FMP, Professor Volker Haucke, Direktor des Leibniz FMP, Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender Eckert & Ziegler. Dr. Ulrich Scheller, Geschäftsführer der Campus Berlin-Buch GmbH eröffneten die Lange Nacht.
© Peter Himsel / CBB
Weitere Fotos finden Sie auf www.mdc-berlin.de
www.mdc-berlin.deResearch / 27.06.2025
Wie sich das frühe Herz entwickelt
Der Ionenkanal PIEZO2 verarbeitet nicht nur Berührungsreize. Wie ein Team um Annette Hammes vom Max Delbrück Center in Nature Cardiovascular Research berichtet, ist er auch für das Wachstum der Herzkranzgefäße wichtig. Die Erkenntnisse könnten helfen, angeborene Herzleiden besser zu verstehen.
Unsere Haut spürt selbst einen leisen Lufthauch. Zu verdanken ist ihre Sensibilität speziellen Ionenkanälen, die in den Membranen ihrer Zellen liegen und dort auf feinste mechanische Reize reagieren. Dass einer dieser Kanäle, PIEZO2, zudem eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Herzkranzgefäße und des Herzens spielt, hat ein Team um Dr. Annette Hammes gezeigt. Die Forscherin leitet am Max Delbrück Center die Arbeitsgruppe „Molekulare Signalwege in der kortikalen Entwicklung“. Erschienen ist ihre Arbeit im Fachblatt „Nature Cardiovascular Research“.
Weitere Arbeitsgruppen des Max Delbrück Center waren an der Studie maßgeblich beteiligt, darunter die Teams der Professoren Gary Lewin, Holger Gerhardt und Norbert Hübner. „An unserem Zentrum bündeln wir unterschiedliche Fachkompetenzen, um zentrale biologische Prozesse zu verstehen“, sagt Hammes. Die Ergebnisse der jüngsten Kooperation tragen dazu bei, die Ursachen angeborener Herzerkrankungen herauszufinden – mit dem Ziel, sie künftig früher erkennen und behandeln zu können. „Zudem könnte PIEZO2 eine neue Zielstruktur für Therapien gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden“, erläutert Hammes.
Fehlerhafte Herzkranzgefäße
Gemeinsam mit ihren Kolleg*innen konnte die Erstautorin der Studie, Dr. Mireia Pampols-Perez aus Hammes’ Team, an Mausmodellen zeigen, dass sich die Koronararterien ohne PIEZO2 nicht korrekt entwickeln: Fehlt der Ionenkanal, bleiben die feinen Gefäße zu eng oder verzweigen sich anders als gewöhnlich. Dadurch wird der Herzmuskel nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Ähnliche Fehlbildungen traten bei Mäusen mit einer überaktiven PIEZO2-Variante auf, die beim Menschen unter anderem eine seltene Erbkrankheit, das Marden-Walker-Syndrom, hervorruft. In beiden Fällen verdickte sich besonders in der linken Herzkammer das Herzmuskelgewebe – vermutlich infolge des gestörten Wachstums der Gefäße.
„Genomweite Assoziationsstudien deuten darauf hin, dass Mutationen im PIEZO2-Gen auch beim Menschen kardiovaskuläre Erkrankungen wie Herzinsuffizienz, Bluthochdruck oder Aneurysmen verursachen können“, sagt Hammes. „Fehlfunktionen des Ionenkanals während der Embryonalentwicklung führen vermutlich zunächst zu kaum erkennbaren Gefäßveränderungen – die im Alter oder bei starker körperlicher Belastung aber schwere Herzprobleme auslösen können.“
Gewöhnlich ist PIEZO2 nur bei Embryonen in den Endothelzellen der Koronararterien, die die Innenseite der Gefäße auskleiden, aktiv. Spätestens nach der Geburt stellt der Kanal dort in der Regel seine Arbeit ein. „Es gibt aber Hinweise, dass er im erwachsenen Herzen unter bestimmten Bedingungen wieder exprimiert wird und dann möglicherweise die Regeneration von Gefäßen fördern kann“, berichtet Hammes. „Das ist natürlich ein sehr spannender Aspekt – zum Beispiel bei der koronaren Herzkrankheit oder nach einem Infarkt.“
Neue Optionen für Diagnostik und Prävention
Aktuell untersucht ihr Team daher gemeinsam mit Kolleg*innen des Helmholtz-Instituts für translationale AngioCardioScience (HI-TAC) in Heidelberg und Mannheim sowie der Technologie-Plattform „Pluripotente Stammzellen“ des Max Delbrück Center, inwieweit sich die an Mäusen gewonnenen Erkenntnisse über PIEZO2 auf den Menschen übertragen lassen. Dazu nutzen die Forschenden humane Endothelzellen, die sie aus pluripotenten Stammzellen gewinnen. „Mit diesen Modellen möchten wir herausfinden, wie sich die Expression und die Aktivität von PIEZO2 beim Menschen gezielt beeinflussen lassen“, sagt Hammes.
Der medizinische Nutzen ihrer Forschung ist vielfältig. „Die aktuelle Studie erweitert das Verständnis für angeborene Herzfehler und ergänzt die Liste von Genen, die sich für die Diagnostik und Prävention nutzen lassen“, erklärt Hammes. „Unsere Ergebnisse können so dazu beitragen, genetisch bedingte Herz-Kreislauf-Erkrankungen früher zu erkennen – und langfristig vielleicht sogar zu verhindern.“
Weiterführende Informationen
Literatur
Mireia Pampols-Perez, et al. (2025): „Mechanosensitive PIEZO2 channels shape coronary artery development“. Nature Cardiovascular Research, DOI: 10.1038/s44161-025-00677-3
Bild: Herz einer Maus im späten Embryonalstadium: Das Gewebe wurde per Tissue Clearing transparent gemacht. Auf dem mit dem Lichtblattmikroskop aufgenommenen Bild sind die sich entwickelnden Koronararterien zu sehen. Sie sind mit Antikörpern türkis gefärbt. (Foto: Mireia Pampols-Perez, Max Delbrück Center)
Living / 27.06.2025
Sturmschäden in Pankower Grünanlagen – Warnung vor dem Betreten bleibt bestehen
Durch das Unwetter am 23.06.2025 ist es im gesamten Bezirk Pankow zu erheblichen Sturmschäden gekommen. Zahlreiche Baumkronen wurden beschädigt, Bäume stürzten um und in vielen Fällen hängen noch lose Äste gefährlich in den Baumkronen. Der darauffolgende Sturm am 26.06.2025 hat die Situation weiter verschärft und zusätzliche Schäden an Bäumen und Gehölzen verursacht.
Gefahr beim Betreten der Grünanlagen
Die aktuellen Schäden stellen eine erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit dar. Das Straßen- und Grünflächenamt Pankow warnt daher weiterhin ausdrücklich vor dem Betreten der Grünanlagen. Es wird dringend darum gebeten, besondere Vorsicht walten zu lassen und beschädigte Bereiche weiträumig zu meiden.
Schadenbeseitigung dauert an
Alle verfügbaren internen und externen Kapazitäten sind derzeit im Einsatz, um die Schäden zu sichten und notwendige Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen. Aufgrund des Umfangs der Schäden reichen die vorhandenen Ressourcen jedoch nicht aus, um sämtliche Gefahrenstellen kurzfristig zu beseitigen. Es ist davon auszugehen, dass die Arbeiten zur Schadensbeseitigung noch mehrere Tage in Anspruch nehmen werden.
„Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger, die Grünanlagen weiterhin nur mit größter Vorsicht zu betreten oder im Zweifel ganz zu meiden“, erklärt Manuela Anders-Granitzki, Bezirksstadträtin für Ordnung und öffentlichen Raum. „Die Sicherheit der Menschen hat für uns oberste Priorität. Es wurden unverzüglich Maßnahmen eingeleitet, um gefährliche Äste und beschädigte Bäume zu sichern. Dennoch ist die Lage weiterhin angespannt und mit Risiken verbunden.“
Das Straßen- und Grünflächenamt bittet um Verständnis und Aufmerksamkeit – zum Schutz aller. Sobald die akuten Gefahrenstellen beseitigt sind, wird über eine Aufhebung der Warnung informiert.
Research, Innovation, Patient care / 26.06.2025
Biomedical innovation in Berlin gets €30 million boost
The Helmholtz Association has approved €30.8 million in funding for the Center for AI–Accelerated Molecular Innovations in Medicine to be located at the Max Delbrück Center. Researchers will use new technologies to develop AI-driven strategies for precision treatment and prevention.
In an ageing society, extending health-span will require not only treating illness, but also stopping disease before it starts. Such precision prevention will require a detailed understanding of the molecular and cellular changes that unfold as a person’s health gradually transitions into disease. To gain such insight, researchers must generate and analyze vast molecular and clinical data from both healthy individuals and patients. Advanced AI models will be essential to uncover patterns and mechanisms within these complex data. These insights will drive new tools, diagnostics, and therapies – advancing precision medicine to prevent disease even before symptoms appear.
The Center for AI-Accelerated Molecular Innovations in Medicine (AI2M) will help turn this vision into reality. Backed by €30.8 million in funding from the Helmholtz Association for construction and equipment, AI2M is set to break ground in 2026. The center will be located at two strategic hubs in Berlin – Mitte and Buch. Construction of the Spatial and Single-cell Biomedicine and AI hub at the Berlin Institute for Medical Systems Biology in Mitte is scheduled to be completed by 2029, with the Human Cell Model and Bioengineering hub in Buch following in 2033.
“As medicine shifts from reactive to predictive, innovation hubs like AI2M will play a pivotal role in transforming medical care – making earlier, more personalized, and more effective interventions not only possible, but a part of everyday healthcare,” says Professor Maike Sander, Scientific Director of the Max Delbrück Center and Vice President of Helmholtz Health.
Combining technology and expertise
At both hubs, researchers will work in interdisciplinary teams that will include academic medical centers and industry partners. Taking advantage of large population studies that are collecting vast amounts of data from volunteers, AI2M researchers will harness the power of AI to mine these datasets to discover biomarkers that signal disease before clinical symptoms appear, or to develop new targeted therapies.
Max Delbrück Center scientists are at the forefront of developing the technologies that AI2M will bring to bear in medical innovation. For example, the laboratories of Professor Nikolaus Rajewsky, Dr. Ashley Sanders, and Dr. Fabian Coscia have shown that single-cell and spatial multi-omic approaches can map disease progression with unprecedented resolution. Drs. Jakob Metzger, Mina Gouti, and Sebastian Diecke have pioneered high-throughput, screening platforms that use organoids grown from individual patients’ cells as models — enabling researchers to precisely map disease trajectories and test personalized therapies.
In Berlin, the Charité Universitätsmedizin Berlin and the Berlin Institute of Health at Charité will serve as key local partners to help accelerate the translation of laboratory-based medical innovations into clinical practice.
“Tackling today’s most pressing scientific challenges demands breaking down disciplinary silos. AI2M will create powerful new links between AI, engineering, biology, and medicine –enabling ideas to move more freely, technologies to converge, and diverse teams to collaborate seamlessly, says Dr. Stan Gorski, Head of Strategic Initiatives at the Max Delbrück Center. “Breakthroughs arise at the intersections.”
Text: Gunjan Sinha
Source: Press Release Max Delbrück Center
Biomedical innovation in Berlin gets €30 million boost
Research, Innovation, Patient care, Education / 25.06.2025
Wie gut kennen Sie Berlins Forschungslandschaft?
Jetzt beim Quiz zur Langen Nacht der Wissenschaften mitmachen
Zum 25-jährigen Jubiläum der Langen Nacht der Wissenschaften lädt ein spannendes Quiz dazu ein, das eigene Wissen rund um Wissenschaft und Forschung in Berlin auf die Probe zu stellen. Ob Wissenschaftsfan oder Neugierige:r – testen Sie hier Ihr Wissen und feiern Sie mit uns 25 Jahre kluge Köpfe und große Ideen.
Quelle: Newsletter #5 Lange Nacht der Wissenschaften e.V.
Jetzt beim Quiz zur Langen Nacht der Wissenschaften mitmachen
Living / 25.06.2025
Sturmschäden in Pankow – Bezirksamt bittet um erhöhte Aufmerksamkeit
Durch das Unwetter am 23.06.2025 ist es im gesamten Bezirk zu Sturmschäden gekommen. Beschädigte Baumkronen, umgestürzte Bäume und lose in den Bäumen hängende Äste stellen aktuell in den Pankower Grünanlagen eine große Gefahr für die Allgemeinheit dar.
Das Straßen- und Grünflächenamt Pankow warnt daher vor dem Betreten dieser Bereiche und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit. Alle verfügbaren Dienstkräfte sind zurzeit im Einsatz, um die Schäden zu begutachten und zu beheben. Es wird voraussichtlich jedoch mehrere Tage dauern, bis zumindest die akuten Unfallgefahren beseitigt sind.
„Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger, die Grünanlagen derzeit nur mit größter Vorsicht zu betreten und beschädigte Bereiche weiträumig zu meiden.“, warnt Manuela Anders-Granitzki, Bezirksstadträtin für Ordnung und öffentlichen Raum. „Die Sicherheit der Menschen hat für uns höchste Priorität. Es wurden umgehend Maßnahmen ergriffen, um beschädigte Bäume und Äste zu sichern und somit das Risiko für Passanten zu minimieren.“
Living / 19.06.2025
Gesundheitsrisiken durch den Eichenprozessionsspinner auch im Bezirk Pankow
Der Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea processionea) tritt in diesem Jahr besonders häufig auf. Auch im Bezirk Pankow mehren sich derzeit die Beobachtungen und Hinweise auf Raupennester an Eichen – sowohl im öffentlichen Grün als auch in der Nähe von Wohnanlagen, Spielplätzen, Schulen oder Erholungsflächen. Die Raupen des Nachtfalters stellen eine ernstzunehmende gesundheitliche Gefahr für Menschen dar.
Bitte keine Eigeninitiative!
Aufgrund der aktuellen Lage bittet das Bezirksamt Pankow um erhöhte Aufmerksamkeit im Umgang mit auffälligen Raupen oder Gespinsten im Stadtgrün. Befallene Bäume und betroffene Flächen sollten möglichst gemieden werden, insbesondere mit Kindern oder Haustieren. Bei Verdacht auf einen Befall ist vom Kontakt mit den Raupen oder Nestern strikt abzusehen. Kleidung, die möglicherweise mit den Haaren in Berührung kam, sollte sofort gewechselt und gewaschen werden. Das Bezirksamt weist darauf hin, dass keine eigenständigen Bekämpfungsmaßnahmen vorgenommen werden sollten. Fachfirmen verfügen über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung zur sicheren Entfernung.
Eine klare Unterscheidung zu harmlosen Arten wie der Gespinstmotte hilft, unnötige Sorgen zu vermeiden. Wer sich umsichtig verhält, Kontakt meidet und befallene Bereiche meidet, schützt sich selbst und andere, ganz besonders in der jetzigen Phase erhöhter Raupenaktivität.
Brennhaare mit Nesselgift
Die Raupen des Eichenprozessionsspinners erscheinen ab April und entwickeln sich im Laufe des Frühjahrs bis zur Verpuppung im Sommer. Ab dem dritten Larvenstadium (L3) – aktuell vielerorts bereits erreicht – tragen sie feine Brennhaare, die ein Nesselgift enthalten. Dieses Gift kann bei Berührung oder Einatmung Hautausschläge, Augenreizungen, Juckreiz und in schweren Fällen Atembeschwerden oder allergische Reaktionen auslösen. Besonders empfindlich reagieren Kinder, ältere Menschen sowie Personen mit Vorerkrankungen der Atemwege. Die feinen Haare brechen leicht ab, haften an Kleidung oder Schuhen und werden durch den Wind über größere Distanzen verbreitet. Selbst alte oder scheinbar verlassene Nester können noch Monate später gefährlich sein.
Potenzielle Gesundheitsgefahr
Typisch für den Eichenprozessionsspinner sind dichte, oft mehrere Raupengenerationen beherbergende Gespinste an Stämmen oder in Astgabeln von Stiel- und Traubeneichen. Die Raupen bewegen sich oft in langen Reihen, sogenannten „Prozessionen“, auf der Suche nach Futterplätzen in der Baumkrone daher ihr Name. Aufgrund der potenziellen Gesundheitsgefahren sollte der direkte Kontakt mit den Raupen oder ihren Nestern unter allen Umständen vermieden werden.
Für die Organisation von Abwehrmaßnahmen, wie etwa die mechanische Entfernung der Nester, sind die jeweiligen Eigentümer der betroffenen Grundstücke zuständig. Die Entfernung darf ausschließlich durch geschultes Fachpersonal unter Verwendung geeigneter Schutzkleidung erfolgen. Eine eigenständige Beseitigung ist nicht empfehlenswert.
Verwechslungsgefahr - Prozessionsspinner nur an Eichen
Im Frühjahr kommt es außerdem häufig zu Verwechslungen mit den harmlosen Gespinstmotten. Diese treten bevorzugt an Sträuchern wie Weißdorn, Apfel oder Pfaffenhütchen auf. Ihre Raupen sind hell, unbehaart und für den Menschen ungefährlich. Während der Eichenprozessionsspinner ausschließlich an Eichen vorkommt, besiedeln Gespinstmotten eine Vielzahl von Sträuchern und spinnen ganze Pflanzenteile in silbrige Netze ein. Ihre Gespinste wirken zwar auffällig, stellen aber keinerlei gesundheitliche Gefahr dar. Im Unterschied zum Eichenprozessionsspinner befinden sich die Nester der Gespinstmotte meist großflächig um Zweige und ganze Sträucher, während der Eichenprozessionsspinner kompakte Nester bevorzugt, die direkt an Stämmen und Ästen von Eichen sitzen. Eine weitere Unterscheidung liegt in der Behaarung: Die Raupen des Eichenprozessionsspinners sind stark behaart, während Gespinstmottenraupen unbehaart und hell sind.
Research, Innovation, Patient care, Education / 18.06.2025
Students from Freie Universität Berlin visited the Campus Berlin-Buch

Visiting the Campus Berlin-Buch: Master's students in Biology at Freie Universität Berlin learned about career opportunities and start-ups at the BiotechPark Berlin-Buch on June 11, 2025.
During a tour of the campus with Campus Manager Dr. Ulrich Scheller, they were first given an overview of the closely cooperating research institutions and biotech companies as well as the location of future innovation Berlin-Buch, whose profile focuses on biomedicine and health.
Dr. Uwe Lohmeier, Head of the Berlin BioScience Academy, and Trendelina Rrustemi, Senior Scientist at Alithea Biotechnology GmbH, gave an insight into their career paths at the Career Panel Talk in the BerlinBioCube start-up center building. Dr. Lohmeier explained the development opportunities offered by the Berlin BioScience Academy (BBA).
Trendelin Rrustemi presented her start-up Alithea Biotechnology GmbH. It offers pioneering HLA peptide characterization with innovative immunopeptidomics, highly sensitive mass spectrometry and applied AI.
The students were then given an insight into the start-ups CUTANEON - Skin & Hair Innovations GmbH, Cultimate Foods GmbH and FyoniBio GmbH
The BiotechPark on the Campus Berlin-Buch is one of the leading technology parks in Germany. Buch has been renowned for its clinics and cutting-edge research for around 100 years and is now one of the largest biomedical locations in Germany.
The Berlin BioScience Academy (BBA), formerly known as "Gläsernes Labor Akademie (GLA)", supports young scientists throughout Germany in their professional orientation and entry into the pharmaceutical and biotechnology industry.
www.glaesernes-labor-akademie.de
Patient care, Education / 18.06.2025
Medizin hautnah erleben
Lange Nacht der Wissenschaften im Helios Klinikum Berlin-Buch
Das Helios Klinikum Berlin-Buch öffnet am Samstag, 28. Juni von 16 bis 20 Uhr seine Türen zur Langen Nacht der Wissenschaften 2025 und lädt alle Wissbegierigen und Interessierten ein, einen spannenden und exklusiven Blick hinter die Kulissen eines modernen Krankenhauses zu werfen. Vor allem Familien dürfen sich auf ein buntes Mitmach-Programm freuen. Begleitet wird das Event obendrein von der kostenlosen Gesundheitsmeile, bei der Sie mit unseren Expert:innen persönlich ins Gespräch kommen können.
„Wir laden alle ein, einmalige Einblicke in unser Klinikum zu erhalten. Lassen Sie sich diese einmalige Möglichkeit nicht entgehen und lassen Sie sich von tollen Experimenten und interaktiven Angeboten begeistern. Entdecken Sie in Berlin-Buch die spannende Welt der Medizin“, beschreibt Klinikgeschäftsführerin Carmen Bier das vielseitige Programm am 28. Juni im Helios Klinikum Berlin-Buch.
Neugierige können an diesem Tag zum Beispiel den Mammographie-Truck besuchen oder mit der Promille-Brille den Einfluss von Alkohol- und Drogenkonsum nachempfinden. Zu den Höhepunkten der Langen Nacht der Wissenschaften zählt die Mitmach-Führung durch den Zentral-OP, dem Herzstück des Klinikums mit 20 Operationssälen.
Zahlreiche Programmpunkte sind vor allem für die ganze Familie und insbesondere für Kinder konzipiert: Kuscheltierröntgen, Teddy- und Puppenklinik, das Kindergipsen und die Führung durch den Bereich der Kinderanästhesie, wo kindgerecht vermittelt wird, wie eine Narkose funktioniert. Der Wickelkurs und Kinderwagenführerschein sind Angebote für kleine "große" Geschwister und auch zukünftige Mütter können sich auf das Babybauch-Bemalen freuen.
In diesem Jahr besucht uns nicht nur unser Maskottchen „Heli“, sondern ebenfalls die Rettungshundestaffel Barnim, die Übungen zur Ausbildung und Arbeit mit Rettungshunden samt Einsatzausrüstung zeigt. Hunde-Streicheleinheiten sind erlaubt. Radio Teddy ist mit einem bunten Sport-Spiel-Spaß-Programm dabei. Und auch die Freiwillige Feuerwehr Schönwalde zeigt vor Ort ihre Einsatzfahrzeuge inklusive echten Oldtimern. Zudem sorgt die Tanzgruppe „Passion of Dance“ aus Zepernick für gute Stimmung. Eine vielfältige kulinarische Auswahl runden das Programm ab.
Bei einigen Mitmach-Angeboten ist die Zahl der Teilnehmenden begrenzt. Hierfür wird neben einem offiziellen Ticket der Langen Nacht der Wissenschaften auch eine Online-Anmeldung über die Helios Website benötigt. Lange Nacht der Wissenschaften | Helios Klinikum Berlin-Buch
Kostenlose Gesundheitsmeile und Führungen der DRF-Luftrettung
Sie wollen unsere Hebammen persönlich kennenlernen? Mehr zum Thema Sonnenschutz und Hautkrebsvorsorge erfahren? Oder sich mit unseren Expert:innen der Augenheilkunde sowie Plastischen und Ästhetischen Chirurgie austauschen? Dann sind Sie auf unserer kostenlosen Gesundheitsmeile von 16 bis 20 Uhr genau richtig. Kommen Sie mit unseren Mitarbeitenden persönlich ins Gespräch und lernen Sie eine Vielzahl unserer über 60 Fachbereiche und Zentren sowie unser Leistungsspektrum kennen.
Ein weiteres Highlight ist die Präsentation der DRF und ihres Luftrettungs-Standortes.
Das ausführliche Programm zur Langen Nacht der Wissenschaften sowie zur Gesundheitsmeile finden Interessierte online: Lange Nacht der Wissenschaften | Helios Klinikum Berlin-Buch
Das Helios Klinikum Berlin-Buch ist ein modernes Krankenhaus der Maximalversorgung mit über 1.000 Betten in mehr als 60 Kliniken, Instituten und spezialisierten Zentren sowie einem Notfallzentrum mit Hubschrauberlandeplatz. Jährlich werden hier mehr als 55.000 stationäre und über 144.000 ambulante Patienten mit hohem medizinischem und pflegerischem Standard in Diagnostik und Therapie fachübergreifend behandelt, insbesondere in interdisziplinären Zentren wie z.B. im Brustzentrum, Darmzentrum, Hauttumorzentrum, Perinatalzentrum, der Stroke Unit und in der Chest Pain Unit. Die Klinik ist von der Deutschen Diabetes Gesellschaft als „Klinik für Diabetiker geeignet DDG“ zertifiziert. Zudem ist die Gefäßmedizin in Berlin-Buch dreifach durch die Fachgesellschaften der DGG (Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin), der DGA (deutsche Gesellschaft für Angiologie) und der DEGIR (deutsche Gesellschaft für interventionelle Radiologie) als Gefäßzentrum zertifiziert.
Gelegen mitten in Berlin-Brandenburg, im grünen Nordosten Berlins in Pankow und in unmittelbarer Nähe zum Barnim, ist das Klinikum mit der S-Bahn (S 2) und Buslinie 893 oder per Auto (ca. 20 km vom Brandenburger Tor entfernt) direkt zu erreichen.
Helios gehört zum Gesundheitskonzern Fresenius und ist Europas führender privater Gesundheitsdienstleister mit rund 128.000 Mitarbeitenden. Zu Fresenius Helios gehören die Helios Gruppe in Deutschland sowie Quirónsalud in Spanien und Lateinamerika. Rund 26 Millionen Menschen entscheiden sich jährlich für eine medizinische Behandlung bei Helios. 2024 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von mehr als 12,7 Milliarden Euro.
In Deutschland verfügt Helios über mehr als 80 Kliniken, rund 220 Medizinische Versorgungszentren (MVZ) mit etwa 570 kassenärztlichen Sitzen, sechs Präventionszentren und 27 arbeitsmedizinische Zentren. Helios behandelt im Jahr rund 5,5 Millionen Menschen in Deutschland, davon mehr als 4 Millionen ambulant. Seit seiner Gründung setzt Helios auf messbare, hohe medizinische Qualität und Datentransparenz und ist bei über 90 Prozent der Qualitätsziele besser als der bundesweite Durchschnitt. In Deutschland beschäftigt Helios rund 78.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 7,7 Milliarden Euro. Sitz der Unternehmenszentrale ist Berlin.
Quirónsalud betreibt 57 Kliniken, davon sieben in Lateinamerika, rund 130 ambulante Gesundheitszentren sowie über 300 Einrichtungen für betriebliches Gesundheitsmanagement. Jährlich werden hier rund 20 Millionen Patient:innen behandelt, davon mehr als 19 Millionen ambulant. Quirónsalud beschäftigt rund 50.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von mehr als 5 Milliarden Euro.
Fotocredit: Dirk Pagels | Helios Kliniken Bildunterschrift: Ein Highlight der Langen Nacht der Wissenschaften im Helios Klinikum Berlin-Buch ist der interaktive Rundgang durch den Zentral OP.
www.helios-gesundheit.deInnovation / 17.06.2025
Pankower Ausbildungspreis 2025 ausgelobt - Bewerbungen bis 31. Juli 2025 möglich
Ab sofort können sich Pankower Ausbildungsbetriebe für den Ausbildungspreis Pankow 2025 bewerben. Die Aktion ist Bestandteil der Ausbildungsoffensive Pankow, einer Kooperation des Bezirksamts Pankow, der Agentur für Arbeit Berlin Nord, des Jobcenters Berlin Pankow und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.
Mit dem nunmehr bereits zum 16. Mal ausgelobten Preis wird das besondere Engagement von Unternehmen in der Berufsausbildung gewürdigt. Voraussetzung für die Bewerbung ist der Sitz oder ein Standort im Bezirk Pankow, an dem ausgebildet wird. Die Verleihung erfolgt nach Betriebsgröße in drei Kategorien.
Imagefilm und Preistafel für Gewinner
Jeder Gewinner erhält einen zweiminütigen Imagefilm für das Unternehmen, eine Preistafel mit dem Firmennamen zur Wandmontage, die dauerhafte Veröffentlichung auf der Webseite www.ausbildungsoffensive-pankow.de sowie eine gerahmte und von der Bezirksbürgermeisterin Dr. Cordelia Koch unterzeichnete Urkunde. Die feierliche Preisverleihung findet im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung statt. Auch Auszubildende können ihr Ausbildungsunternehmen für den Preis vorschlagen und ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro gewinnen.
Preisverleihung am 24. September in der WABE
Bewerbungen von Unternehmen und Vorschläge für das „Azubi-Voting“ können bis zum 31.07.2025 eingereicht werden. Anmeldungen sind online unter www.ausbildungsoffensive-pankow.de/#ausbildungspreis möglich. Das Bewerbungsformular kann auch beim Projektkoordinator Stephan Schellin, E-Mail: schellin@wetek.de, angefordert werden.
Die Preisträger werden von einer unabhängigen Jury ermittelt. Die Preisverleihung findet durch die Bezirksbürgermeisterin im Rahmen der „Auftaktveranstaltung zur Ausbildungsoffensive Pankow 2025/2026“ am 24. September 2025 um 18 Uhr in der Kultureinrichtung „Wabe“, Danziger Str. 101, 10405 Berlin, statt.
Weitere Informationen unter: www.ausbildungsoffensive-pankow.de und beim Projektkoordinator Stephan Schellin, E-Mail: schellin@wetek.de Tel.: 030 2250150-41, Fax: 030 2250150-19.
Research, Innovation, Patient care / 16.06.2025
Berlin-Buch goes Boston

At BIO 2025, June 16-19 in Boston, Campus Berlin-Buch GmbH will be showcasing the location of future innovation Berlin-Buch
The BIO International Convention is the largest and most comprehensive event for biotechnology, representing the entire biotechnology scene with 20,000 industry leaders from across the globe.
Meet our Managing Director, Dr. Christina Quensel, in the German Pavilion and find out more about our innovation location. Excellent biomedical research and one of the largest biotech parks in Germany characterize the science and technology campus Berlin-Buch. It is a vibrant ecosystem - from innovations from cutting-edge research to new marketable therapies that find their way into application. Campus Berlin-Buch offers start-ups and companies from the biotech and medtech sectors state-of-the-art laboratory and office space on a gross floor area (GFA) of around 45,000 m². For start-ups, the campus offers attractive, subsidized lab and office space in the BerlinBioCube start-up center. The inspiring life science community on site enables direct exchange and joint projects.
We look forward to discussing with you how we are shaping the future of biotechnology. You will find us at booth number 2865. See you there!
Create the future of medicine in Berlin!
Research, Innovation, Patient care, Education / 13.06.2025
Experimentieren, Mikroskopieren und Chemie-Zaubershow für Kinder
Faszination Naturwissenschaften: Zur Langen Nacht der Wissenschaften am 28. Juni lädt das Gläserne Labor auf dem Campus Berlin-Buch gemeinsam mit dem Forschergarten und Partnerschulen Familien mit Kindern zum Mitmachen ein.
Im Open Lab lassen sich Labortechniken ausprobieren, in Experimentierkursen wird nach genetischen Erkrankungen gefahndet oder die Arbeit von Laktase als geheimer Held der Verdauung untersucht. Aus Algen werden Bubbles mit ph-Wert-Indikatoren hergestellt, KI ermöglicht eine Knobel-Challenge mit einem „intelligenten Einzeller“ und zwei Shows zeigen eindrucksvoll, wieviel Magie und Effekte in Chemie und Physik stecken.
Einige Highlights aus dem Programm:
Open Lab: Das Labor zum Anfassen & Probieren
Sie waren noch nie in einem Forschungslabor? Pipettieren, zentrifugieren, vortexen – entdecken Sie grundlegende Techniken im Labor. Wir nehmen Sie mit in eines unserer Labore und lassen Sie einige der gängigsten Arbeitsschritte selbst ausprobieren. Besuchen Sie das Labor zum Anfassen und Fragen stellen. Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie & Gläsernes Labor
Erwin-Negelein-Haus (D79), Erdgeschoss, ohne Anmeldung, 17:00 bis 21:00 Uhr
→ MITMACHEXPERIMENTE
pH-Wert 3.0
Die Bubbles vom Bubble Tea kennt sicherlich jeder. Wie werden diese hergestellt und wofür kann man sie nutzen? Stellen Sie selbst aus Algen Bubbles mit einem Indikator her und bestimmen Sie mit deren Hilfe den pH-Wert von unbekannten Lösungen. Finden Sie heraus was ein Indikator ist und was der pH-Wert anzeigt.
Ort: Gläsernes Labor, ab 14 Jahren. Anmeldung am Infopunkt im MDC.C erforderlich, 17:30, 19:00, 20:30, 22:00 Uhr
Gesundes Herz und gesunde Gefäße – gute Durchblutung!
Finde heraus, wie oft dein Herz in einer Minute schlägt, wie hoch dein Blutdruck ist und welche Menge an Sauerstoff in deinem Blut vorhanden ist. Mikroskopiere einen Blutausstrich und schau dir das schlagende Herz von Wasserflöhen an!
Experimentierhalle in der Mensa, Haus 14, Stempelstation für Forscherdiplom,
Partnerschule Robert-Havemann-Gymnasium, für Grundschüler und deren Eltern
Laktase – Der geheime Held Ihrer Verdauung!
Es ist Sommer, Sie genießen ein erfrischendes Eis und plötzlich meldet sich Ihr Bauch wie eine Alarmanlage. Was steckt dahinter? Das Zauberwort heißt: Laktase! Dieses Enzym sorgt dafür, dass der Milchzucker (Laktose) in verdauliche Bausteine zerlegt wird. Fehlt es, gerät der Verdauungstrakt aus dem Takt.
Finden Sie in Experimenten heraus, wie Laktase arbeitet – und warum das Fehlen dieses „Helden“ zu unangenehmen Bauchbeschwerden führen kann. Seien Sie dabei und entdecken Sie, was hinter der Laktoseintoleranz steckt!
Max Delbrück Communications Center (MDC.C), ab 14 Jahren, Anmeldung am Infopunkt im MDC.C., 18:00, 19:30, 21:00, 22:30 Uhr
Wie wird eine Erbkrankheit diagnostiziert?
In einer fiktiven Familie ist eine seltene genetische Erkrankung aufgetreten. Wer in der Familie ist Träger der verursachenden Mutation, wer hat die Krankheit geerbt, bei wem wird sie sich ausprägen? Machen Sie sich zusammen mit uns mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und Gelelektrophorese auf die Suche nach Antworten. Sie werden selbst im Labor experimentieren und viele interessante Fakten über die Arbeit im Labor erfahren.
Besuchen Sie auch den Stand der NCL-Stiftung im Erwin-Negelein-Haus (D79).
Max Delbrück Communications Center (MDC.C), ab 14 Jahren, Anmeldung am Infopunkt im MDC.C., 18:00, 19:30, 21:00, 22:30 Uhr
Ganz schön schlau: Schleimpilze, KI und Neurobiologie
Bei uns kannst du in einer Knobel-Challenge gegen den Blob antreten, spannende Einblicke in die Neurobiologie bekommen und dir ein selbst gebautes Lernmodell aus Streichholzschachteln anschauen.
Experimentierhalle in der Mensa, Haus 14, Lehrer:innen und Schüler:innen des Käthe-Kollwitz Gymnasiums, Berlin, 16:00 bis 22:00 Uhr
Farbenzauber mit Gewürzen: Entdecke den pH-Trick
Wird die Lösung leuchtend rot, sanft grün oder überraschend blau? Ist das Lieblingsgewürz eher sauer oder basisch? Mit spannenden Experimenten wird der geheime pH-Wert von Gewürzen und Pflanzen durch Indikatoren enthüllt. Dafür darf gemörsert, gemischt und einfach nur gestaunt werden. Doch was steckt hinter diesen Farbveränderungen? Die chemischen Inhaltsstoffe der Gewürze reagieren mit Indikatoren und offenbaren überraschende Ergebnisse. Zimt, Sumak oder Basilikum – jede Zutat zeigt ihr eigenes Farbspiel. Welche Kombination sorgt für den größten Wow-Effekt? Entdecke die Geheimnisse der pH-Welt.
Experimentierhalle in der Mensa, Haus 14, Partnerschule Ernst-Abbe-Gymnasium, für Grundschüler und deren Eltern, 16:00 bis 22:00 Uhr
→ SCIENCE ENTERTAINMENT
Dampf, Druck und Donnerknall - Naturwissenschaften, die bewegen!
Qualm, Laser, Schnee: Ein Potpourri von Experimenten erwartet Groß und Klein bei der Experimentalvorlesung des Schülerforschungszentrum Pankow am Robert-Havemann-Gymnasium für die ganze Familie.
Experimentierhalle in der Mensa, Haus 14, ohne Anmeldung, 16:30, 18:30 Uhr
Wissen-schafft-Spaß – CheMagie: coole Experimente und heiße Zauberei
Zauberkünstler und Biochemiker Oliver Grammel entführt Sie in die zauberhafte Welt der Chemie. Ein Wissenschaftsspaß für die ganze Familie
Max Delbrück Communications Center (MDC.C) (C83), Axon 1, ohne Anmeldung, 17:30, 19:00, 20:15 Uhr
Zum gesamten Programm des Gläsernen Labors:
https://www.glaesernes-labor.de/de/lndw-2025
Research, Patient care / 13.06.2025
Berlin Summer Meeting: Die Sequenzierung des Planeten Erde
Auf der Sommertagung des Berliner Instituts für Medizinische Systembiologie (MDC-BIMSB) am 19. und 20. Juni geht es darum, wie die Analyse von DNA und RNA die biologische Vielfalt erhalten, die Lebensmittelsicherheit gewährleisten und zur Diagnose und Prävention von Krankheiten beitragen kann.
Vergangenes Jahr berichteten japanische Forschende in der Fachzeitschrift PNAS, dass sie in Höhen bis zu 3000 Metern Hunderte verschiedener Bakterien- und Pilzarten gefunden hatten. Das Team nahm an, dass die Mikroben aus dem fast 2000 Kilometer entfernten China stammen. Besonders interessant daran ist, dass einige der gefundenen Arten wahrscheinlich in der Lage sind, beim Menschen Krankheiten zu verursachen. Der Fund wirft ein Licht auf das aufstrebende Gebiet der Umwelt-DNA (auf Englisch environmental DNA, kurz eDNA) und darauf, wie Krankheitserreger an den unwahrscheinlichsten Orten die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können.
Da die Kosten für die Sequenzierung von Nukleinsäuren auf einen noch nie dagewesenen Tiefstand gesunken sind, haben sich die Anwendungsmöglichkeiten dieser Technologien stark erweitert. „Dazu gehört auch die Entnahme von Nukleinsäureproben aus der Umwelt, die es Forschenden ermöglicht, mikrobielle und virale Gemeinschaften direkt in Boden-, Wasser- oder Luftproben zu erkennen und zu überwachen“, sagt Professor Markus Landthaler, der Leiter der Arbeitsgruppe „RNA Biologie und Posttranscriptionale Regulation“ am Max Delbrück Center. „Wir können diese Informationen zudem nutzen, um Veränderungen bei der Existenz von Krankheitserregern aufzuspüren“, fügt Landthaler hinzu.
Die Gesundheit des Ökosystems beeinflusst die Gesundheit des Menschen
Beim diesjährigen Berlin Summer Meeting des Max Delbrück Center mit dem Titel „Sequencing Planet Earth“, das am 19. und 20. Juni im MDC-BIMSB stattfindet, werden Wissenschaftler*innen erläutern, wie sie Sequenzierungstechnologien auf vielfältige Weise einsetzen, um unsere Umwelt besser zu verstehen – in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Forschende auf der ganzen Welt können heute die Genome einer Vielzahl von Arten und Systemen mit hoher Auflösung entschlüsseln. Dies hat die Sequenzierung zu einem leistungsstarken Instrument gemacht, um evolutionäre Zusammenhänge zu erkennen, ökologische Dynamiken zu verfolgen und potenzielle Krankheitserreger in Echtzeit zu überwachen.
Professorin Marion Koopmans zum Beispiel, die Leiterin des Instituts für Virusforschung der Erasmus-Universität Rotterdam in den Niederlanden, wird über ihre Forschung sprechen, bei der sie Wege der Krankheitsentstehung und -ausbreitung zwischen Tier und Mensch erforscht. Dr. Detlev Arendt, Gruppenleiter am Europäischen Labor für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg, wird seine Arbeiten vorstellen, in denen er die Zellen einfacher Meerestiere mit denen des Menschen vergleicht, um den Ursprung und die Entwicklung unseres Nervensystems zu verstehen.
Dr. Grace Androga und Brenda Kwambana Adams von der Liverpool School of Tropical Medicine und dem University College London in Großbritannien werden über den Einsatz der Genomik berichten, um wirksamere Strategien zur Bekämpfung von Krankheitsausbrüchen an Orten mit begrenzten Ressourcen zu entwickeln. Mehrere Vorträge befassen sich zudem mit KI-basierten Tools, die bei der herausfordernden Analyse von „omic“-Daten helfen sollen.
eDNA als Indikator für die Gesundheit des Ökosystems
Die Erkenntnis, dass die Gesundheit des Menschen eng mit der Gesundheit von Tieren und Ökosystemen verwoben ist, setzt sich mehr und mehr durch. Sie steht im Mittelpunkt des One-Health-Ansatzes, der durch die Anerkennung dieser Zusammenhänge auf der ganzen Welt optimale Gesundheitsergebnisse für die Menschheit erreichen will.
„Gleichzeitig ermöglichen die großen Fortschritte in den Datenwissenschaften es den Forschenden, biologische Daten in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zu verknüpfen, zu vergleichen, abzufragen und zu interpretieren“, sagt Landthaler. Er gehört dem wissenschaftlichen Komitee an, das die Tagung organisiert hat und sich aus Forschenden des Max Delbrück Centers, dem Direktor des Charité Center for Global Health sowie internationalen Partner*innen aus Brasilien, Portugal und Großbritannien zusammensetzt.
Im Hinblick auf die menschliche Gesundheit kann die Überwachung von Umweltveränderungen Wissenschaftler*innen helfen, aufkommende Bedrohungen zu erkennen, bevor sie sich zu echten Ausbrüchen ausweiten. So lassen sich beispielsweise Erkenntnisse darüber gewinnen, wie sich Antibiotika-Resistenzgene über den Boden und das Wasser verbreiten oder wie die sich ausdehnenden Städte natürliche Barrieren für Tiere und Krankheitserreger durchbrechen.
„Denken Sie zum Beispiel an den Umweltschutz. DNA- und RNA-Proben in der Umwelt zu nehmen, bietet eine einfachere Möglichkeit, die Gesundheit eines Ökosystems zu überwachen. So können wir schnell untersuchen, welche Arten vorhanden sind – ohne mühsames Zählen einzelner Organismen“, ergänzt Landthaler. „In einer Welt, die mit einem sich beschleunigenden Klimawandel und dem Verlust von Lebensräumen konfrontiert ist, was beides direkt und indirekt die menschliche Gesundheit beeinflusst, bietet die Entnahme von eDNA-Proben Forschenden eine Möglichkeit, Umweltveränderungen rasch zu erfassen und entsprechend zu reagieren.“
Was:
18th Berlin Summer Meeting – Sequencing Planet Earth
Wann:
19. Juni 2025, 9 Uhr – 20. Juni 2025, 17 Uhr
Wo:
MDC-BIMSB
Hannoversche Straße 28
10115 Berlin
Weiterführende Informationen
18th Berlin Summer Meeting – Sequencing Planet Earth
Das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft legt mit seinen Entdeckungen von heute den Grundstein für die Medizin von morgen. An den Standorten in Berlin-Buch, Berlin-Mitte, Heidelberg und Mannheim arbeiten unsere Forschenden interdisziplinär zusammen, um die Komplexität unterschiedlicher Krankheiten auf Systemebene zu entschlüsseln – von Molekülen und Zellen über Organe bis hin zum gesamten Organismus. In wissenschaftlichen, klinischen und industriellen Partnerschaften sowie in globalen Netzwerken arbeiten wir gemeinsam daran, biologische Erkenntnisse in praxisnahe Anwendungen zu überführen – mit dem Ziel, Frühindikatoren für Krankheiten zu identifizieren, personalisierte Behandlungen zu entwickeln und letztlich Krankheiten vorzubeugen. Das Max Delbrück Center wurde 1992 gegründet und vereint heute eine vielfältige Belegschaft mit rund 1.800 Menschen aus mehr als 70 Ländern. Wir werden zu 90 Prozent durch den Bund und zu 10 Prozent durch das Land Berlin finanziert.
Pressemitteilung auf der Webseite des Max Delbrück Center
Berlin Summer Meeting: Die Sequenzierung des Planeten Erde
Research, Innovation, Patient care, Education / 13.06.2025
Biomedizin zum Mitmachen
Die Lange Nacht der Wissenschaften wird 25 Jahre alt – und der Campus Berlin-Buch war von Anfang an dabei. Zum Jubiläum erwartet die Gäste am Max Delbrück Center unter anderem eine Lichtshow und Lesung, Einblicke in die Labore und Mitmach-Experimente, eine begehbare Arterie und VR-Exkursionen ins Herz.
Der Countdown bis zur Langen Nacht der Wissenschaften läuft: Am 28. Juni öffnet das Max Delbrück Center von 17:00 bis 23:00 Uhr die Labore und Gebäude auf dem Campus Buch für Gäste jeden Alters. Zum Jubiläum kostet der Berlin-weite Eintritt nur 5 Euro. Kinder unter sechs Jahren haben – wie immer – freien Eintritt. Einige Höhepunkte des Programms:
Von den Blutgefäßen bis ins Herz
Warum wir längst noch nicht alles über unsere Blutgefäße wissen, wieso sie ein zentrales Element bei vielen Erkrankungen sind und wie sie sich ihren Weg durch unseren Körper bahnen, erfahren Besucher*innen unter anderem bei einer Laborführung. Das am besten erforschte Gefäß, eine Arterie, ist als begehbares 3D-Modell im Foyer des MDC.C (Haus 83) aufgebaut – auch hier stehen Expert*innen bereit, die alles erklären.
Und wie wird aus den Erkenntnissen im Labor anwendbares Wissen in der Klinik? Alle Fragen rund um klinische Studien zu Schwangerschaft und Herz-Kreislauf-Erkrankungen beantworten Forschende an einem Mitmach-Stand direkt gegenüber. Sie zeigen zum Beispiel, welche Messungen für wissenschaftliche Studien nötig sind. Gäste können außerdem mit VR-Brillen erkunden, wie das Herz funktioniert und was während eines Infarkts geschieht.
· Laborführung: Wenn neue Blutgefäße sprießen (17:30, 19:30 und 21.30 Uhr, ab 12 Jahre, Anmeldung am zentralen Infopunkt im MDC.C)
· 3D-Modell: Die begehbare Arterie (17-23 Uhr, Foyer des MDC.C)
· Mitmachstand: „Translationale Forschung – vom Modell zum Menschen“ (17-22 Uhr, Foyer des MDC.C)
Von Miniorganen lernen
Organoide sind komplexe dreidimensionale Modelle, die im Labor zum Beispiel aus Zellen von Patientinnen und Patienten gezüchtet werden. Sie bilden einige Eigenschaften von Organen und Geweben in der Petrischale nach. Während der Langen Nacht erfahren Gäste in interaktiven Laborführungen, welche Fortschritte es bei dieser Technologie gibt, wie sie die Forscher*innen am Max Delbrück Center mithilfe von Robotern herstellen und welche Fragen zu bislang unheilbaren Erkrankungen mit den „Miniorganen“ beantworten können.
· Laborführung: „Neuromuskuläre Miniorgane“ (18:30 Uhr, ab 16 Jahren, Anmeldung am zentralen Infopunkt)
· Laborführung: „Beta-Zell-Biologie entschlüsseln, um Diabetes zu behandeln“ (18:30, 20:00 und 21:30 Uhr, ab 12 Jahre, Anmeldung am zentralen Infopunkt)
· Laborführung: „Wie entstehen Entwicklungsstörungen von Herz und Gehirn?“ (17:30; 19:00 Uhr, ab 12 Jahre, Anmeldung am zentralen Infopunkt)
Seltsame Tiere und warum sie für die Forschung spannend sind
Sie sind ziemlich schmerzfrei, sozial und doch autoritär. Sie tratschen und kuscheln gerne, werden steinalt und finden sich in völliger Dunkelheit problemlos zurecht: Nacktmulle. In einer Laborführung zeigen Forschende den Gästen, was sie von Nacktmullen für die Therapie von menschlichen Erkrankungen lernen. Und bei einer Lesung über tierische „Lebenskünstler“ mit Russ Hodge und Verleger Wolfgang Hörner erfahren Interessierte, was Nacktmulle und 13 andere Arten uns etwas über uns selbst verraten.
· Laborführung: „Nacktmulle mit Taktgefühl“ (18:30 und 20:00 Uhr, Anmeldung am zentralen Infopunkt)
· Lesung mit Russ Hodge, Galiani-Verleger Wolfgang Hörner sowie Q&A mit Forschenden: „Lebenskünstler“ (17:30 und 19:30 Uhr, Dendrit 2/3 im MDC.C)
Lichtshow, Porträt-Ausstellung und ein Pub-Quiz
Wer sind die Menschen, die unseren Körper bis ins kleinste Detail verstehen wollen? Die Therapien entwickeln, die uns allen zugutekommen? In der Porträtausstellung „Entdecker*innen | Discoverers“ stellen wir Forschende des Max Delbrück Center vor – mit Fotografien von Pablo Castagnola.
Zum Sonnenuntergang projiziert außerdem „Zelluläres Echo“ mikroskopische Aufnahmen von Zellen auf die Außenwand eines Gebäudes und transformiert sie zu einem Arrangement aus Licht und Sound. Eine Hymne auf die Vielfalt und Schönheit der Bausteine des Lebens! Und wem eher nerdige Science-Trivia liegen, der ist beim PubQuiz genau richtig.
· Ausstellung „Entdecker*innen“ ( 17-22 Uhr, Foyer im Haus 84)
· PubQuiz: „Von EKGs und 80s Hits“ (ab 21 Uhr, Terrasse hinter dem MDC.C)
· Lichtshow: „Zelluläres Echo“ (ab 22 Uhr, vor dem Erwin-Negelein-Haus)
Weiterführende Informationen:
Anfahrt zum Campus Berlin-Buch
Pressemitteilung aufd der Webseite des Max Delbrück Center
Highlights aus dem Programm des Max Delbrück Center
Innovation / 06.06.2025
Eckert & Ziegler: Illuccix® PSMA-PET Imaging Agent Receives Approval in Germany
Eckert & Ziegler (ISIN DE0005659700, SDAX) congratulates Telix Pharmaceuticals Limited (Telix) on the approval of its prostate cancer PET imaging agent, Illuccix® (kit for the preparation of gallium-68 gozetotide injection) in Germany, where Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH is the official distributor.
With Illuccix®, Eckert & Ziegler will now significantly extend its portfolio in nuclear medicine with a widely clinically validated PSMA tracer, which perfectly complements its proprietary 68Ge/68Ga Radionuclide Generator, GalliaPharm®. GalliaPharm® is widely used as a high-quality GMP grade generator for Gallium-68 in Germany and globally, supporting the production of radiopharmaceuticals for positron emission tomography (PET) imaging, particularly in oncology.
"Our collaboration with Telix on Illuccix® leverages our established distribution network and market expertise to ensure broad access to this important PSMA-PET imaging agent in Germany. This partnership reinforces our commitment to delivering advanced diagnostic solutions for prostate cancer care", commented Dr. Harald Hasselmann, CEO of Eckert & Ziegler SE.
Raphaël Ortiz, Chief Executive Officer, Telix International added: “We are pleased that Illuccix®, which has played a key role in the advancement of PSMA-PET imaging internationally, has been approved in Germany. We are looking forward to working with Eckert & Ziegler to make our gallium-based PSMA-PET imaging agent accessible here.”
About Eckert & Ziegler
Eckert & Ziegler SE, with more than 1,000 employees, is a leading specialist in isotope-related components for nuclear medicine and radiation therapy. The company offers a broad range of services and products for the radiopharmaceutical industry, from early development work to contract manufacturing and distribution. Eckert & Ziegler shares (ISIN DE0005659700) are listed in the TecDAX index of Deutsche Börse.
Source: Press Release Eckert & Ziegler
Eckert & Ziegler: Illuccix® PSMA-PET Imaging Agent Receives Approval in Germany
Living / 03.06.2025
Beginn der Hitzesaison: DRK und Bezirksamt Pankow starten 24-Stunden-Hitzeschutztelefon für Pankow
Mit steigenden Temperaturen wachsen für viele Menschen auch die Belastungen, die mit Gesundheitsgefahren verbunden sein können. Der DRK-Kreisverband Berlin-Nordost e.V. hat in Kooperation mit dem Bezirksamt Pankow daher zum 1. Juni erneut sein bewährtes Hitzeschutztelefon für den Bezirk Pankow gestartet. Das Angebot richtet sich insbesondere an ältere Menschen, Menschen mit chronischen Erkrankungen, Familien mit kleinen Kindern sowie an alle, die sich in Hitzephasen unsicher oder belastet fühlen.
Das Hitzeschutztelefon 030 8093319-14 ist rund um die Uhr erreichbar – 7 Tage die Woche vom 1. Juni bis 30. September 2025
Das Angebot ist vertraulich und kostenfrei. Es bietet Tipps zum richtigen Verhalten bei Hitze (Trinken, Lüften, Kühlen etc.) sowie erste Hinweise bei hitzebedingten Beschwerden (z. B. Schwindel, Kreislaufprobleme). Außerdem informiert das Team des Deutschen Roten Kreuzes am Telefon zu kühlen Orten und Alltagshilfen, hat ein offenes Ohr für Sorgen und Fragen. Bei Bedarf können auch weiterführende Hilfen vermittelt werden.
Im vergangenen Jahr konnten über das Hitzeschutztelefon bereits knapp 300 Menschen unterstützt werden. Auch in diesem Jahr ist das Ziel klar: Schnelle Hilfe per Anruf – denn Hitzeschutz ist Lebensschutz.
Hitzeschutztelefon ist Teil des bezirklichen Hitzeaktionsplans
Das Bezirksamt Pankow hat seinen im vergangenen Jahr erstmalig erarbeiteten Hitzeaktionsplan fortgeschrieben und um weitere Maßnahmen ergänzt. Dazu gehören neben dem Hitzeschutztelefon auch die „Kühlen Räume“ in den Rathäusern Pankow und Weißensee, am Campus Fröbelstraße und in der Stadtbibliothek in Buch. Der vollständige Hitzeaktionsplan ist auf der Website des Bezirksamts verfügbar: www.berlin.de/ba-pankow/hitzeschutz.
Auf dieser Website finden Interessierte auch Tipps für das richtige Verhalten bei großer und anhaltender Sommerhitze.
Auch die Website des DRK-Kreisverbands Berlin-Nordost e.V. bietet wichtige Informationen zum Thema Hitzeschutz: https://www.drk-berlin-nordost.de/angebote/aktuelle-angebote/hitzeschutztelefon.html
Research, Patient care / 02.06.2025
KI weist den Weg zur richtigen Therapie
Symptom-Checker aus dem Internet liegen häufig daneben. Kann KI es besser? Forschende aus dem Team von Altuna Akalin am MDC-BIMSB haben untersucht, inwieweit große Sprachmodelle Patient*innen beraten und Ärzt*innen unterstützen können. Ihre Studie ist in „npj Digital Medicine“ veröffentlicht.
Zuerst war da nur ein Stechen, ein merkwürdiges Gefühl in der Brust. Dann kam eine unerklärliche Müdigkeit hinzu. Sie sitzen auf dem Sofa und zögern. Sollen Sie ärztlichen Rat einholen? Oder warten Sie erst einmal ab? Und falls Sie eine Ärztin oder einen Arzt benötigen: Wäre eine kardiologische, eine internistische oder vielleicht doch eine neurologische Praxis die beste Anlaufstelle?
Wenn es Ihnen wie den meisten Menschen geht, suchen Sie als Erstes Rat im Internet. Zwar gibt es dort inzwischen zahlreiche Symptom-Checker, doch diese sind selten akkurat. Eine Studie aus dem Jahr 2022 hat ergeben, dass digitale Symptom-Checker die richtige Diagnose nur in 19 bis 38 Prozent der Fälle an erster Stelle nennen. Werden die ersten drei Vorschläge berücksichtigt, ist die passende Diagnose zwar häufiger dabei, aber auch nur in 33 bis 58 Prozent aller Anfragen.
In einer im Fachblatt „npj Digital Medicine“ veröffentlichten Studie hat ein Team um Farieda Gaber aus dem Labor von Dr. Altuna Akalin, dem Leiter der Technologieplattform „Bioinformatics and Omics Data Science“ am Berliner Institut für Medizinische Systembiologie des Max Delbrück Center (MDC-BIMSB), jetzt untersucht, ob große Sprachmodelle (Large Language Models, kurz LLMs) mehr leisten können. Genauer gesagt sind die Forschenden der Frage nachgegangen, wie gut LLMs Patient*innen und Ärzt*innen den Weg zur passenden Therapie weisen können.
„Studien zeigen, dass bis zu 30 Prozent der Besuche in Notaufnahmen nicht notwendig sind“, sagt Akalin, der korrespondierender Autor der Studie ist. „Wenn LLMs helfen könnten, diese Zahl zu reduzieren, würde das zur Entlastung der Gesundheitssysteme beitragen.“
Für seine Studie verglich das Team die Ergebnisse von vier Varianten von Claude, einem von der US-Firma Anthropic entwickelten Sprachmodell, mit 2.000 realen Fällen aus Notaufnahmen. Die Daten dazu entstammen der MIMIC-IV-ED-Datenbank, einer großen öffentlichen Sammlung anonymisierter Gesundheitsdaten aus dem Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston.
Die Modelle sollten drei Dinge tun: die passende Fachärztin oder den passenden Facharzt vorschlagen, eine Diagnose stellen und die Dringlichkeit des Falles beurteilen. Diese Einschätzung wird auch als Triage bezeichnet. Es wurden zwei Szenarien durchgespielt. Das erste Szenario simulierte eine Situation, in der sich eine Patientin oder ein Patient zu Hause befand, sodass nur Symptome und demografische Daten vorlagen. Das zweite ahmte die Situation in einer ärztlichen Praxis nach, wodurch zusätzlich Vitalparameter wie Herzfrequenz und Blutdruck verfügbar waren.
Das passende Fachgebiet
Anders als in Deutschland, wo Patient*innen in der Regel eine Überweisung von ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt benötigen, können Menschen in vielen anderen Ländern direkt eine fachärztliche Praxis aufsuchen. Es kann jedoch schwierig sein, herauszufinden, welche Spezialist*innen für die jeweiligen Beschwerden am geeignetsten sind. Ist eine gastroenterologische Praxis die beste, wenn es um Bauchschmerzen geht? Oder wäre ein nephrologische die bessere Wahl?
Bei dieser Aufgabe erwiesen sich die LLMs als sehr zuverlässig. Wurden nur Symptome genannt, wählte das Modell Claude 3.5 Sonnet beispielsweise in etwa 87 Prozent der Fälle bei seinen ersten drei Vorschlägen ein geeignetes Fachgebiet aus. Die anderen Modelle schnitten ähnlich gut ab. Die Genauigkeit der LLMs verbesserte sich geringfügig, wenn sie zusätzliche Informationen zu den Vitalparametern der Patient*innen erhielten. Die Ärzt*innen, die die KI-Vorschläge überprüften, waren sich einig: Sie bewerteten 97 Prozent der Empfehlungen als genau oder zumindest als klinisch akzeptabel.
Die richtige Diagnose
Auch bei der Diagnose schnitten die Modelle gut ab. Die beste Version erkannte die richtige Erkrankung in mehr als 82 Prozent der Fälle. Die Genauigkeit stieg weiter, wenn die Vitalparameter vorlagen – insbesondere bei der RAG-Variante (Retrieval Augmented Generation), die bei ihrer Entscheidungsfindung auf eine Datenbank mit rund 30 Millionen PubMed-Abstracts zurückgreifen kann.
Wie gut die KI-Diagnosen mit dem menschlichen Urteil übereinstimmten, prüften die Forschenden auf zwei verschiedene Arten. In der einen Variante, bei der eine Vorhersage als richtig galt, wenn mindestens eine*r von zwei unabhängigen Ärzt*innen ihr zustimmte, war sich die KI in mehr als 95 Prozent der Fälle mit dem menschlichen Urteil einig. In der anderen, strengeren Variante, bei der beide Ärzt*innen dem KI-Urteil zustimmen mussten, betrug die Übereinstimmung immerhin gut 70 Prozent.
Die Triage bleibt knifflig
Bei der Beurteilung der Dringlichkeit eines Falls waren die Modelle weniger akkurat. Zwar verwechselte keines von ihnen einen lebensbedrohlichen Zustand mit einem harmlosen, aber mittelschwere Fälle schätzten sie oft falsch ein. Das ist wichtig, denn sowohl eine Übertriagierung – die Bevorzugung stabiler Patient*innen – als auch eine Untertriagierung – die verzögerte Behandlung schwerer Fälle - können den Betroffenen schaden. In der Notfallversorgung wird eine Abweichung von weniger als 5 Prozent angestrebt; dieses Ziel erreichte in der Studie keines der Modelle.
Auch hier schnitten die LLMs, die Zugang zu den Vitaldaten hatten, allerdings besser ab. Das deutet den Forschenden zufolge darauf hin, dass sich die Resultate, die per KI erzielt werden können, weiter verbessern lassen, wenn noch mehr in medizinischen Tests gewonnene Daten in die Modelle eingespeist werden.
KI kann Ärzt*innen nicht ersetzen, aber unterstützen
„Wir empfehlen natürlich nicht, Ärzt*innen durch KI-Tools zu ersetzen“, sagt Akalin. „Aber gut konzipierte, rigoros getestete LLMs könnten für Mediziner*innen eine hilfreiche Unterstützung sein, insbesondere für die noch weniger erfahrenen unter ihnen.“ Er und seine Kolleg*innen würden sich zudem wünschen, dass Patient*innen Zugriff auf bestimmte Arten von LLMs erhalten – insbesondere auf solche, die bei der Suche nach Fachärzt*innen helfen. Die Modelle könnten die weniger präzisen Symptom-Checker ersetzen und bei der Frage, ob und wo man sich behandeln lassen sollte, behilflich sein. Indem LLMs unnötige Arzt- und Krankenhausbesuche reduzieren, könnten sie zudem die Gesundheitssysteme entlasten, fügt Akalin hinzu.
Bevor solche Werkzeuge offiziell genutzt werden dürfen, müssen strenge regulatorische Standards gemäß dem EU-Gesetz über künstliche Intelligenz erfüllt sein. Dennoch warnen die Autor*innen vor einem unsicheren Einsatz, wenn öffentlich verfügbare KI-Tools informell im klinischen Umfeld eingesetzt werden. „Deshalb ist ein offenes, strenges Benchmarking so wichtig“, sagt die Erstautorin der Studie, Gaber. „Forschung wie diese hilft uns, sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen von KI-gestützten medizinischen Entscheidungen zu verstehen.“
Akalin und sein Team planen, den Wert von LLMs sowohl für Patient*innen als auch für Ärzt*innen in realen Umgebungen, zum Beispiel in ärztlichen Praxen, mithilfe der in seinem Labor entwickelten Plattform 2ndOpin.io weiter zu testen. „Die nächste Frage lautet: Wenn wir ein solches Tool bauen, ist es dann wirklich nützlich?“, sagt er. LLMs, die die Patientenversorgung verbessern, sind ein Forschungsschwerpunkt von Akalin, der auch onconaut.ai entwickelt hat – ein KI-basiertes Online-Tool für Ärzt*innen und Patient*innen, das helfen kann, sich besser in personalisierten Krebstherapien zurechtzufinden. Krebspatient*innen können dort beispielsweise ihren Biomarker-Status eingeben und eine Liste der klinischen Studien finden, für die sie in Frage kommen.
Akalin und sein Team haben das Tool kürzlich verbessert, indem sie ihm beigebracht haben, all die verschiedenen Abkürzungen zu erkennen, die für ein und denselben Biomarker stehen – Rechtschreibfehler inbegriffen. Dadurch können Patient*innen, die nach klinischen Studien suchen, noch sicherer sein, dass sie eine vollständige Liste der Studien erhalten. Die verbesserte Suchfunktion von Onconaut haben die Forschenden kürzlich ebenfalls in „npj Digital Medicine“ beschrieben.
Weiterführende Informationen
Mit KI die passende Krebstherapie finden
Literatur
Farieda Gaber, Maqsood Shaik, Fabio Allega, et al. (2025) “Evaluating large language model workflows in clinical decision support for triage and referral and diagnosis,” npj Digital Medicine DOI:10.1038/s41746-025-01684-1
Research / 31.05.2025
Joint Berlin Data & AI Center planned
Data-driven research is crucial for tackling societal challenges. In a collaboration that is so far unique, Berlin's Universities of Excellence, the Max Delbrück Center, and the Helmholtz-Zentrum Berlin, together with the Zuse Institute Berlin, aim to establish a powerful Data and AI Center.
The Helmholtz-Zentrum Berlin for Materials and Energy (HZB), the Max Delbrück Center for Molecular Medicine in the Helmholtz Association, Berlin's Universities of Excellence including Charité – Universitätsmedizin, and the Zuse Institute Berlin (ZIB) recently signed a joint declaration of intent for this purpose. The goal is a flagship project of outstanding importance for the future of Berlin as a research hub.
The partners aim to create a regionally anchored and internationally competitive infrastructure that enables high-performance, cross-institutional, data-driven cutting-edge research. It will effectively complement the national high-performance infrastructure at the ZIB. The partners agree that complex scientific simulations and the use of artificial intelligence in particular require new, high-performance data infrastructures. Joint planning and use of resources represents a particularly sustainable approach.
A high-performance data center
As a first step, a new high-performance research Data Center is to be built at the HZB site in Berlin-Adlershof in cooperation with the ZIB. The HZB and ZIB have been engaged in intensive planning for the past year and aim to implement the first phase of the data center as quickly as possible. In the long term, computing capacity is to be expanded to up to 5 megawatts through new construction.
In the next phase, the partners will jointly explore potential funding models, administrative structures, and usage scenarios. These will be incorporated into a detailed cooperation agreement to ensure long-term, cross-institutional access to and operation of the Data Center.
Karsten Häcker, Chief Information Officer (CIO) at the Max Delbrück Center, emphasizes that the Berlin science network BRAIN is a crucial component for the technical implementation. After all, the fiber optic network financed by the Berlin Senate connects all the locations of scientific institutions in Berlin. “We are very much looking forward to working together,” he says. “In this project, we are collaborating even more closely with the ZUSE Institute and, for the first time, with the data center infrastructures of the other institutions.”
Further information
Research, Patient care, Education / 30.05.2025
Wissen auf die Ohren
Im Gläsernen Labor ist ein neuer Podcast entstanden. In den ersten drei Folgen von „scienceCLASH“ haben Schüler*innen aus Berlin Sarah Kedziora und Theda Bartolomaeus vom ECRC zum Thema Mikrobiom und Herzgesundheit befragt. Ziel des Projekts ist es, junge Menschen für die Forschung zu begeistern.
Was passiert, wenn Schüler*innen auf echte Forschende treffen und ihnen genau die Fragen stellen, die ganz viele – und nicht nur junge – Menschen beschäftigen? Die Antwort liefert „scienceCLASH“, ein neuer Podcast, der im Gläsernen Labor auf dem Campus Berlin-Buch entstanden ist.
Das Gläserne Labor ist das gemeinsame Schüler*innenlabor von Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (Max Delbrück Center), Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP) und Campus Berlin-Buch GmbH. Die Idee zum Podcast hatte Dr. Joanna Ziomkowska, die einst selbst Wissenschaftlerin war und heute in Berlin als Lehrerin arbeitet. Zu hören ist das Ergebnis überall da, wo es Podcasts gibt, und demnächst sogar im Radio.
In den ersten drei Folgen von „scienceCLASH“ dreht sich alles um das Mikrobiom und um die spannende Frage, wie die winzigen Mitbewohner im Darm sogar die Gesundheit des Herzens beeinflussen. Helene, Til und Mijo, Schüler*innen im Biologie-Leistungskurs am Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Berlin, unterhalten sich darüber mit Dr. Sarah Kedziora und Dr. Theda Bartolomaeus.
Kedziora ist Molekularbiologin, Bartolomaeus Bioinformatikerin. Beide forschen in der Arbeitsgruppe „Hypertonie bedingte Endorganschäden“ von Professor Dominik Müller und Professor Ralf Dechend am Experimental and Clinical Research Center (ECRC), einer gemeinsamen Einrichtung von Charité – Universitätsmedizin Berlin und Max Delbrück Center. Wissenschaftlich begleitet wurde das Projekt von Dr. Florian Herse aus dem gleichen Team.
Bakteriensuche im Stuhl
„Geplant ist, dass jede Staffel des Podcasts aus drei Folgen besteht“, erklärt Ziomkowska, die „scienceCLASH“ koordiniert, produziert und auch die Gespräche zwischen den Schüler*innen und Forscherinnen moderiert hat. „In der ersten Folge gibt es einen Einstieg in das Thema, in der zweiten einen Einblick in die Forschung und in der dritten einen Faktencheck zum Alltagswissen.“
Für den Einblick in die Forschung konnten sich Helene, Til und Mijo zunächst für ein paar Stunden wie echte Proband*innen einer klinischen Studie fühlen. Studienschwester Heike Schenck prüfte mit den unterschiedlichsten Methoden die Gesundheit ihres Herzens. Im Anschluss hatte Sarah Kedziora ein Experiment aus ihrer Forschung mitgebracht: Mithilfe der qPCR prüften die Schüler*innen im Gläsernen Labor, welche Bakterienarten in Stuhlproben, aus denen sie isolierte DNA erhalten hatten, vorhanden waren.
Ein Podcast für alle
Ein bisschen eklig, aber doch faszinierend: „Alle drei waren mit Begeisterung dabei und auch mir hat das gesamte Projekt wirklich sehr viel Spaß gemacht“, sagt Kedziora. „Ich kann daher allen Kolleg*innen nur empfehlen, sich für eine der nächsten Staffeln mit ihrer eigenen Forschung anzubieten.“ Denn weitergehen soll das Projekt auf jeden Fall. „Bisher ist die Resonanz richtig gut“, sagt Ziomkowska. „Viele Menschen, auch Erwachsene, haben den Podcast gehört und mir gesagt, dass sie danach das Gefühl gehabt hätten, Wissenschaft endlich mal richtig verstanden zu haben.“
Für die kommende Staffel schwebt Ziomkowska das Thema KI und Neurobiologie vor. Ungeklärt ist bislang die weitere Finanzierung des Projekts. Unterstützer der ersten Staffel war der Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland (VBIO). „Ich bin derzeit auf der Suche nach neuen Fördermitteln und habe mich auch deshalb mit scienceCLASH unter anderem bei dem Wettbewerb Fast Forward Science beworben“, sagt Ziomkowska. Die Siegerbeiträge werden im Laufe des Sommers bekanntgegeben.
Text: Anke Brodmerkel
scienceCLASH im Radio
Wann: Freitag, 04.07.2025, 11-13 Uhr und 19-21 Uhr
Wo: ALEX Berlin, UKW (91,0 MHz), Kabel (92,6 MHz) und DAB+ (Kanal 7D)
scienceCLASH
Fast Forward Science
Quelle: Gläesernes Labor
Wissen auf die Ohren
Innovation / 30.05.2025
Eckert & Ziegler Organizes Third Boston Radionuclide Theranostics Forum
BOSTON, Mass., 30 May 2025. Eckert & Ziegler successfully completes the 3rd annual Boston Radionuclide Theranostics Forum, underscoring its continued leadership in the radiopharmaceutical industry. Building upon the success of the previous editions, this year's event gathered around 100 decision makers, renowned experts, key partners, and influential industry leaders to explore the transformative potential of radionuclides in precision oncology.
Held on May 29, 2025, the Forum focused on the central question whether radionuclide theranostics is coming of age discussing its potential and recent successes as a transformative force in precision oncology. Through insightful panel discussions and expert-led presentations, participants examined advancements in radiopharmaceuticals and supply chain questions as well as challenges in clinical development. Another key discussion focused on deal stories in the radiotherapeutic field. The full 2025 agenda is available here.
“The rapid growth and innovation in the radiopharmaceutical market are undeniable,” said Dr. Harald Hasselmann, CEO of Eckert & Ziegler SE. “Organizing the third edition of the Boston Radionuclide Theranostics Forum reinforces our commitment to advancing precision oncology. The discussions and collaborations emerging from this platform have the potential to accelerate progress and expand patient access to life-changing therapies.”
The Boston Radionuclide Theranostics Forum is initiated and created by Eckert & Ziegler, sponsored by Solomon Partners, hosted by Morrison Foerster and organized with the support of the German American Business Council of Boston. It has established itself as a premier event on the nuclear medicine calendar. The half-day gathering featured insights from over a dozen international experts representing clinical practice, industry innovation, and cutting-edge research. With engaging dialogue and strategic networking opportunities, the Forum continues to serve as a vital platform for shaping the future of radiotheranostics.
The event was held by invitation only and once again achieved full attendance, reflecting the strong interest and commitment of the global radiopharmaceutical community. The next edition of the Forum is scheduled for May 28, 2026, as Eckert & Ziegler remains dedicated to fostering collaboration and driving innovation in precision oncology worldwide.
About Eckert & Ziegler
Eckert & Ziegler SE, with more than 1,000 employees, is a leading specialist in isotope-related components for nuclear medicine and radiation therapy. The company offers a broad range of services and products for the radiopharmaceutical industry, from early development work to contract manufacturing and distribution. Eckert & Ziegler shares (ISIN DE0005659700) are listed in the TecDAX index of Deutsche Börse.
Contributing to saving lives
Living / 28.05.2025
Schutzmaßnahme für den Scharlachroten Plattkäfer im Schlosspark Buch
Im Schlosspark Buch wurde im Zuge von Baumfällarbeiten, die im Februar 2025 durchgeführt wurden, der seltene und streng geschützte Scharlachrote Plattkäfer (Cucujus cinnaberinus) entdeckt. Um den Fortbestand dieser gefährdeten Art zu sichern, wird der betreffende Bereich ab der 23. Kalenderwoche 2025 durch Beschäftigte des Straßen- und Grünflächenamts eingezäunt.
Zum Einsatz kommt ein Staketenzaun aus Holz, der sich harmonisch in das historische und landschaftlich gestaltete Gesamtbild des Schlossparks einfügt. Diese zurückhaltende, naturnahe Einfriedung gewährleistet den nötigen Schutz für das Habitat des Käfers, ohne die ästhetische Wirkung des denkmalgeschützten Parks zu beeinträchtigen. Die Materialkosten belaufen sich auf rund 3.500 Euro.
Besonderer Schutz der Population
Der Scharlachrote Plattkäfer ist gemäß der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union in den Anhängen II und IV gelistet und unterliegt somit besonderen Schutzbestimmungen. Er lebt bevorzugt unter der Rinde von toten oder absterbenden Laubbäumen und spielt eine bedeutende Rolle im ökologischen Gleichgewicht, indem er zur Zersetzung von Totholz beiträgt und damit Lebensräume für weitere Arten schafft.
„Die Errichtung des Schutzzauns, die in enger Abstimmung mit den zuständigen Fachämtern erfolgt, dient der Sicherung eines geeigneten Lebensraums für diese seltene Käferart. Der Zaun wird für einen Zeitraum von drei Jahren bestehen bleiben, um eine ungestörte Entwicklung der Population zu ermöglichen“, erklärt Manuela Anders-Granitzki, Bezirksstadträtin für Ordnung und Öffentlicher Raum.
Das Bezirksamt Pankow bittet alle Besucherinnen und Besucher des Schlossparks um Verständnis und darum, die Absperrung zu respektieren. Mit ihrer Rücksichtnahme leisten sie einen wertvollen Beitrag zum Schutz der biologischen Vielfalt in unserer Region.
Research, Innovation, Patient care, Education / 26.05.2025
Erfolgreicher Weiterbildungstag "Labor 4.0" mit Schwerpunkt KI
Technische Angestellte und Laborkräfte in den Life Sciences erhielten am 23. Mai 2025 auf dem Campus Berlin-Buch einen geballten, praxisnahen Überblick über modernste Techniken und Themen in den Life Sciences.
Schwerpunktthema in den Vorträgen, Workshops, Methodentrainings, Laborführungen und in einer Panel-Diskussion war, wie Künstliche Intelligenz (KI) das Labor erobert und welche Chancen und Anforderungen KI mit sich bringt. Dr. Stephan Gantner, Vorstandsvorsizender des AK –BTA im VBIO e.V., umriss diese Entwicklung in seiner Keynote „Die Zukunft startet jetzt – Wie KI das Labor erobert“.
Prozesse erleichtern und optimieren mit KI
Mit Hilfe von Assistenzwerkzeugen lassen sich Routineaufgaben effizienter gestalten, Prozesse verbessern und die Qualität wissenschaftlicher Arbeit steigern. Maik Lange von der Bayer AG erläuterte zum Beispiel in seinem Workshop konkrete Möglichkeiten, KI zu nutzen, etwa einen eigenen Assistenten im Laboralltag zu schaffen oder Avatare, mit deren Hilfe komplexe Texte schnell erschlossen werden können. Über den Einsatz von GPT im Laboralltag – bei der Versuchsdokumentation und Fehleranalyse, der Optimierung von Protokollen und der schnellen Recherche wissenschaftlicher Informationen – sprach Dr. Hans-Joachim Müller von Promega.
KI-gesteuerte Software-Tools und maschinelles Lernen können helfen, die Ergebnisse des Next Generation Sequencing (NGS) effizient auszuwerten und zu interpretieren. Dr. Michael Becker von der Firma Experimentelle Pharmakologie und Onkologie Berlin, gab eine Einführung in die aktuellen Methoden des NGS, dessen Anwendung in Forschung und Diagnostik und in den Beitrag, den die KI dabei leisten kann.
Wer chemische Verbindungen und deren räumliche Verteilung in einer Probe mit der bildgebenden Methode MALDI (Matrix-unterstützter Laser Desorption/Ionisation) analysiert, kann dabei von KI profitieren, wie Dr. Benjamin Hempel von der FU Berlin in seinem Workshop zeigte.
Dr. Ruben Prange von Qiagen stellte die Anwendung und die Vorteile Nanoplatten-basierter digitaler PCR vor. Vorteile durch Automatisierung waren Gegenstand bei den Themen Liquid Handling oder der Herstellung von CAR-T-Zellen für klinische Prüfungen.
Core-Units auf dem Campus Berlin-Buch
Die Teilnehmenden lernten auf Führungen spannende Forschungsplattformen des Campus am Max Delbrück Center und am Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie kennen: Experimentelle Ultrahochfeld-MR, Kryo-Elektronen-Mikroskopie, NMR-Spektroskopie, Massenspektrometrie und die Facility für Cellular Imaging.
Von Nachhaltigkeit bis Softskill-Training
Thema der Weiterbildung waren neben KI, Digitalisierung und Bioinformatik auch Nachhaltigkeit im Labor, 3D-Druck – vom Kunststoff bis Bioprinting oder eine Einführung in die Technologie CRISPR/Cas.
Eine flankierende Industrieausstellung bot zusätzlich die Möglichkeit, sich über neueste Technologien zu informieren. Das Programm wurde abgerundet durch eine Führung über den Wissenschafts- und Biotechcampus sowie Softskill-, Entspannungs- und Networking-Angebote.
Der Weiterbildungstag „Labor 4.0“ findet alle zwei Jahre statt und bietet die einzigartige Gelegenheit für Technische Angestellte und Laborkräfte aus ganz Deutschland, sich zu aktuellen Themen in den Life Sciences weiterzubilden und zu vernetzen. Ermöglicht wird dies durch unsere Kooperations- und Sponsoringpartner*, die auch die Industrieausstellung mitgestalteten und Fachreferenten beisteuerten.
Veranstalter war auch in diesem Jahr die Gläsernes Labor Akademie (GLA), nach einem Marken-Relaunch umbenannt in „Berlin BioScience Academy“ (BBA).
Wir danken allen Referent:innen, Workshop-Anbietenden und Ausstellenden für den sehr gelungenen Weiterbildungstage! Bei allen Teilnehmenden bedanken wir uns für ihr Kommen und die aktive Mitwirkung!
*Brand GmbH + Co. KG, Wertheim; Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe; Collaborative Drug; Discovery, Inc., Cambridge (UK); IntegraBioSciences GmbH, Biebertal; Promega GmbH, Walldorf; Qiagen GmbH, Hilden; Thermo fisher Sicentific, Darmstadt
Research / 26.05.2025
First vascularized model of stem cell islet cells

Researchers led by Maike Sander, Scientific Director of the Max Delbrück Center, have developed a vascularized organoid model of hormone secreting cells in the pancreas. The advance, published in “Developmental Cell,” promises to improve diabetes research and cell-based therapies.
An international team of researchers led by Max Delbrück Center Scientific Director Professor Maike Sander has for the first time developed an organoid model of human pluripotent stem cell-derived pancreatic islets (SC-islets) with integrated vasculature. Islets are cell clusters in the pancreas that house several different types of hormone-secreting cells, including insulin-producing beta cells. Researchers in the Sander lab at the University of California, San Diego, found that SC-islet organoids with blood vessels contained greater numbers of mature beta cells and secreted more insulin than their non-vascularized counterparts. The vascularized organoids more closely mimicked islet cells found in the body. The study was published in “Developmental Cell.”
“Our results highlight the importance of a vascular network in supporting pancreatic islet cell function,” says Sander. “This model brings us closer to replicating the natural environment of the pancreas, which is essential for studying diabetes and developing new treatments.”
Engineering vascularized stem cell islets
SC-islet cell organoids – mini-organs that mirror the insulin producing cell clusters outside the body – are widely used to study diabetes and other pancreatic endocrine diseases. But beta cells in these organoids are typically immature, making them suboptimal models for the in-vivo environment, says Sander. Although several approaches have been developed to promote beta cell maturation, their effects have been modest, she adds.
To better mimic the in-vivo environment, the researchers added human endothelial cells, which line blood vessels, and fibroblasts, cells that help form connective tissue, to islet organoids grown from stem cells. The team experimented with different cell culture media until they found a cocktail that worked. The cells not only survived, but matured and grew a network of tube-like blood vessels that engulfed and penetrated the SC-islets.
“Our breakthrough was devising the recipe,” Sander says. “It took five years of experimenting with various conditions, involving a dedicated team of stem cell biologists and bioengineers.”
Vascularized stem cell islet organoids are more mature
When the researchers compared vascularized organoids to non-vascularized organoids, they found the former secreted more insulin when exposed to high levels of glucose. “Immature beta cells don’t respond well to glucose. This told us that the vascularized model contained more mature cells,” says Sander.
The researchers next wanted to explore how specifically vasculature helps organoids to mature. They found two key mechanisms: Endothelial cells and fibroblasts help build the extracellular matrix – a web of proteins and carbohydrates at cell surfaces. The formation of the matrix itself is a cue that signals cells to mature. Secondly, endothelial cells secrete Bone Morphogenetic Protein (BMP), which in turn stimulates beta cells to mature.
Recognizing that mechanical forces also stimulate insulin secretion, the team then integrated the organoids into microfluidic devices, allowing nutrient medium to be pumped directly through their vascular networks. They found that the proportion of mature beta cells increased even further.
“We found a gradient,” says Sander. “Non-vascularized organoids had the most immature cells, a greater proportion matured with vascularization, and even more matured by adding nutrient flow through blood vessels. A human cell model of pancreatic islets that closely replicates in-vivo physiology opens up novel avenues for investigating the underlying mechanisms of diabetes,” she adds.
In a final step, the researchers showed that vascularized SC-islets also secrete more insulin in-vivo. Diabetic mice grafted with non-vascularized SC-islets fared poorly compared to those grafted with vascularized SC-islet cells, with some mice showing no signs of the disease at 19-weeks post-transplant. The research supports other studies that have shown that pre-vascularization improves the function of transplanted SC-islets.
A better model to study Type 1 diabetes
Sander now plans to use vascularized SC-islet organoid models to study Type-1 diabetes, which is caused by immune cells attacking and destroying beta cells in the pancreas – in contrast to Type-2 in which the pancreas produces less insulin over time and the body’s cells become resistant to the effects of insulin.
She and her team at the Max Delbrück Center are growing vascularized organoids from the cells of patients with Type-1 diabetes. They are transferring the organoids onto microfluidic chips and adding patients’ immune cells. “We want to understand how the immune cells destroy beta cells,” Sander explains. “Our approach provides a more realistic model of islet cell function and could help develop better treatments in the future.”
Text: Gunjan Sinha
Picture: Researchers have devised the right conditions to grow vascularized stem cell islets. The image shows vasculature (red) tightly wrapped around insulin-producing cells (green) in the islets (blue). © Sander lab
Further information
Sander Lab
Pancreatic Organoid Research and Disease Modeling
The innovator: Profile of Maike Sander
Literature
Yesl Jun, Kim Vy, et al. (2025): “Engineered vasculature induces functional maturation of pluripotent stem cell-derived islet organoids.” Developmental Cell. DOI: 10.1016/j.devcel.2025.04.024
www.mdc-berlin.deInnovation / 23.05.2025
Eckert & Ziegler Wins “Best Managed Companies Award” for the Second Time
Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700) has once again been honored with the “Best Managed Companies Award”. The award, presented by Deloitte Private, UBS, the Frankfurter Allgemeine Zeitung and the Federation of German Industries (BDI), recognize excellently managed medium-sized companies throughout Germany. Eckert & Ziegler has now received this coveted award the second time.
The award is the result of a comprehensive, multi-stage application process in which companies are assessed for their excellence in the core areas of strategy, productivity and innovation, culture and commitment as well as finance and governance. A consistently high level of performance in all four categories is a prerequisite for selection. The final decision is made by an independent jury made up of renowned experts from business, science and the media.
“We are proud to once again receive the “Best Managed Companies Award,” says Dr. Harald Hasselmann, CEO of Eckert & Ziegler SE. " The award encourages us to continue expanding our leading position as a supplier of isotopes for nuclear medicine and measurement technology. I would like to thank our more than 1,000 employees worldwide who have contributed significantly to this success.”
“Strategic foresight and innovative strength are the key characteristics of a Best Managed Company such as Eckert & Ziegler. The award winners navigate the constantly changing market conditions with foresight, set trends in a dynamic environment, and shape the future with the necessary caution. Eckert & Ziegler demonstrates how companies in their region can make a significant contribution to development and open up new perspectives for the economy and society,” emphasizes Dr. Christine Wolter, Partner and Lead at Deloitte Private.
About Eckert & Ziegler.
Eckert & Ziegler SE with more than 1.000 employees, is a leading specialist for isotope-related components in nuclear medicine and radiation therapy. The company offers a broad range of services and products for the radiopharmaceutical industry, from early development work to contract manufacturing and distribution. Eckert & Ziegler shares (ISIN DE0005659700) are listed in the TecDAX index of Deutsche Börse.
Source: Pressemitteilung Eckert & Ziegler SE
Eckert & Ziegler Wins “Best Managed Companies Award” for the Second Time
Research / 22.05.2025
Millionenförderung für zwei Exzellenzcluster
Das Max Delbrück Center ist Partner in zwei erfolgreichen Berliner Exzellenzclustern: ImmunoPreCept und NeuroCure. Die Forscher*innen arbeiten alle an einem Ziel: Wie können wir möglichst lange gesund bleiben oder zumindest Folgeschäden von Erkrankungen verhindern?
Die Entscheidung ist gefallen: Im Wettbewerb der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern werden fünf Cluster aus Berlin ab Januar 2026 für sieben Jahre mit jeweils bis zu zehn Millionen Euro gefördert. Die Partner der Berlin University Alliance waren mit drei neuen Anträgen und sieben bestehenden Vorhaben ins Rennen gegangen. Das Max Delbrück Center ist an zwei der nun geförderten Cluster beteiligt. Die Vollanträge hat eine Committee of Experts begutachtet. Auf der Basis ihrer Empfehlungen hat die Exzellenzkommission bestehend aus dem Committee of Experts sowie den für Wissenschaft zuständigen Ministerinnen und Ministern des Bundes und der Länder am 22. Mai 2025 ausgewählt, welche neuen und welche bestehenden Exzellenzcluster den Zuschlag bekommen.
„Der Wissenschaftsstandort Berlin zeigt, dass die Zusammenarbeit über Institutsgrenzen hinweg ein Schlüssel zum Erfolg ist. Ganz besonders freut mich, dass unser Zentrum an zwei geförderten Clustern beteiligt ist – in enger Kooperation mit der Charité und den Universitäten. Mein Glückwunsch und Dank gilt allen, die mit unermüdlichem Einsatz an diesen Anträge mitgewirkt haben“, sagt Professorin Maike Sander, die Vorstandsvorsitzende des Max Delbrück Center. „Die Zellen in unserem Körper, unsere Gewebe und Organe, sind nicht entweder gesund oder krank – die Realität ist viel komplexer. Dank neuester Technologien können wir jetzt ganz genau hinschauen und zum Beispiel schon die ersten Abweichungen erkennen.“
Molekulare Prävention ermöglichen
Hier setzt das Exzellenzcluster ImmunoPreCept an. Die meisten chronisch-entzündlichen Erkrankungen bahnen sich über Jahrzehnte an, bis sie symptomatisch werden. ImmunoPreCept, ein Konsortium aus Systemmedizin, klinischer und experimenteller Medizin, will daher die Phase vor der Erkrankung in den Fokus stellen: Was schützt die einen und hält sie gesund? Und wie kann man bei den anderen bereits die ersten Veränderungen in Richtung Krankheit erkennen, bevor der Körper Schaden nimmt? Im Gegensatz zur herkömmlichen Reparaturmedizin bietet dieser Ansatz die Chance, Krankheiten wie chronische Entzündungen oder Krebs frühzeitig abzufangen oder gezielt durch die Stärkung von Abwehrkräften zu verhindern. Das Ziel ist eine molekulare Prävention. Ein weiterer Schwerpunkt der Forscher*innen ist die Phase der Remission – also jene Ruhepause nach einer Erkrankung, die sich trotz erfolgreicher Therapie vom wirklich gesunden Zustand unterscheidet.
Die Sprecher*innen sind Professorin Britta Siegmund, Professor Andreas Diefenbach (beide Charité – Universitätsmedizin Berlin) und Professor Nikolaus Rajewsky (Max Delbrück Center). Förderinstitutionen: Charité und Max Delbrück Center. Berlin Institute of Health in der Charité (BIH), Deutsches Rheuma-Forschungszentrum (DRFZ), Freie Universität Berlin (FU), Humboldt-Universität zu Berlin (HU), Max-Planck-Institut für molekulare Genetik (MPI-MG), Museum für Naturkunde (MfN).
„Wer Krankheiten heilen will, muss erst verstehen, was in den Zellen vor sich geht. Das hat Rudolf Virchow einst postuliert. Wir haben jetzt die technischen Möglichkeiten, Virchows Traum Wirklichkeit werden zu lassen, hier in Berlin“, sagt Nikolaus Rajewsky, der Direktor des Berliner Instituts für Medizinische Systembiologie des Max Delbrück Center (MDC-BIMSB). „Wir wollen damit die Präzisionsprävention neu definieren und in dem Feld eine treibende Kraft werden – in Berlin, Deutschland und weltweit.“
Seit 2007 prägend für die Neurowissenschaft in Berlin
Zusätzlich hat sich das seit 2007 bestehende Exzellenzcluster NeuroCure erfolgreich um eine weitere Förderperiode beworben. Mit über 40 neuen Forschungsgruppen und modernster Infrastruktur hat es die neurowissenschaftliche Forschung in der Hauptstadt maßgeblich geprägt und sich als Wegbereiter positioniert. Im Mittelpunkt stehen neurologische und psychiatrische Erkrankungen sowie die komplexen Mechanismen des gesunden Gehirns. Grundlagenforschung und klinische Anwendung sind eng verzahnt, um wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in Therapien umzusetzen.
Die Sprecher*innen sind Professor Dietmar Schmitz und Professorin Andrea Kühn (beide Charité). Förderinstitutionen: FU und HU, Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP), Max Delbrück Center, Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene (MPUSP).
Weiterführende Informationen
Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder
Kontakt
Jana Schlütter
Redakteurin, Kommunikation
Max Delbrück Center
+49 30 9406-2121
jana.schluetter@mdc-berlin.de oder presse@mdc-berlin.de
Max Delbrück Center
Das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft legt mit seinen Entdeckungen von heute den Grundstein für die Medizin von morgen. An den Standorten in Berlin-Buch, Berlin-Mitte, Heidelberg und Mannheim arbeiten unsere Forschenden interdisziplinär zusammen, um die Komplexität unterschiedlicher Krankheiten auf Systemebene zu entschlüsseln – von Molekülen und Zellen über Organe bis hin zum gesamten Organismus. In wissenschaftlichen, klinischen und industriellen Partnerschaften sowie in globalen Netzwerken arbeiten wir gemeinsam daran, biologische Erkenntnisse in praxisnahe Anwendungen zu überführen – mit dem Ziel Frühindikatoren für Krankheiten zu identifizieren, personalisierte Behandlungen zu entwickeln und letztlich Krankheiten vorzubeugen. Das Max Delbrück Center wurde 1992 gegründet und vereint heute eine vielfältige Belegschaft mit 1.800 Menschen aus mehr als 70 Ländern. Wir werden zu 90 Prozent durch den Bund und zu 10 Prozent durch das Land Berlin finanziert.
Living / 21.05.2025
Campus Konzert Reihe – “Musik trifft Wissenschaft”
Der Freundeskreis möchte Sie/Euch herzlich einladen:
Die Brüder Paul und Michael Afonin - beide hervorragende junge Musiker - werden uns mit Werken von Bach bis Gershwin (Paul am Klavier) und Max Bruchs Violinkonzert (Michael an der Violine) begeistern.
Im wissenschaftlichen Teil wird Dr. Fabian Coscia, Gruppenleiter am MDC, über faszinierende Einblicke in das „Protein-Universum in uns“ sprechen und darüber, wie seine Forschung zu einer besseren Diagnose und Behandlung von Krebs beitragen kann.
Der Eintritt ist frei, wir bitten um Spenden zugunsten des Freundeskreises des MDC und für die Restaurierung des Kirchturms Buch.
Veranstaltungsort:
Campus Buch, MDC.C Axon 1
Research / 10.05.2025
Lange Nacht der Wissenschaften am 28. Juni auf dem Campus Buch
Neugierig geworden? Das Programm ist jetzt verfügbar!
Das Gläserne Labor ist mit dabei. Das Programm findet von 16 bis 23 Uhr statt. Hier geht es zum Programm des Gläsernen Labors und seiner Partner. Highlights des Max Delbrück Centers finden Sie hier.
Liebe Wissenschafts- und Forschungsbegeisterte,
der Countdown läuft – im nächsten Monat ist es endlich so weit! Die Lange Nacht der Wissenschaften (LNDW) lädt Sie zum 25. Mal ein, den faszinierenden Stand der Wissenschaft in Berlin hautnah zu erleben. Am Samstag, den 28. Juni 2025, können Sie von 17 bis 24 Uhr in zahlreichen wissenschaftlichen und wissenschaftsnahen Einrichtungen spannende Entdeckungen machen und einen exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen. Zum Jubiläum erhalten Sie das Ticket für nur 5 Euro – ein kleiner Preis für eine Nacht voller großer Erkenntnisse! Seien Sie dabei und erleben Sie das Motto: Erleben. Verstehen. Wissen!
Das Programm der LNDW 2025 zur Langen Nacht der Wissenschaften 2025 ist jetzt verfügbar! Von West-Berlin bis Buch können Sie nun das komplette Programm der LNDW 2025 entdecken – mit über 1.000 spannenden Programmpunkten! Wählen Sie nach Stadtteilen und Ihren Interessen aus und planen Sie Ihre individuelle Entdeckungstour.
In diesem Newsletter erfahren Sie alles über die Highlights und besonderen Programmpunkte, die Sie in diesem Jahr erwarten.
Das Team des LNDW wünscht Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Echte Highlights und mehr als 1.000 weitere Veranstaltungen
Emotionen sind komplex – doch wie gut können wir sie wirklich lesen? Im interaktiven Experiment des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung treten Besucher:innen gegen eine künstliche Intelligenz an: Beide analysieren kurze Videoclips, in denen Schauspieler:innen verschiedene Gefühle ausdrücken. Ziel ist es, die dargestellten Emotionen korrekt zu identifizieren. Dieses spannende Duell zwischen Mensch und Maschine gewährt Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte zur maschinellen Emotionserkennung, die beispielsweise in der Psychotherapie Anwendung finden könnten. Ein faszinierendes Erlebnis für alle Altersgruppen.
Wie vertrauenswürdig ist Wissenschaft wirklich? In der interaktiven Ausstellung „Debunking Science Myths“ des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft (HIIG) werden gängige Vorurteile über Forschung hinterfragt und aufgeklärt. Besucher:innen erhalten einen differenzierten Einblick in den Forschungsalltag und können sich aktiv mit dem Thema Vertrauen in die Wissenschaft auseinandersetzen. Ein spannendes Angebot bei der LNDW 2025 für alle, die Wissenschaft kritisch und konstruktiv erleben möchten.
Wie fühlt es sich an, durch das Sonnensystem zu reisen oder um die Internationale Raumstation zu schweben? Im DLR_School_Lab Berlin, dem Schülerlabor des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, wird Wissenschaft lebendig! Besucher:innen können mit innovativen Fluggeräten in virtuelle Welten eintauchen, Hologramm-Aufsätze fürs Handy herstellen und sich von spannenden Experimenten rund um Raumfahrt, Energie und Verkehr faszinieren lassen.
Eigene Objekte in digitale Modelle verwandeln – das ermöglicht das Mitmachprojekt „Clone2Go“ an der Berliner Hochschule für Technik (BHT). Besucher:innen können kleine Figuren oder Gegenstände (max. 5 × 5 cm Grundfläche, 10 cm Höhe) mitbringen und diese mithilfe einer selbstgebauten Photogrammetriestation in ein 3D-Modell umwandeln. Nach erfolgreicher Digitalisierung besteht die Möglichkeit, das Modell vor Ort auszudrucken oder als STL-Datei mit nach Hause zu nehmen. Ein spannendes Erlebnis für Technikbegeisterte jeden Alters.
Jetzt Ticket sichern und Wissenschaft hautnah erleben!
Sichert Sie sich ab sofort Tickets und nutzen Sie die Gelegenheit, an diesem einzigartigen Event teilzunehmen – zum Jubiläumspreis von nur 5 € pro Person. Dieser einmalige Preis macht es noch einfacher, Wissenschaft und Forschung in ihrer ganzen Vielfalt zu erleben. Ob spannende Vorträge, faszinierende Experimente oder exklusive Einblicke in die neuesten Forschungseinrichtungen – die Lange Nacht der Wissenschaften bietet Ihnen unzählige Möglichkeiten, neue Perspektiven zu gewinnen und mit Expert*innen ins Gespräch zu kommen.
Tickets können im Ticketshop oder an ausgewiesenen Reservix-VVK-Stellen erworben werden.
Quelle: Newsletter #3 Lange Nacht der Wissenschaften e.V.
Lange Nacht der Wissenschaften
Education / 09.05.2025
15 Jahre Chemie im Gläsernen Labor
Am 11. Mai 2010 eröffnete das Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP) das FMP-ChemLab im Gläsernen Labor. Zum Jubiläum traf sich Chemikerin Dr. Bärbel Görhardt, die dieses Schülerlabor leitet, mit uns für ein Interview.
Was war der Anlass, das ChemLab zu gründen?
Das Gläserne Labor hatte seit 2004 in Kooperation mit dem Max Delbrück Center sehr erfolgreich Experimentierkurse für Molekularbiologie, Themen wie Herz-Kreislauf oder Neurologie aufgebaut, die Forschungsthemen des Max Delbrück Center vermitteln. Der damalige Direktor des FMP, Prof. Hartmut Oschkinat, war sehr interessiert an dieser Form der außerschulischen Bildung, um Jugendlichen die Themen des FMP näher zu bringen. So entstand ein brandneues, professionell ausgestattetes Chemielabor im Haus 13 auf dem Campus Berlin-Buch, mit dem wir die Kurse rund um Natur- und Wirkstoffe, Polymere und Farbstoffe aufbauen konnten, die wir heute im Programm haben. Gestartet sind wir unter anderem mit dem Kurs „Coffein – Wirkstoff oder Droge“. Er gibt einen umfangreichen Überblick über Extraktionsmethoden von Naturstoffen, über Nachweismethoden ausgewählter Stoffklassen, Methoden zur Stofftrennung und Analytik.
Was ist das Besondere am ChemLab?
Es bereichert den naturwissenschaftlichen Unterricht. Hier können die Lernenden in die Rolle von Chemikerinnen und Chemikern schlüpfen und in kleinen Teams und unter wissenschaftlicher Anleitung Fragestellungen lösen. Für die Experimente stehen ihnen Apparaturen und Methoden zur Verfügung, die ein Fachraum an der Schule nicht bieten kann. Der direkte Kontakt mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermittelt die Methoden der Chemie anschaulich und unkonventionell. Dabei spannt das ChemLab einen Bogen zwischen anspruchsvollen chemischen Verfahren und gesellschaftsrelevanten Fragestellungen. Im Coffeinkurs erfahren die Jugendlichen zum Beispiel, wie Coffein wirkt und wo es überall enthalten ist. Sie isolieren reines Koffeinpulver aus Kaffeepulver und Teeblättern – den Wirkstoff, der dann mittels verschiedener Methoden Rückschlüsse auf den Koffeingehalt der jeweiligen Getränke erlaubt. Die Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte sind begeistert davon, im Labor mit der Soxhlet-Apparatur, Rotationsverdampfern oder Fotometer zu arbeiten. Die Lernenden verbessern nicht nur ihr Wissen in Chemie, sondern auch ihr Alltagswissen: Wenn es darum geht, vorab zu schätzen, ob in Tee oder Kaffeepulver mehr Coffein ist, liegen die Jugendlichen meist nicht richtig.
Welche Entwicklung des Angebots im ChemLab würdest du gern hervorheben?
Als ich das ChemLab übernommen habe, war für mich wichtig, dass wir nicht nur mit der Sekundarstufe II arbeiten, sondern auch Chemiekurse für Sekundarstufe I aufbauen. Die Schülerinnen und Schüler in den Leistungskursen haben sich bereits bewusst für das Fach entschieden und interessieren sich vielleicht auch für eine entsprechende berufliche Laufbahn. Die jüngeren Schülerinnen und Schüler lassen sich noch für Chemie begeistern. Chemie in der Schule ist mit Fragen des chemischen Gleichgewichts und chemischem Rechnen ist eher trocken und nicht sehr beliebt bei den Schülerinnen und Schülern. Experimente aus dem Lebensalltag begeistern sie dagegen. Daher haben wir Kurse zu Duftstoffen, Kunststoffen und Farbstoffen entwickelt, die alle sehr gut angenommen werden.
Welcher ist davon dein Lieblingskurs?
Vielleicht der Kurs zu den Duftstoffen. Das Labor verwandelt sich in ein wahres Duftwunder. Dieser Kurs passt so gut zum FMP, weil es Wirkstoffe aus der Natur sind, die isoliert werden. Außerdem gibt es mit diesem Thema den so wichtigen Bezug zum Rahmenlehrplan: Nur wenn es in den eng gesteckten Rahmenlehrplan passt, können die Lehrkräfte mit den Klassen für vier Stunden Wissenszuwachs ins Gläserne Labor kommen.
Der Kurs hat auch eine schöne praktische Komponente: Am Ende des Kurses nehmen die Kinder selbstgefertigte Seifen oder isolierte Düfte mit nach Hause: Ethanolische Extrakte aus Zitrone und Orange oder ätherische Öle aus Pfefferminz, Lavendel und Zimt, die man als Parfum oder Raumduft verwenden kann.
Wie würdest du die Kurse gestalten, wenn du freie Hand hättest - ohne Rahmenlehrplan?
Dann würden wir viel längere Kurse anbieten wollen – 6-Stunden-Formate oder Formate über ein bis zwei Tage. In diesem Rahmen könnte man Themen viel umfassender bearbeiten und noch mehr spannende Bezüge einbauen. Aber es wird immer schwieriger für die Lehrer, Freistellungen für Exkursionen im Rahmen des Unterrichts zu erhalten.
Was wäre so ein Thema?
Das aktuelle Thema sind zur Zeit Algen: Diese sind zum einen das neueste Superfood, aber auch chemisch interessant, da sie Farbstoffe produzieren, die in der Lebensmittelchemie eingesetzt werden. Sie bieten so viele Ansätze, die bearbeiten werden können, dass man durchaus eine ganze Projektwoche daraus gestalten könnte. Das Problem bei Projektwochen ist, dass dafür eine zusätzliche Förderung wichtig wäre. Die Kosten von über 300 Euro pro Schüler sind sehr hoch und nur für wenige bezahlbar. Diese Kluft wollen wir nicht verstärken. Glücklicherweise haben wir haben wir bereits Einrichtungen und Unternehmen für die Förderung anderer Projektwochen gewinnen können.
Was würdest du dir für die Zukunft dem Chemlabs wünschen?
Wir konnten dank der Förderung des FMP ein tolles Bildungsangebot aufbauen und sind dafür sehr dankbar. Gemeinsam wollen wir künftig stärker aktuelle wissenschaftliche und technologische Entwicklungen aufgreifen, zum Beispiel mit Projekten, die es den Schüler:innen ermöglichen, Künstliche Intelligenz bezogen auf Anwendungsbereiche in den Forschungsgebieten des FMP zu verstehen.
Ein ganz zentraler Wunsch ist, dass wir künftig genügend Nachwuchs bei den jungen Dozentinnen und Dozenten gewinnen können, die das ChemLab mit der gleichen Leidenschaft weiterführen. Und natürlich, dass wir genügend Förderung erfahren, um das ChemLab auf dem hohen Niveau weiterführen zu können.
https://www.glaesernes-labor.de
https://leibniz-fmp.de/
Über das FMP
Wie kommt es zu Diabetes, Alzheimer oder Krebs? Wie entstehen seltene Erkrankungen? Aber vor allem: wie kann man diese frühzeitig erkennen und gezielt behandeln? Angetrieben von Fragen grundlegender Natur untersuchen die Forschenden am FMP die Funktion und das Zusammenspiel von Proteinen, Lipiden, und anderen Biomolekülen in den Zellen und Geweben des Körpers. Proteine erhalten chemische Aufträge der Zellen und Organe des Körpers und ändern dadurch ihre Aktivität. Auf diese Weise kontrollieren chemische Botenstoffe die Erregungsübertragung zwischen Nervenzellen im Gehirn ebenso wie die Muskelkontraktion, die Verdauung oder das Wachstum von Zellen und Organen. Wenn diese Kommunikation gestört ist oder Zellen und Gewebe dysfunktional werden, führt das zu Erkrankungen wie Diabetes, Krebs, oder neurologischen Störungen. Zu verstehen, welche molekularen Mechanismen in Zellen und Organen verändert sind, wie man dies sichtbar machen, behandeln oder vielleicht sogar verhindern kann, ist Ziel der interdisziplinären Forschung am FMP. Die Forschungsergebnisse des Instituts stellen damit die Grundlage für die Entwicklung neuer Medikamente oder neuartiger Diagnose- oder Therapieansätze dar. Dafür arbeiten am FMP Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus vielen Nationen und verschiedenen Disziplinen wie der Biologie, Chemie, Pharmakologie und Physik eng zusammen.
Das FMP befindet sich auf dem Campus Berlin-Buch, wo die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eng mit Forschenden der anliegenden Einrichtungen wie dem Max-Delbrück Centrum für Molekulare Medizin (MDC) oder dem Experimental and Clinical Research Center (ECRC) von Charité und MDC kooperieren.
Innovation / 09.05.2025
Lernen vom Campus Berlin-Buch: Zentraler Stromeinkauf und energetische Musterlösungen
Am 29. April traf sich die AG Energie der Zukunftsorte Berlin am Zukunftsort Campus Berlin-Buch. In der AG kommen Fachleute aus dem Bereich Energie- und Nachhaltigkeitsmanagement zusammen. Ziel ist es, voneinander zu lernen und Nachhaltigkeit, Resilienz und Wirtschaftlichkeit in den Energiesystemen der Zukunftsorte zu verbessern. Themen waren diesmal der zentrale Stromeinkauf durch die Campus Berlin-Buch GmbH (CBB) sowie energetische Musterlösungen in Gebäuden und Quartieren, insbesondere Laboren.
Zukunftsort Berlin-Buch
Dr. Christina Quensel, Geschäftsführerin der Entwicklungs- und Betreibergesellschaft des Campus, gab einen Überblick über den Zukunftsort Berlin-Buch, an dem rund 6.500 Menschen in der Gesundheitswirtschaft arbeiten, davon rund 3.000 auf dem international renommierten biomedizinischen Campus Berlin-Buch. Exzellente biomedizinische Forschungseinrichtungen, Life Science Start-ups und Biotech-Unternehmen arbeiten hier an der Medizin der Zukunft. Das Max Delbrück Center, das Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP), die Charité - Universitätsmedizin Berlin und das Berlin Institute of Health in der Charité sind wesentliche Treiber für Innovationen.
Zentraler Stromeinkauf und Einsparungen beim Energieverbrauch
Die Campus Berlin-Buch GmbH beschafft den Strom für alle Einrichtungen und Unternehmen des Campus, seit 2017 als Stromversorger. Zudem beschafft sie seit 2020 zu 100% Grünstrom.Fabian Reinboth vom Servicepartner E.MAGIS GmbH erläuterte, wie sein Unternehmen die differenzierten, marktabhängigen Einkäufe der CBB unterstützt, um vorteilhafte Preise für die Campusnutzer zu erzielen.
Kai von Krbek stellte das zertifizierte Energiemanagement der CBB für den BiotechPark Berlin-Buch mit rund 45.000 qm Bruttogeschossfläche vor. Einsparungen wurden u.a. durch intelligente Heizungssteuerungen sowie die zentrale Versorgung von Häusern mit Kälte, VE-Wasser und Druckluft erzielt.
Mehr Nachhaltigkeit im Labor - Pilotprojekt und Musterlösungen
Zwei Führungen im Max Delbrück Center und BerlinBioCube durch die beteiligten Planer:innen rundeten das Programm ab: Im Max Delbrück Center besichtigten die Teilnehmenden eine aktuell entstehende Pilotlaborfläche, in der wissenschaftlich untersucht werden wird, inwieweit eine Reduktion der Luftwechselrate im Forschungsumfeld realisierbar ist. Dies birgt erhebliches energetisches Einsparpotenzial.
Im neuen Gründerzentrum BerlinBioCube erläuterte Architekt Uli Hölken, welche nachhaltigen Lösungen im Laborbereich gefunden wurden, um eine maximale Flexibilität für die unterschiedlichen künftigen Belange der Start-ups zu ermöglichen.
Vielen Dank an die Förderung der AG durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe.
Research / 02.05.2025
Towards understanding tumors in 3D

Researchers in Nikolaus Rajewsky’s lab at Max Delbrück Center combined high-resolution, single-cell spatial technologies to map a tumor’s cellular neighborhoods in 3D and identify potential targets for personalized cancer therapy. They describe their findings in two separate papers in “Cell Systems.”
Understanding not just what cells are present in a tumor, but where they are located and how they interact with other cells around them – their cellular neighborhoods – can provide detailed insights that help doctors determine which treatments or therapies might be most effective for a specific patient.
An international research team led by the Berlin Institute for Medical Systems Biology at the Max Delbrück Center (MDC-BIMSB) combined spatial transcriptomics in 3D and extracellular matrix imagining to gain unprecedented detail about the inner workings of an early-stage lung tumor. The proof-of-concept study was published in “Cell Systems”.
“Tumors are complex ecosystems where tumor cells live in close contact with the surrounding extracellular matrix. They interact with many other cell types,” says Professor Nikolaus Rajewsky, director of the MDC-BIMSB, head of the Systems Biology of Regulatory Elements lab and senior author on both papers. “The data we can obtain now in tumor tissues from a patient are becoming so precise and comprehensive that we can computationally predict the molecular mechanisms which are driving phenotypes. This is new and fundamentally important for making personalized medicine a reality.”
From 2D to 3D
Transcriptomics documents what RNA is being actively expressed in cells, which indicates the activities the cell is engaged in and reveals the cell types present in a sample. Spatial transcriptomics does this but for individual cells to build a 2D map. The team got early access to the CosMx instrument from the company NanoString, which does this at extremely high resolution – 1,000 different RNA molecules can be detected at one time, compared to traditional methods that identify just a handful of molecule types at once. The team analyzed 340,000 individual cells from the lung tumor, identifying 18 cell types.
The 3D analysis was powered by a new computational algorithm, STIM, which aligns datasets to reconstruct 3D virtual tissue blocks. “We realized that spatial transcriptomics datasets can be modeled as images,” says Dr. Nikos Karaiskos, a postdoctoral researcher in the Rajewsky lab and co-corresponding author of the second “Cell Systems” paper describing STIM in detail. Leveraging imaging techniques, STIM marries the fields of computer vision and spatial transcriptomics. The team worked closely with Dr. Stephan Preibisch, a former principal investigator at MDC-BIMSB who is now at Howard Hughes Medical Institute’s Janelia Research Campus in the U.S., to bring this collaborative effort to fruition.
They then worked with the Systems Biology Imaging Platform in Mitte to apply a separate imaging technique, called second harmonic generation, to map elastin and collagen in cellular neighborhoods, which in the lung are the main extracellular matrix constituents. Areas with more elastin were healthier, while those with more collagen surrounded the tumor cells, which indicates harmful tissue remodeling.
“So not only do we know what cell types are present, we know how they are grouped with their neighbors, and we could begin to understand how tumor cells rewire non-malignant cells at the tumor surface to support tumor growth,” explains Tancredi Massimo Pentimalli, MD, the first paper author who is pursuing a PhD in the Rajewsky Lab and the Berlin School of Integrative Oncology at Charité – Universitätsmedizin Berlin.
Cells talk
But the analysis did not stop there. The team was able to understand precise phenotypes – for example, if fibroblasts, which form connective tissue, were activated and remodeling the tissue or not. They were also able to listen in on cell-to-cell communication and determine how tumor cells were blocking immune cells from entering the tumor.
“This immune suppression mechanism is well-known and suggests immunotherapy would help,” Pentimalli says. “Immune checkpoint inhibitors would reverse the suppression and then you have this army of immune cells that are already in position ready to attack. It was exciting to see how our approach identified this dynamic and could help direct a personalized immunotherapy plan.”
Notably, these key insights were only possible with data in 3D – in 2D it was impossible to distinguish between the tumor and other immune cells embedded in the tumor surface.
Pathology 2.0
The beauty of this approach is that, while very high-tech, it starts with a routine tissue sample found in any pathology lab. For this study, the group used a tissue sample of a lung tumor that was several years old, preserved with formalin and embedded in paraffin wax – the standard method pathologists use to preserve archival tissues.
“We were able to extract all this wealth of molecular information from one very thin section of a sample that has been sitting around at room temperature for years,” Pentimalli says. “This is pathology 2.0 – not just looking at the cells under a microscope to make a diagnosis, but bringing molecular insight to the clinic.”
Next steps
Now that the proof-of-concept has been established, the team plans to apply the approach to larger datasets. They are currently working on 700 samples from 200 patients and collaborating with Dr. Fabian Coscia, who leads the Spatial Proteomics Lab at Max Delbrück Center, to integrate protein activity into the analysis.
Text: Laura Petersen
Illustration:
The image shows that the tumor core is surrounded by multiple immune niches in an early-stage non-small cell lung cancer (NSCLC) patient. Analyses of these multicellular niches using single-cell resolution spatial transcriptomics identified several druggable targets. Inhibition of these targets could have prevented tumor progression in this patient, who instead received conventional chemotherapy and succumbed to the disease one year later. © Rajewsky Lab, Max Delbrück Center
Source: Press Release Max Delbrück Center
Towards understanding tumors in 3D
Research, Innovation, Patient care, Education / 01.05.2025
Lange Nacht der Wissenschaften 2025 auf dem Campus Berlin-Buch
Forschung erleben, wenn die Einrichtungen des Campus Berlin-Buch zur Langen Nacht der Wissenschaften am 28. Juni 2025 ihre Türen öffnen. Es erwartet Sie ein Programm für die ganze Familie mit Mitmachangeboten, Laborführungen, Workshops, Vorträgen, Rundgängen, Live-Quiz und interaktiven Infoständen. Treten Sie in den Dialog mit Wissenschaftler:innen und lassen Sie sich faszinieren von der Welt der Biomedizin.
Die Lange Nacht der Wissenschaften findet auf dem Campus Berlin-Buch am 28. Juni 2025 von 17 bis 23 Uhr statt. Kinderprogramm bereits ab 16 Uhr.
PROGRAMM DER FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN
Seit 30 Jahren gibt es das Max Delbrück Center in Berlin, es ist ein weltweit führendes biomedizinisches Forschungszentrum. Wir analysieren das System Mensch – die Grundlagen des Lebens von seinen kleinsten Bausteinen bis zu organübergreifenden Mechanismen. So wollen wir Krankheiten vorbeugen, sie möglichst früh erkennen und passgenau therapieren. Wir zeigen Dinge und Orte, die normalerweise nur unseren Wissenschaftler:innen zugänglich sind: Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (Max Delbrück Center)
Was hält uns gesund, was macht uns krank? Wie gelangt ein Medikament an seinen Wirkungsort im Körper? Wie kann man Viren und Bakterien daran hindern, in Zellen und Gewebe einzudringen? Um dies zu beantworten, studieren wir die molekularen Ursachen von Krankheiten. Auf Basis dieser Erkenntnisse entwickeln wir gezielt neuartige Therapeutika, um so die Grundlage für die Medizin von morgen zu schaffen. Während der Langen Nacht der Wissenschaften haben Sie die Möglichkeit, unsere Forschung direkt in unseren Laboren zu erleben und mit unseren Wissenschaftler:innen zu sprechen. Diese Veranstaltung ist für die ganze Familie und besonders für junge Leute geeignet. Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie
Für Erlebnishungrige und Wissensdurstige: Was es beim Max Delbrück Center, der Charité und dem BIH zu entdecken gibt, finden Sie hier! Berlin Institute of Health at Charité (BIH)
PROGRAMM DES SCHÜLERLABORS
Mikroskopieren, pipettieren, experimentieren - vielfältige Angebote zum Mitmachen und Ausprobieren. Das Gläserne Labor bietet gemeinsam mit dem Forschergarten und seinen Partnerschulen und den Bucher Forschungseinrichtungen ein Programm nicht nur für Kinder und Schüler:innen zur Langen Nacht der Wissenschaften!
SERVICE
Die Anmeldung für Veranstaltungen mit begrenzter Teilnehmendenzahl ist ausschließlich am Veranstaltungstag möglich.
16:00 bis 23:00 Uhr
Zentraler Infopunkt
Sie wollen sich für eine Laborführung oder einen Workshop anmelden? Sie haben Fragen zu unseren Angeboten? Dann sind Sie am zentralen Infopunkt richtig! Ab 16 Uhr erhalten Sie hier Informationen über das Programm auf dem Campus Berlin-Buch und können Plätze für Veranstaltungen mit begrenzter Teilnehmendenzahl reservieren. Die Führungen starten vor dem Haupteingang des Max Delbrück Communications Center (MDC.C).
Ort: Foyer, Max Delbrück Communications Center (MDC.C) (C83)
16:00 bis 20:30 Uhr
Abendkasse
Die Tickets zur Langen Nacht der Wissenschaft gelten für alle Veranstaltungen in den teilnehmenden Wissenschaftseinrichtungen. Außerdem können Sie damit die Sonderbusse kostenfrei nutzen. Bei manchen Angeboten wie Workshops und Laborführungen ist allerdings die Zahl der Plätze begrenzt. Dafür müssen Sie sich zusätzlich am zentralen Infopunkt anmelden – natürlich kostenfrei.
Ort: Vor dem Max Delbrück Communications Center (MDC.C) (C83)
Die Lange Nacht der Wissenschaften findet auf dem Campus Berlin-Buch am 28. Juni 2025 von 17 bis 23 Uhr statt. Kinderprogramm bereits ab 16 Uhr.
TICKETS & PREISE
Neu und nur zum Jubiläum hat die LNDW ein besonderes Angebot für Sie: Die Tickets kosten dieses Mal nur 5 Euro.
Das Ticket ermöglicht den Zugang zu sämtlichen Veranstaltungen in den teilnehmenden Wissenschaftseinrichtungen in ganz Berlin. Zudem berechtigen die Tickets zur kostenfreien Nutzung von Sonderbussen, die zu Veranstaltungsorten außerhalb des öffentlichen Nahverkehrs fahren, wie beispielsweise nach Adlershof und zum Campus Buch.
Zur Ticketbuchung
Ermäßigungsinformationen
Kinder unter 6 Jahren (d.h. bis ein Tag vor dem 6. Geburtstag): kostenfrei
VERANSTALTUNGSORT & ANFAHRT
Campus Berlin-Buch, Robert-Rössle-Straße 10 in 13125 Berlin. Informationen zur Anfahrt finden Sie hier. Während der Langen Nacht der Wissenschaften verkehr zusätzlich ein Sonderbus: S-Bahnhof Berlin-Buch - Campus Buch - Helios Klinikum Berlin-Buch - S-Bahnhof Buch.
GASTRONOMIE
Es erwarten Sie zahlreiche Foodtrucks, ein Café, ein Restaurant mit Eiscafé, leckeres vom Grill, eine Gulaschkanone und eine Bäckerei.
Alle Informationen zur Langen Nacht der Wissenschaften finden Sie hier
SCIENCE ENTERTAINMENT
16:30, 18:30 Uhr
Dampf, Druck und Donnerknall - Naturwissenschaften, die bewegen!
Qualm, Laser, Schnee: Ein Potpourri von Experimenten erwartet Groß und Klein bei der Experimentalvorlesung des Schülerforschungszentrum Pankow am Robert-Havemann-Gymnasium.
Experimentalvorlesung für die ganze Familie
Schülerforschungszentrum Pankow am Robert-Havemann-Gymnasium
Dauer: 45 min
Ohne Anmeldung
Ort: Experimentierhalle in der Mensa (A14)
17:30, 19:00, 20:15 Uhr
Wissen-schafft-Spaß – CheMagie: coole Experimente und heiße Zauberei
Zauberkünstler und Biochemiker Oliver Grammel entführt Sie in die zauberhafte Welt der Chemie. Ein Wissenschaftsspaß für die ganze Familie
Dauer: circa 45 min
Ohne Anmeldung
Ort: Max Delbrück Communications Center (MDC.C) (C83), Axon 1
HIGHLIGHT
22:00 Uhr
Zelluläres Echo
Eine audiovisuelle Live-Performance, die Maßstäbe und Dimensionen sprengt!
Zum Sonnenuntergang projiziert Zelluläres Echo mikroskopische Aufnahmen von Zellen auf die Außenwand des Erwin-Negelein-Hauses und transformiert sie zu einem Arrangement aus Licht und Sound. Erleben Sie eine Hymne auf die Vielfalt und Schönheit der Bausteine des Lebens.
Visuals:
Dr. Jochen Müller ist Neurowissenschaftler und Wissenschaftskommunikator mit einem Faible für Mikroskopie und live-Veranstaltungen. In seiner Arbeit vermittelt er die Faszination für Wissenschaft durch einfache Sprache und ästhetische Bilder.
Dr. Sumeet Rohilla ist ein interdisziplinärer Medienkünstler, der in seiner Arbeit Wissenschaft, neue Technologien und Kunst verbindet. Seine Kunstwerke reichen von abstrakten Datenvisualisierungen über interaktive Echtzeit-Lichtinstallationen bis hin zu audioreaktiven visuellen immersiven Erfahrungen.
Sound:
Manav Khadkiwala ist ein Künstler, Designer und Musiker, der von der Spannung zwischen Struktur und Unvorhersehbarkeit fasziniert ist. In seiner kreativen Praxis nutzt er generative Algorithmen, um das empfindliche Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Zufall zu steuern und Muster zu erkennen, die aus scheinbar chaotischen Systemen hervorgehen.
Dauer: ca. 45 Minuten
Anmeldung nicht erforderlich
Ort: Wiese vor dem Erwin Negelein Haus
VERANSTALTUNGSORT
Campus Berlin-Buch, Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin
Mehr zum Programm der Lange Nacht der Wissenschaften 2025 auf dem Campus Berlin-Buch
Research, Patient care, Education / 30.04.2025
Gesundheitswissen für Kinder und Jugendliche
In Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit bietet das Gläserne Labor neue Arbeitsgemeinschaften und Projektwochen
In der Kindheit und Jugend werden grundlegende Weichen für ein gesundes Leben gestellt, weshalb Prävention, Diagnose und Therapie von Erkrankungen in diesen Entwicklungsphasen eine entscheidende Rolle spielen. Das Deutsche Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit (DZKJ) fördert die interdisziplinäre Erforschung von Ursachen häufiger und seltener Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter sowie die Entwicklung innovativer Therapien und Präventionsstrategien. Es sorgt dafür, die Öffentlichkeit für das Thema Kinder- und Jugendgesundheit zu sensibilisieren und Forschungsergebnisse schneller in die Praxis zu transferieren.
In Berlin, einem der sieben Standorte des Zentrums, sind die Charité – Universitätsmedizin Berlin, das Max Delbrück Center und das Deutsche Rheuma-Forschungszentrum beteiligt. In engem Verbund von Grundlagenforschung und klinischer Forschung stehen unter anderem hier seltene genetische, chronisch-entzündliche und neurologische Erkrankungen im Fokus. Der Standort Berlin nutzt seine Expertise und Infrastruktur in der Systemmedizin, um organ- und krankheitsübergreifende Forschungsansätze zu etablieren. Ziel ist es, Merkmale der Gesundheit und Mechanismen der Krankheitsentstehung bei Kindern und Jugendlichen besser zu verstehen und damit die Voraussetzungen für eine Präzisionsmedizin zu schaffen.
Aufklärung und Prävention als wichtige Säule
Das DZKJ fördert das öffentliche Wissen über Erkrankungen und deren Prävention: Wer Erkrankungen und mögliche Ursachen kennt, kann besser auf seine Gesundheit achten. Das Gläserne Labor auf dem Campus Berlin-Buch bietet daher ab Mai 2025 in Kooperation mit dem DZKJ Arbeitsgemeinschaften und Projektwochen für Schüler:innen an, die verschiedene Erkrankungen thematisieren. Dabei wird ein Bezug zu vier Forschungsschwerpunkten des DZKJ hergestellt: Adipositas und Metabolismus, Entwicklung des Zentralen Nervensystems und neurologische Erkrankungen, seltene genetische Erkrankungen sowie die Erforschung der Immunantwort und Behandlung von Allergien.
Theorie und „Hands on“ in Grundschule und Gymnasium
Wie Ernährung auf die Gesundheit wirkt
Grundschüler:innen der Klassenstufen 5 – 6 lernen in einer Arbeitsgemeinschaft, was Diabetes bedeutet und wie sich übermäßiger Zuckerkonsum auf die Entstehung von Diabetes auswirkt. Mit Labormethoden messen sie Zuckerbestandteile in Lebensmitteln und führen eine Woche ein Ernährungstagebuch, wobei auch ihre Familie mitwirken soll. Bei der Auswertung geht es darum zu vermitteln, wie eine ausgewogene Ernährung aussehen sollte und wie viele positive Effekte diese haben kann. Zum Abschluss wird gemeinsam gekocht – gesund und lecker.
Nerven und Sinne im Test
In einem zweiten Teil beschäftigt sich diese Arbeitsgemeinschaft mit dem Nervensystem und den Sinnen. Experimente vermitteln anschaulich die Funktionsweise der Nerven, ihr Zusammenspiel und die Bedeutung der Sinne für die Wahrnehmung. Wie ist das Gehirn aufgebaut, wie funktionieren die Augen und das Gehör? Für gesunde Menschen sind diese Fähigkeiten selbstverständlich, doch welche Einschränkungen ergeben sich bei neurologischen Erkrankungen? Dies testen die Kinder anschaulich mittels einer Prismenbrille beim Ballspielen.
Die Arbeitsgemeinschaft erstreckt sich über acht Termine á 1,5 Stunden.
Der Code des Lebens
Für Gymnasialschüler:innen der Klasse 10 wird die Projektwoche im molekularbiologischen Labor zum Thema DNA und genetische Erkrankungen spannend. Sie vertiefen ihr Wissen über die DNA und ihre Funktion als Informationsspeicher, gewinnen DNA aus Mundschleimhaut und erfahren, wieviel DNA in diesen Zellen enthalten ist. In der Projektwoche führen sie eigenständig eine PCR-Analyse durch und lernen, wie sich Mutationen und damit mögliche Erbkrankheiten nachweisen lassen. Die Jugendlichen entschlüsseln im Versuch die Vererbung einer genetischen Erkrankung innerhalb einer fiktiven Familie. Darüber hinaus weisen sie experimentell nach, ob bei einer vorliegenden Mutation eine Erkrankung ausbrechen wird oder nicht. Zum Abschluss der Projektwoche trifft sich die Gruppe mit einer Forscherin des Max Delbrück Centers, um Einblick ihre Arbeit zu bekommen und besucht ein Forschungslabor auf dem Campus.
Immunsystem und Allergien
Aufbauend auf der Projektwoche zu genetischen Erkrankungen lernen die Jugendlichen weitere Formen von Erkrankungen kennen, die durch Viren, Bakterien, Parasiten oder Schadstoffe ausgelöst werden. Im Mittelpunkt steht, wie in diesem Fall das Immunsystem arbeitet, welche Funktion Antikörper haben und warum es bei Allergien zu Überreaktionen kommt. Im Labor werden die Zellen des Immunsystems aus einer winzigen Blutprobe bestimmt. Anschließend führen die Schüler:innen das immunologische Nachweisverfahren ELISA durch. In einer Simulation weisen sie das Vorliegen von Antigenen in einer Probe und damit den „Ausbruch“ einer Krankheit nach. Ein weiterer Versuch dreht sich um die Bestimmung des Tetanustiters im Blut. Ausgestattet mit diesem Vorwissen, behandeln die Jugendlichen die Unterschiede zwischen einer gesunden Immunantwort und einer allergischen Reaktion, die Vielfalt der Allergene und die Aufgabe der Antikörper. Im praktischen Teil geht es anschließend darum, Antikörper mit Hilfe bestimmter Gele sichtbar zu machen sowie Allergene mittels PCR zu detektieren. In einer abschließenden Reflexion diskutieren die Teilnehmenden, wie man das Immunsystem stärken kann und warum die Forschung in diesem Bereich so wichtig ist.
Beendet wird die Projektwoche mit einem kleinen Symposium, in dessen Rahmen die Schüler:innen ihre Ausarbeitungen vorstellen. Geplant ist, dazu Forschende einzuladen, die aus ihrem Forschungsalltag berichten.
Die Projektwochen erstrecken sich jeweils über vier Workshops á vier Stunden.
Patient care / 29.04.2025
Chefarztwechsel in der Evangelischen Lungenklinik
Seit 1. April 2025 leitet Hussam Shuaib die Klinik für Thoraxchirurgie an der Evangelischen Lungenklinik in Berlin-Buch, an der er zuvor als Leitender Oberarzt tätig war.
Cathleen Biesen, Geschäftsführerin der Evangelischen Lungenklinik: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Herrn Shuaib einen erfahrenen und engagierten Thoraxchirurgen als Chefarzt gewonnen haben. Er ist ein begnadeter Operateur, genießt hohe Akzeptanz bei Patient*innen und Mitarbeitenden und ist sowohl menschlich als auch strukturell hervorragend aufgestellt. Damit bringt er die besten Voraussetzungen für diese anspruchsvolle Position mit."
Die Evangelische Lungenklinik ist als spezialisierte Fachklinik für Lungenerkrankungen mit langer Tradition fest in Berlin und Umgebung etabliert. Die Klinik für Thoraxchirurgie bietet das komplette Spektrum thoraxchirurgischer Operationen, wie Eingriffe an den Atemwegen, der Lunge, dem Mittelfellraum und der Brustwand.
Hussam Shuaib: „Meine Schwerpunkte sehe ich vor allem in der weiteren Spezialisierung auf minimalinvasive thoraxchirurgische Verfahren, der Durchführung komplexer thoraxchirurgischen Eingriffe, der engen interdisziplinären Zusammenarbeit und den weiteren Ausbau innovativer Behandlungskonzepte. Ich freue mich sehr über die neue Herausforderung, zumal ich das Haus und die Kolleg*innen gut kenne und weiß, dass unser Team hochprofessionell aufgestellt ist. Die Evangelische Lungenklinik genießt einen hervorragenden Ruf, den ich gemeinsam mit meinem Team weiter festigen und ausbauen möchte. Bei Lungenerkrankungen verstehen wir uns als festen Partner an der Seite unserer Patient*innen und der niedergelassenen Kolleg*innen.“
Der 42-jährige Chirurg ergänzt: „Ich übernehme eine hervorragend aufgestellte Klinik, deren hohen medizinischen Standard mein Team und ich erhalten und strategisch weiterentwickeln möchten. Dabei sind medizinische Innovationen und die hohe Behandlungsqualität genauso wichtig, wie eine professionelle und menschlich zugewandte Versorgung unserer Patient*innen."
Hussam Shuaib ist gebürtiger Syrer und begann 1999 sein Medizinstudium an der Universität in Aleppo. 2009 kam er nach Deutschland, seine Facharztanerkennung für Thoraxchirurgie erhielt er 2015. Er sammelte umfassende operative Erfahrung an führenden Lungenfachkliniken, unter anderem in Hemer und Grosshansdorf, und verfügt über verschiedene Zusatzqualifikationen, darunter „Spezielle Thoraxchirurgie“, „FEBTS, Fellow of the European Board of Thoracic Surgeons“, „Ärztliches Qualitätsmanagement“ und „Rettungsdienst“. Er ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie, der European Society of Thoracic Surgeons sowie der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie.
Über die Evangelische Lungenklinik
Die Evangelische Lungenklinik, ein Unternehmen der Johannesstift Diakonie, ist seit ihrer Gründung im Jahr 1952 eine weithin anerkannte Spezialklinik für akute und chronische Erkrankungen der Lunge sowie des Brustkorbs. Die Evangelische Lungenklinik in Berlin-Buch behandelt rund 6.400 stationäre und etwa 12.200 ambulante Patient*innen jährlich und ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité – Universitätsmedizin Berlin.
Über die Johannesstift Diakonie
Die Johannesstift Diakonie gAG ist das größte konfessionelle Gesundheits- und Sozialunternehmen in der Region Berlin und Nordostdeutschland. Über 11.400 Mitarbeitende leisten moderne Medizin, zugewandte Betreuung und Beratung im Einklang mit den christlich-diakonischen Werten des Unternehmens. Der Träger betreibt Einrichtungen in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Niedersachsen mit einem vielfältigen Angebot in den Bereichen:
- Krankenhäuser und ambulante Versorgungszentren
- Pflege- und Wohneinrichtungen sowie Hospize
- Behindertenhilfe
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Arbeit, Beschäftigung und Soziales
- Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie Ergotherapie
- Dienstleistungen für Gesundheits- und Sozialeinrichtungen
Research, Innovation, Patient care, Education / 24.04.2025
Max Delbrück Center to host Helmholtz Drug Discovery meeting
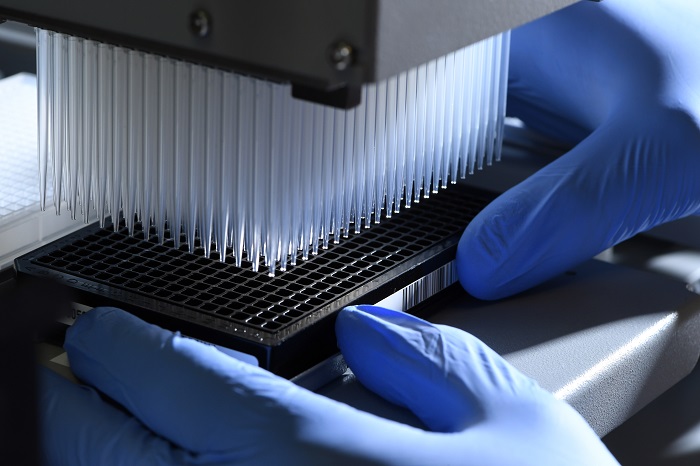
Top scientists and companies will meet in Berlin-Buch for the 2025 Helmholtz Drug Discovery Conference from April 28-30 to discuss RNA drugs, PROTACs, AI in drug discovery, and chemoproteomics and to form new collaborations.
This year, the Max Delbrück Center will host the international Helmholtz Drug Discovery Conference (HDDC) in Berlin-Buch from April 28-30. The meeting will feature an exciting list of speakers discussing advances in new kinds of therapeutics such as RNA, both as a drug and a target, and Proteolysis Targeting Chimeras (PROTACs) – a promising class of drugs that are more effective than traditional small molecules. The three-day conference will also assemble a panel of experts discussing the application of artificial intelligence to identify novel drug candidates and advances in chemoproteomics – a more accurate and sophisticated method of developing new therapeutics.
The biannual HDDC is organized by the Drug Research Initiative, a consortium of all Helmholtz Centers participating in the Helmholtz Health research area. “The Helmholtz Drug Discovery Conference reflects our commitment to accelerating the development of innovative therapeutics that address some of the most pressing health challenges of our time,” says Professor Maike Sander, Vice President of Helmholtz Health and Scientific Director of Max Delbrück Center. “By bringing together leading minds from academia, clinical research, and industry, we are creating a dynamic environment for collaboration that can truly drive medical breakthroughs. I am particularly excited to see how emerging technologies – like AI and chemoproteomics – are shaping the future of drug discovery.”
“The bulk of the talks will focus on RNA strategies,” says Professor Michael Bader, Head of the Molecular Biology of Peptide Hormones lab at the Max Delbrück Center and co-organizer of the conference. “It’s a topic that hasn’t been discussed much in previous meetings but is becoming increasingly important,” he adds.
For example, Professor Thomas Thum, Head of the Institute of Molecular and Translational Therapy Strategies at Hannover Medical School, will discuss how he has used ultra-thin sections of human cardiac tissue to study miR-21 – a microRNA (miRNA) that regulates inflammatory and fibrotic genes that trigger stiffening of heart muscle tissue. His research team has developed an antisense RNA molecule that acts as a mirror image, binding to the microRNA and switching it off. The molecule can partially reverse the stiffening, making heart tissue more elastic.
Other speakers include doctoral student Isabell Drath from the University of Veterinary Medicine in Hannover, who will present research on a new nanoparticle-based nose-to-brain delivery of small interfering RNA (siRNA) or miRNA to treat Parkinson’s disease. And Professor Michelle Hastings from the University of Michigan Medical School will explain how she and her team have developed splice-switching antisense oligonucleotides – short sequences of nucleic acids that pair to an RNA target and change how it is translated into proteins – to treat Batten disease, a fatal genetic disorder.
Workshop, industry reps to give “Flash Talks”
In addition to scientific talks and discussions, this year’s HDDC will also feature a workshop on the drug screening platform EU-OPENSCREEN, and talks by start-ups and established companies. EU-OPENSCREEN is a non-profit European Research Infrastructure Consortium for chemical biology and early drug discovery, explains Dr. Edgar Specker, Head of Compound Management at the Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP) and a co-organizer of the conference. EU-OPENSCREEN’s central office and compound management laboratory are located on the research campus in Berlin-Buch. It provides open access to cutting-edge compound screening, medicinal chemistry, chemoproteomics, and spatial MS-based omics platforms to researchers around the world.
“We wanted to make this meeting a forum for more than just exchange among scientists,” says Bader, “but also a place where companies and start-ups working in these fields could introduce themselves and form collaborations with other researchers.” During the start-up session on Tuesday afternoon, several companies will present their work including Absea Biotechnology and FyoniBio, which were spun-off by Max Delbrück researchers and are located at Campus Buch. High-Tech Gründerfonds, a public-private venture capital investment firm based in Bonn, will also be participating in the discussions.
Developing novel drugs, getting industry involved
The invited companies are engaged in developing RNA based and other types of therapeutics, including PROTACS – which work differently than traditional small molecule drugs by actively degrading disease-causing proteins rather than simply inhibiting them and are consequently more effective. Chemoproteomics, which combines the study of all proteins in cells with technologies such as mass spectrometry to locate and understand exactly where drugs bind inside cells, will also be discussed by both researchers and companies.
“Previous conferences have consistently served as dynamic platforms for exchange among researchers and industry. HDDC2025 will follow this tradition,” says Bader. “We aim to help companies gather new ideas for commercialization and inspire researchers to spin off companies to transform their research findings into real benefits for patients.”
International Helmholtz Drug Discovery Conference
When?
April 28, 2025, 12:00PM – April 30, 2025, 1:30PM
Where?
Max Delbrück Communications Center (MDC.C), Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin
Further information
Research, Innovation, Patient care / 24.04.2025
Eckert & Ziegler Signs Contract Manufacturing Agreement for Yttrium-90-based PentixaTher with Pentixapharm

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH (EZR), a 100% subsidiary of Eckert & Ziegler SE, today announced the signing of a manufacturing agreement with Pentixapharm, a clinical-stage biopharmaceutical company. Under the terms of the agreement, EZR will produce and distribute patient-specific doses of Y90-PentixaTher, Pentixapharm’s lead CXCR4-targeting radiotherapeutic, for use in clinical trials.
Y90-PentixaTher is a radiolabeled peptide therapeutic designed to deliver targeted radiation to cancer cells that overexpress the CXCR4 receptor - commonly found in malignancies such as acute myeloid leukemia, lymphoma, myeloma and various solid tumors. Used alongside the radiodiagnostic Ga68-PentixaFor, it supports a theranostic approach that allows physicians to visualize the disease before and after treatment.
As part of the newly signed agreement, EZR will manufacture Y90-PentixaTher under GMP conditions and manage the direct shipment of individual patient doses to trial sites. The agreement is limited to the clinical development phase and does not extend to commercial-scale manufacturing. Pentixapharm retains full strategic flexibility under this agreement to determine its future development and commercial supply.
“With this agreement, we are proud to support the advancement of Pentixapharm’s clinical oncology program,” said Dr. Harald Hasselmann, CEO of Eckert & Ziegler SE (EZAG). “Reliable access to high-quality radioisotopes is critical for the development of next-generation radiopharmaceuticals and we are pleased to contribute our manufacturing excellence to accelerate the delivery of innovative cancer therapies.”
"Securing a reliable Y90-PentixaTher GMP production is a significant milestone for Pentixapharm," said Dr. Dirk Pleimes, CEO of Pentixapharm AG. "This agreement marks a critical step in securing reliable clinical supply as we advance our targeted radiopharmaceutical therapies toward late-stage development."
About Eckert & Ziegler
Eckert & Ziegler SE, with more than 1,000 employees, is a leading specialist in isotope-related components for nuclear medicine and radiation therapy. The company offers a broad range of services and products for the radiopharmaceutical industry, from early development work to contract manufacturing and distribution. Eckert & Ziegler shares (ISIN DE0005659700) are listed in the TecDAX index of Deutsche Börse. Contributing to saving lives
About Pentixapharm
Pentixapharm is a clinical-stage biotech company discovering and developing novel targeted radiopharmaceuticals with offices in Berlin and Würzburg, Germany. It is committed to developing ligand-based, first-in-class radiopharmaceuticals with strong differentiation and commercialization potential across high-need diagnostic and therapeutic areas. Its pipeline comprises CXCR4-targeted compounds in clinical development and a portfolio of early-stage radionuclide-antibody conjugates, aimed at treating hematologic malignancies, solid tumors, and diseases of the cardiovascular, endocrine, and immune systems.
www.ezag.deResearch, Innovation, Patient care, Education / 24.04.2025
Talk im Cube: "International Cooperation and Funding programs in Life Sciences"

We are excited to continue also in 2025 the Talks in the Cube starting with a further expert discussion focused on International cooperation and Funding programs in Life Sciences on May 15, 2025.
This event will feature four esteemed experts in the field who will share their insights and experiences on the importance of collaboration across borders and the role of funding in advancing life sciences research.
With
Kerem Can Akkaya, Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH
Gustavo Reis de Ascencao, Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK), Berlin
Dr. Daniel Schubart, Consultech GmbH, Berlin
Mike Schüßl, Investitionsbank Berlin
Dr. Uwe Lohmeier, Berlin BioScience Academy (BBA), Campus Berlin-Buch GmbHm Berlin (Moderation)
Join us as we explore background, options and challenges when Life Sciences inventions leave national borders.
Whether you are a seasoned investor, a biotech entrepreneur, or simply interested in the future of biotechnology, this discussion promises to provide valuable perspectives and foster meaningful conversations. The talk will be followed by a networking event where you can socialize over snacks and drinks.
Don’t miss out on this valuable event!
Target audience
Founders & scientists from start-ups, small and medium-sized life science companies and scientific institutions.
Costs
Participation is free of charge. Registration is requested.
When: Thursday, 15.05.2025
5:00 p.m. - 6:30 p.m.
Where:
BerlinBioCube (Building D95), Campus Berlin-Buch, Robert-Rössle-Straße 10, 13125 Berlin
Further information:
Uwe Lohmeier per E-Mail: u.lohmeier@campusberlinbuch.de
Further topics planned for 2025
- IP Strategies in Biotechnology
- CROs in diagnostics and therapeutics development
About "Talk in the Cube"
With the event series "Talk in the Cube", we bring business and science together on the Berlin-Buch campus and connect founders of start-ups or life science companies with scientists, e.g. from the Max Delbrück Center, FMP, Charité and BIH. We invite experts on business topics or trends in the life sciences and highlight aspects such as
- What innovations are there in the start-ups and who is driving them forward?
- How does the life science business world work and where can synergies with science be created?
- How does the "networked laboratory" work and how do you live "sustainability in the laboratory"?
Picture credits: Campus Berlin-Buch GmbH
International Cooperation and Funding programs in Life Sciences
Research, Education / 22.04.2025
Helmholtz task force strengthens prevention research
The Helmholtz Association is pooling its commitment to prevention research with the launch of the Helmholtz Health Prevention Task Force. In a strategy paper published in “Nature Medicine,“ the committee outlines initial concepts for integrating prevention more effectively into medical practice.
As Germany's largest scientific organization, the Helmholtz Association encompasses six health research centers with approximately 10,000 employees. Its researchers develop strategies for early disease detection and risk assessment across various conditions, including infectious diseases, cancer, metabolic disorders, and neurodegenerative diseases. The newly established task force unites experts from all six Helmholtz Health centers and the German National Cohort (NAKO) to advance prevention research.
“By bringing together top experts across disciplines, we can transform prevention into a powerful tool for better health worldwide,” says Professor Matthias Tschöp, CEO at Helmholtz Munich, who helped to initiate the task force as former Helmholtz Health Vice President. “Our goal is to move beyond treatment and fundamentally rethink how we predict, prevent, and mitigate disease before it occurs.”
Closing the gaps in prevention research
Despite its critical role in healthcare, prevention research faces significant challenges. A lack of a long-term, comprehensive strategy and insufficient funding have slowed progress. Additionally, the task force has identified key gaps: Health inequalities (i.e., differences in health among population groups due to social, economic, or geographical conditions) and environmental factors are often overlooked, limiting the effectiveness of preventive measures. Many diseases remain undetected in their early, symptom-free stages due to a lack of awareness and research – such as high blood pressure, which requires intervention before symptoms appear. Existing prevention programs are often inadequately monitored, leading to underutilization of valuable health data.
“Our goal is to make prevention a central pillar of a sustainable healthcare strategy,” says Professor Eleftheria Zeggini, co-chair of the task force and Director of the Institute of Translational Genomics at Helmholtz Munich. “To tackle major health challenges – such as aging, multimorbidity, and the impact of climate change on human health – we must strengthen collaboration among researchers, healthcare providers, and policymakers.”
Health solutions that improve lives
Harnessing the power of big data and advanced analytics, the task force will develop new frameworks for prevention strategies. “By integrating advanced technologies such as multi-omics, machine learning, and bioengineering, we aim to uncover personalized health trends and risk factors that enable earlier detection and intervention for common diseases,” explains Professor Maike Sander, current Vice President of Helmholtz Health and Scientific Director of the Max Delbrück Center. “Through better data connectivity and sharing, we can transform research into predictive, effective, and lasting health solutions that improve lives.”
The experts are also dedicated to aligning their findings with public health strategies and fostering health-promoting environments. “We are committed to developing evidence-based recommendations that align with public health policies and promote healthier environments and behaviors," adds Professor Ute Mons, task force co-chair and division head of Primary Cancer Prevention at the German Cancer Research Center (DKFZ). In addition to chronic diseases, the focus of the task force includes infectious disease prevention – through targeted immunization, preventive therapies for at-risk populations, and a One Health approach to reduce zoonotic risks.
Further information
- Helmholtz Health
- At the helm of Helmholtz Health: Maike Sander
- Perspectives for the medicine of the future
www.mdc-berlin.de
Research, Patient care / 22.04.2025
Consortium of African and European research institutions secures €1.5 million grant to build capacity for early drug discovery in sub-Saharan Africa

An African and European research consortium receives €1.5 million from the European Union and additional resources from the Swiss government to support the accumulation of knowledge, skills and innovative capacities for drug discovery in sub-Saharan Africa. The associated project “RAFIKI”, which launched in January 2025, will tackle pressing public health challenges and build new avenues for cooperation between African and European researchers.
Sub-Saharan Africa bears a disproportionate burden of global infectious diseases, with significant ramifications for the public health and development of the African continent. Although recent years have seen promising progress for drug discovery in Africa, local research
communities still lack sufficient infrastructure to develop tailored solutions for these critical public health needs.
Under the European Union’s Horizon Europe funding scheme, the RAFIKI project – short for “EU-Africa Research Infrastructure Alliance to Foster Infectious Disease research, Knowledge sharing and Innovation” (spelling “rafiki”, Swahili for “friend”) – unites key players from the African
and European drug discovery scenes to bring accelerated and sustainable growth to the sub-Saharan African drug discovery community and connect them with global research networks.
Supporting emerging networks for drug discovery in Africa
RAFIKI will complement the Grand Challenges African Drug Discovery Accelerator (GC ADDA). This first-of-its-kind initiative, coordinated by the Holistic Drug Discovery and Development (H3D) Foundation, supports cutting-edge drug discovery research at institutions across Africa to identify new medicines for infectious diseases. Several members of the GC ADDA network are also partners in RAFIKI, allowing RAFIKI to position its holistic capacity building initiatives around existing collaborations.
Building skills and infrastructure
A central mission of RAFIKI is to offer essential training opportunities to sub-Saharan African drug discovery researchers. This investment in training, particularly for early-career researchers, will be pivotal for fostering a highly skilled research ecosystem across Africa.
Prof. Richard Amewu of the University of Ghana, discussing the urgent need to enhance local capacities, shared that the planned training opportunities “will close the knowledge gap in drug discovery and prepare [young scientists in Africa] for venturing into drug discovery research.”
Planned opportunities will include in-person workshops at regional research hubs, mentorship programmes for early-career scientists, and fellowship visits for researchers to learn new skills from partner laboratories.
From the perspective of the Zambian research arena, Dr Peter Cheuka of the University of Zambia is keen to “give an opportunity to Zambian scientists [through the RAFIKI project] to contribute to finding solutions to diseases that afflict the country and the entire continent.” RAFIKI will also establish a small-molecule library and data repository – an effort spearheaded by partners at the H3D Centre at the University of Cape Town and the University of Ghana.
Jessica Akester, Project Manager at the H3D Centre, emphasised that “developing robust sample and data management systems at partner institutions will ensure sustainable data integrity and foundational infrastructure to accelerate research across the continent.”
Fostering international partnerships
Through its international network of expertise, RAFIKI promises to strengthen global collaborations and drive impactful research. EU-OPENSCREEN, a European Research Infrastructure Consortium and coordinating institution of RAFIKI, brings in its consortium of 36 European institutions to support drug discovery in Africa and globally.
Dr Bahne Stechmann, Deputy Director of EU-OPENSCREEN, is eager to strengthen EU- OPENSCREEN's collaborations with African researchers to advance global drug discovery. “Through this initiative, we aim to demonstrate that research infrastructures can have a transformative impact that extends across continents.”
Dr Susan Winks, Chief Operations Officer at the H3D Foundation and leader of the GC ADDA initiative, is further optimistic that RAFIKI will “strengthen the nascent drug discovery ecosystem in Africa, while building stronger connections with European partners in Global Health.”
Dr Elizabeth Kigondu of the Kenya Medical Research Institute, who will focus on establishing a drug discovery hub in Eastern Africa, also noted the RAFIKI consortium’s chance to “cement and enhance the existing collaborations between some African and European institutions, to find
health solutions that not only impact the African continent but the rest of the world.”
The Director General of KEMRI, Prof. Elijah Songok, is “proud to support Dr. Elizabeth Kigondu in her efforts to establish a drug discovery hub in Eastern Africa,” noting that “this initiative represents a significant step toward building Africa’s capacity to develop medicines and therapies tailored for
our populations.”
By connecting partners internationally, RAFIKI will enable critical discussions with external stakeholders and potential funders, as emphasised by Suze Farrell of the Drug Discovery Unit at the University of Dundee: “Combined with infrastructure development and stakeholder engagement, the RAFIKI award will help accelerate the growth of drug discovery in the African continent.”
Alice Neequaye of the Equitable Partnership platform at Medicines for Malaria Venture added: “The challenges faced by infectious disease researchers globally require collaborative efforts, shared expertise, and equitable access to training and infrastructure. By empowering the next
generation of African drug discovery researchers, RAFIKI aims to advance science that benefits everyone.”
The RAFIKI consortium comprises EU-OPENSCREEN, headquartered in Berlin, Germany; the H3D Foundation in Cape Town, South Africa; the University of Dundee Drug Discovery Unit, Dundee, Scotland, United Kingdom; the University of Ghana in Accra, Ghana; the Kenya Medical
Research Institute in Nairobi, Kenya; Stellenbosch University in Stellenbosch, South Africa; the H3D Centre, University of Cape Town in Cape Town, South Africa; the University of Zambia in Lusaka, Zambia; and the Medicines for Malaria Venture in Geneva, Switzerland.
Research, Education / 17.04.2025
Data science? Absolutely!

How does research actually work? What do data scientists and animal caretakers do? This year, 17 girls visited the Max Delbrück Center for Girls' Day – and five boys took part in Boys' Day.
Half of mathematics students are women, and in her own research group, women are well-represented too. “It still shocks me a bit that we’re still talking about girls and women in computer science or math like it’s something unusual,” says Professor Jana Wolf. As a systems biologist, she and her team model cellular processes at the Max Delbrück Center. She’s passionate about giving students a behind-the-scenes look at her work – and at the many paths that lead into biomedical research. She wants girls to pursue their interests without being discouraged by negative comments. “Whether you end up choosing to study physics, biochemistry, systems biology, computer science, or math – is irrelevant,” she tells the 17 girls, aged 13 to 16, who joined the Girls' Day program in Berlin-Buch and Mitte. “We need experts trained in all of these disciplines!”
Lea Wöllner knows just how crucial that kind of advice can be. She's currently working toward her Master’s degree in molecular medicine in the lab of Dr. Markus Mittnenzweig. Before graduating high school, she was overwhelmed by the array of subjects she could study at the university level. The surprised reactions she received when she became interested in bioinformatics applications in medicine confused her even more. “But it’s actually super cool,” she says.
Coding to help Axolotl Amy
Together with PhD students Aurora Elhazaz Fernandez and Meghan Kane, Lea Wöllner guided three girls aged 13 to 15 on a two-and-a-half-hour expedition into the world of single-cell biology – where data is absolutely essential. The scientists created a story: Axolotl Amy gets injured in a competition and loses an arm – the wound needs to heal, and the limb must regrow.
Step by step, they explained what happens inside the body. The right antibodies need to fend off viruses and bacteria, but at the same time, the immune system should not overreact. Their first coding challenge? Finding the right balance in the body. What types of cells does Amy need for her arm to regenerate? Pia, Marilou, and Fatima learned how to use marker genes to identify and annotate different cell groups. The task was no problem for these three young scientists.
Seven labs host students
The Girls' Day event at the Max Delbrück Center was coordinated by Gender Equality Officer Dr. Christiane Nolte and her deputies Dr. Grietje Krabbe and Dr. Ulrike Ohnesorge. This year, they were supported not only by researchers from the Mittnenzweig group, but also by teams led by Dr. Fabian Coscia, Professor Dominik Müller, Professor Jan Phillip Junker, and Dr. Leif Ludwig, as well as by Dr. Inga Patarcic from Research Data Management and Deborah Schmidt, who heads the Image Data Analysis technology platform. Each team developed interactive activities, and the data scientists gave the girls a glimpse into their everyday work.
At the same time, five boys took part in Boys' Day and visited an animal facility on the Buch campus. They got hands-on experience on adhering to strict hygiene protocols, and heard from animal caretaker Jannis Walter about how to care for mice in a research setting.
In the Mittnenzweig lab, Aurora Elhazaz Fernandez placed a petri dish of zebrafish embryos under the microscope. The fertilized eggs develop rapidly, some even within a single day. “They’re moving!” exclaimed Pia. The 14-year-old is a ninth grader at Heinrich-Hertz-Gymnasium in Friedrichshain, a school that specializes in math and science. The girls asked lots of questions – and Elhazaz Fernandez answered them all. “I’ll be back in three months,” Pia said. After a student exchange in France, she plans to intern in the Junker lab, where she hopes to take a closer look at the zebrafish.
www.mdc-berlin.deLiving / 10.04.2025
Einladung zum Anläuten der Kirchenglocken im neuen Turm
Die Kirchglocken der barocken Schlosskirche Berlin-Buch erklingen Ostersonntag zum ersten Mal seit der Zerstörung des Kirchturms im Zweiten Weltkrieg 1943 wieder aus luftiger Höhe. Für alle, die unbeirrt den Wiederaufbau des Turms unterstützt und Spenden gesammelt haben, für alle Bucherinnen und Bucher ist es ein ganz besonderes Ereignis, diesen neuen Klang nach zweieinhalb Jahren Bauzeit zu hören.
Wer das Osterfest mit den neuen Klängen begehen möchte, ist herzlich dazu eingeladen: Start ist am 20.4., 10 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus. Im Laufe des Gottesdienstes geht es zur Kirche hinüber. Nicht nur das Läuten der Glocken wird vom Turm zu hören sein, sondern auch Osterchoräle der Turmbläser:innen.
Dabei sein, wenn die Glocken in den Turm eingebracht werden
Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit werden am 15. April 2025 ab 10:00 Uhr die Glocke wieder ihren angestammten Platz in der Glockenstube im Turm der Schlosskirche erhalten. Wer Zeit hat, kann gern vorbeikommen und zuschauen.
Im Inneren der Kirche wird noch gebaut
Im Mai wird dann das Gerüst umgebaut und der Kran abgebaut. Bis die Kirche vollständig ohne Gerüst zu sehen sein wird, bedarf noch etwas Geduld. Im Innenraum wird noch länger gebaut. Nach der umfassenden Sanierung dürfen sich die Kirchenbesucher:innen erneut auf ein besonderes Erlebnis freuen: Die Neugestaltung mit Kuppel wird beeindruckend sein, und auch die Akustik wird deutlich gewonnen haben.
Unterstützung weiterhin benötigt
Sie können den Bau weiterhin mit Spenden unterstützen:
Ev. KG Berlin – Buch, DE 36 1005 0000 4955 1927 05, BELADEBEXXX, Berliner Sparkasse
Stichwort: Kirchensanierung
Für alle, die das Baugeschehen verfolgen möchten:
https://schlosskirche-berlin-buch.de/kirchensanierung
Gottesdienste an Karfreitag und Ostern:
Karfreitag, 18.4., 10 Uhr Gottesdienst mit Chormusik, Alt Buch 36A im Gemeindehaus
Ostersonntag: 6.00 Uhr Osterfeuer im Gemeindegarten, Alt Buch 36A, mit anschließendem Osterfrühstück, 10 Uhr Festgottesdienst mit den Turmbläser:innen und Anläuten
Research, Innovation, Living, Patient care, Education / 09.04.2025
Der Vorverkauf für die Lange Nacht der Wissenschaften 2025 ist gestartet
Liebe Wissenschafts- und Forschungsbegeisterte,
am Samstag, den 28. Juni 2025, ist es wieder so weit: Die Lange Nacht der Wissenschaften (LNDW) lädt bereits zum 25. Mal dazu ein, hinter die Kulissen der Forschung zu blicken! Von 17 bis 24 Uhr öffnen rund 50 wissenschaftliche und wissenschaftsnahe Einrichtungen ihre Türen und bieten einmalige Einblicke.
"Die Wissenschaft hat sich in 25 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt, ebenso wie die LNDW. Um noch mehr Menschen den Zugang zur faszinierenden Welt der Wissenschaft zu ermöglichen, haben wir in diesem Jubiläumsjahr die Ticketpreise vereinheitlicht und auf fünf Euro gesenkt. Damit laden wir alle Interessierten herzlich ein, Wissenschaft hautnah zu erleben – bei über 1.000 Programmpunkten voller Entdeckungen und Inspiration,“ so Dr. Christina Quensel (Vorsitzende des LNDW e.V. und Geschäftsführerin der Campus Berlin Buch GmbH).
Ab sofort Tickets sichern!
Der Vorverkauf für die LNDW 2025 hat begonnen! Die 5€ Tickets zum Jubiläum sind ab sofort erhältlich unter www.langenachtderwissenschaften.de sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen.
Mit Ihrem Ticket haben Sie Zugang zu allen teilnehmenden Einrichtungen und können zudem kostenlos die Sonderbusse nutzen, die Sie zu Veranstaltungsorten bringen, die nicht direkt vom öffentlichen Nahverkehr erreichbar sind – darunter Adlershof und der Campus Buch.
Rund 50 Einrichtungen und spannende Neuzugänge!
Auch 2025 sind wieder zahlreiche Berliner Universitäten, Hochschulen, Bibliotheken, Bundesämter, Museen sowie renommierte Forschungsinstitute dabei.
Das Programm – online ab Mai
Ob faszinierende Experimente, spannende Vorträge oder beeindruckende Wissenschaftsshows – die LNDW 2025 bietet für jedes Interesse das passende Programm!
Das vollständige Veranstaltungsprogramm wird Anfang Mai auf www.langenachtderwissenschaften.de veröffentlicht.
Bleiben Sie gespannt und sichern Sie sich schon jetzt Ihre Tickets!
Die Lange Nacht der Wissenschaften online
www.langenachtderwissenschaften.de
www.facebook.com/LangeNachtDerWissenschaftenBerlin
www.instagram.com/lndwberlin
www.linkedin.com/company/lange-nacht-der-wissenschaften-berlin/
Quelle: Lange Nacht der Wissenschaften e.V.
Living, Education / 09.04.2025
Einweihung der Gedenktafel „Gräberanlage für Verfolgte des Naziregimes“ auf dem Friedhof Pankow III am 17. April 2025
Eine neue Gedenk- und Informationstafel wird am Donnerstag, dem 17. April 2025 um 16 Uhr auf dem Ehrenhain auf dem Friedhof Pankow eingeweiht (Adresse: Am Bürgerpark 24, 13156 Berlin, Eingang Leonhard-Frank-Straße). Interessierte sind herzlich eingeladen.
Der Ehrenhain für „Revolutionäre, Kämpfer gegen den Faschismus, Verfolgte des Naziregimes und andere bedeutende Persönlichkeiten“ wurde 1978 auf dem Friedhof Pankow III eingerichtet Zur Erläuterung des Ortes und seiner Sichtbarmachung hat die Gedenktafelkommission Pankow nun eine Gedenk- und Informationstafel angebracht. Bei der Veranstaltung sprechen Dr. Cordelia Koch, Bezirksbürgermeisterin und Vorsitzende der Gedenktafelkommission, sowie Gisela Grunwald von der Kreisvereinigung Pankow der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA Berlin-Pankow e.V.). Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Gedenken.
Bezirksbürgermeisterin Dr. Cordelia Koch betont: „Mit der Gedenktafel würdigen wir die Menschen, die dem NS-Terror zum Opfer fielen. Zugleich machen wir Geschichte sichtbar, um demokratische Werte aktiv zu verteidigen“.
Weitere den Verfolgten des Naziregimes gewidmete Gräberanlagen gibt es auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde (Lichtenberg) sowie auf den Friedhöfen Adlershof und Baumschulenweg (Treptow-Köpenick).
Auf der Website des Museums Pankow finden sich weitere Informationen zur Veranstaltung sowie zu Gedenktafeln im Bezirk:
https://www.berlin.de/museum-pankow/geschichte-vor-ort/gedenktafeln/
Research / 07.04.2025
Weiterbildungstag Labor 4.0 für Technische Angestellte und Laborant:innen
Vorträge, Workshops, Networking, Methodentraining, Laborführungen rund um die Themen Digitalisierung, KI, Nachhaltigkeit und Selbstmanagement in den Life Sciences
Termin & Veranstaltungsort:
23. Mai 2025 auf dem Campus Berlin-Buch, Max Delbrück Communcations Center (MDC.C), Gebäude C 83 in der Robert-Rössle-Straße 10 in 13125 Berlin
Informationen zur Buchung:
Sie können ab sofort Ihre Teilnahme am Weiterbildungstag buchen.
Programm:
ab 8:00 Uhr
Registrierung
9:00 – 9:15 Uhr
Begrüßung / Organisatorisches
TAs und Laborant*innen im Life Sciences Labor der Zukunft, Thema im Fokus 2025: KI in den Lebenswissenschaften
Dr. Uwe Lohmeier, Berlin BioScience Academy (BBA) / Gläsernes Labor Akademie (GLA)
9:15 – 10:00 Uhr
Einführungsvortrag
Die Zukunft startet jetzt - wie die KI das Labor erobert
Digitalisierung und Automatisierung veränderten unsere Laborlandschaft. Doch bevor diese umgewandelt sind, steht schon die nächste Veränderung an: Der Einsatz der künstlichen Intelligenz. Im Vortrag werden die Einsatzmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz im Laboralltag beleuchtet und inwieweit die Integration uns alle und die TAs im Besonderen vor neue Herausforderungen stellt.
Dr. Stephan Gantner, Vorstandsvorsitzender des AK-BTA im VBiO e.V.
10:00 – 10:30 Uhr
Kaffeepause
10:30 – 11:30: Session A mit parallelen Veranstaltungen „Wahlpflicht 1“
Vortrag: Next Generation Sequencing“ und künstliche Intelligenz
"Das „Next Generation Sequencing” (NGS) umfasst neuartige Verfahren, mit denen Millionen von Sequenzierreaktionen auf einer sehr kleinen Fläche parallel durchgeführt werden können. Während dadurch der Zeitaufwand der Sequenzanalyse und somit deren Kosten erheblich sinkt, steigt die Menge an generierten Daten ins Unermessliche. Auswertung und vor allem Interpretation der Daten können mit dieser Geschwindigkeit kaum Schritt halten, sind weiterhin von der Ressource „Mensch“ abhängig und bleiben daher kostspielig. Hier können KI-gesteuerte Software-Tools und maschinelles Lernen die Forschenden dabei unterstützen, den Prozess der Datenauswertung zu beschleunigen. Die Session gibt eine Einführung in die aktuellen Methoden des NGS, dessen Anwendung in Forschung und Diagnostik und in den Beitrag, den die KI dabei leisten kann.
Dr. Michael Becker, Experimentelle Pharmakologie & Onkologie Berlin (EPO)
Workshop: MALDI Imaging trifft KI - Labor 4.0 für smarte Gewebeanalysen
Dieser Workshop bietet technisches Know-how und praxisorientiertes Wissen rund um MALDI Imaging und Maschinelles Lernen. Im ersten Teil lernen Sie die Schritte der Probenvorbereitung kennen und erfahren Sie, wie Proben effizient für die Analyse vorbereitet und gemessen werden. Nutzen Sie die generierten Rohdaten, um mithilfe von maschinellem Lernen Gewebe präzise und effizient zu differenzieren. Erweitern Sie mit diesem Workshop Ihre Kompetenzen in der modernen Laboranalytik.
Dr. Benjamin Hempel, FU Berlin
Workshop: Erfolgsfaktor Soft Skills in einer werteorientierten Arbeitswelt Develop Yourself - Forum I
Fachwissen allein reicht nicht für den Erfolg – ohne Soft Skills bleibt Karriere nur Theorie. Dieser Workshop zeigt, warum Unternehmen auf soziale Kompetenzen setzen müssen und wie sie gezielt gefördert werden können. Praxisnahe Einblicke liefern Impulse, um im Berufsalltag wirklich zu überzeugen
Dr. Tuyet-Mai To, Area Manager North-East, Promega GmbH
Führung: Strukturen auf Nanometerebene – Kryo-Elektronenmikroskopie (Führung)
Die Core Facility für Kryo-Elektronenmikroskopie ist eine spezielle Einrichtung für die hochauflösende Bildgebung von biologischen Proben bei kryogenen Temperaturen. Neben anderen Anwendungen wie der Sammlung von Einzelpartikeldaten eignet sich unsere High-End-Instrumentierung für die Durchführung der In-situ Strukturbiologie durch Kombination von cryoCLEM, Lamellen-FIB-Präparation und Kryo-Elektronentomographie.
Dr. Christoph Diebolder, Charité - Universitätsmedizin Berlin
Vortrag: Nachhaltigkeit in der Wissenschaft: Praktische Ansätze für ein umweltfreundliches Labor
In diesem Vortrag wird das Thema Nachhaltigkeit im Labor aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Zunächst stellen wir die Nachhaltigkeitsziele und Initiativen von Thermo Fisher Scientific vor, einem führenden Anbieter von Laborlösungen. Dabei zeigen wir, wie das Unternehmen durch innovative Produkte und Programme zur Förderung der Nachhaltigkeit beiträgt. Anschließend erhalten Sie praktische Tipps zur Umsetzung nachhaltiger Praktiken in Ihrem eigenen Labor. Themen wie Energie- und Ressourceneffizienz, Abfallmanagement, Wasserverbrauch und Chemikalienmanagement werden detailliert behandelt. Besondere Schwerpunkte sind die Reduzierung und das Recycling von Laborabfällen sowie die Nutzung von umweltfreundlichen Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus bieten wir Anregungen, wie Sie auch im privaten Umfeld nachhaltiger agieren können. Abschließend laden wir Sie zu einer offenen Fragerunde und Diskussion ein, um gemeinsam Ideen und Erfahrungen auszutauschen.
Dr. Gundula Sprick, District Manager Biotech Germany – Thermo Fisher Scientific
Führung Experimentelle Ultrahochfeld-MR
"Faszinierend hoch aufgelöste Bilder aus dem Körperinneren – Super-Magneten machen es möglich. Die moderne Ultrahochfeld-Magnetresonanz-Bildgebung bietet neue Einblicke in den Körper des Menschen. Führung durch die Berlin Ultrahigh Field Facility (B.U.F.F.) mit einigen der stärksten Kernspintomographen weltweit. Hinweis: Besucher*innen mit Herzschrittmachern oder Implantaten können NICHT an der Führung teilnehmen.
Stefanie Münchberg und Annett Schoene, MDC, Berlin-Buch
Vortrag: Overview of AI in research and medicine (auf Englisch)
The integrated analysis of large datasets, e.g., from healthcare and research, plays a crucial role in the study and treatment of diseases, understanding disease mechanisms, and improving diagnostic and therapeutic options. This lecture provides an overview of: The fundamentals of AI in research and medicine, the current state of research, potential legal frameworks, ethical considerations, future perspectives.
Tauseef Nauman, Cloud Platforms Manager, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin Institute of Health (BIH), Scientific & IT Coordinator - Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU).
Tierhausführung: „Wie lebt die Maus?“
Gezeigt wird der Lebensraum Tierhaus mit Erklärungen zu Technik und Ausstattung.
Nadja Daberkow-Nitsche, Tierhausleitung & Jessica Berlin, TA Diagnostiklabor, MDC
11:30 – 12:00 Uhr
Kaffeepause
12:00 – 13:00 Uhr Session B mit parallelen Veranstaltungen „Wahlpflicht 2“
Workshop: Entspannungstraining
Häufiger und andauernder Stress kann krank machen. Das Erlernen einer Entspannungsmethode kann Ihnen bei der Stressbewältigung helfen. Mit welcher Technik Sie sich am besten entspannen können finden Sie durch Ausprobieren heraus. In unserem Workshop werden unterschiedliche Methoden der Entspannung von Body-Scan über Fantasiereisen bis hin zur Atementspannung vorgestellt und praktiziert. Diese lassen sich gut in den Alltag integrieren.
Annette Pfister, CampusVital, Berlin-Buch
Workshop: Einstieg in das automatisierte Liquid Handling
In dem interaktiven Workshop werden Grundlagen des automatisierten Liquid Handling vermittelt und es wird auf wichtige Punkte bei der Anschaffung hingewiesen. Im praktischen Teil werden die Teilnehmer*innen mit der Software und dem Gerät vertraut gemacht und können selbst am Gerät tätig werden. Gemeinsam wird mit der Software eine Methode für die Liquid Handling Station erstellt.
Andreas Ehlke, BRAND GmbH + Co. KG, Wertheim
Workshop: Digital solutions in Life Science Labs – Pro’s and Con’s (Englisch)
Digitalization is becoming increasingly important for modern research and development in today's laboratories. This workshop will discuss the role of digital solutions in enhancing data efficiency, traceability, and collaboration, including the shift from traditional paper notebooks to Electronic Lab Notebooks (ELNs), digital assay management tools, and artificial intelligence (AI) applications. We will also discuss the benefits of structured data beyond machine readability and how it can provide critical context for experimental validation and reproducibility, helping to reduce unnecessary assay repetition and streamline analysis. During the session, we will also take you through a hands-on example of integrating digital solutions into daily lab work.
Emilia Hietala, Application Scientist, Collaborative Drug Discovery, (CDD Vault).
Führung: NMR Spektroskopie für Analytik, Biophysik und Screening
Die NMR „Nuclear Magnetic Resonance“ - Spektroskopie liefert Informationen über große wie kleine Moleküle mit atomarer Auflösung. Sie ist eine unverzichtbare Methode für die chemische Synthese, kann wertvolle Information über die Dynamik und Interaktionen von Proteinen liefern und auch zur systematischen Untersuchung von Protein-Ligand-Wechselwirkungen helfen. Die Führung zeigt den Aufbau eine NMR-Spektrometers und Beispiele für die wichtigsten Anwendungen.
Nils Trieloff, Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP)
Workshop: Effektvoll Präsentieren - Inhalte sicher und bleibend vermitteln. "Develop Yourself Forum II
Präsentieren ist Alltag im wissenschaftlichen Arbeitsumfeld. Effektvoll Präsentieren kann man üben und genau das wollen wir Euch vom Team Develop Yourself anbieten. Grundlegende Techniken zum Einsatz von Stimme, Tempo, Gestik, der gezielte Einsatz von Formen und Farben und nicht zuletzt, wie das Publikum miteingebunden werden kann, sollen dabei vermittelt werden. Präsentationstechniken, Tipps und Tricks werden anhand von Beispielen vorgestellt. Anschließend könnt Ihr Fragen stellen und mutige Teilnehmer*innen können einzelne Elemente in kurzen Modellsituationen gleich ausprobieren.
Dr. Thomas Klünner , Sr. Consultant & Trainings Coordinator Promega GmbH
Vortrag: Automatisierte Herstellung von CAR-T-Zellen für klinische Prüfungen
Vorstellung verschiedener Plattformen zur Entwicklung von maßgeschneiderten T-Zell-Immuntherapien mit Anwendungsbeispielen. Wie sicher sind diese Systeme? Welche Anforderungen gibt es aus Sicht der Gentechnikbehörden?
Dr. Marion Kaspari, Gentechnikexpertin, Berlin.
Vortrag: Nanoplattenbasierte dPCR
Hochsensitive und genaue Quantifizierungsmethoden sind für viele molekularbiologische Fragestellungen mittlerweile unabdingbar, sind aber meist mit hohem Aufwand und hohen Kosten verbunden. Lernen Sie, wie die digitale PCR (dPCR) im Nanoplattenformat den Spagat zwischen einfachem Handling und hoher Präzision/Sensitivität bei der Quantifizierung von Nukleinsäuren meistert. Bei dieser Technologie werden Proben in tausende Unter-Partitionen aufgeteilt, so dass in jeder einzelnen Nano-Reaktion entweder keine oder ein oder mehrere Zielmoleküle vorhanden sind. Für die Quantifizierung des Zielmoleküls wird keine Standardkurve benötigt – dadurch werden Fehler reduziert und die Präzision verbessert. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Experten über die Vorteile der Nanoplatten-basierten dPCR zu diskutieren und überzeugen Sie sich selbst davon, wie einfach und schnell dPCR sein kann.
Dr. Ruben Prange, Qiagen GmbH, Hilden
Workshop: Wie KI das Leben im Labor erleichtert
KI betrifft jeden – was bedeutet das für mich und meine Arbeitsroutine? Welche Möglichkeiten gibt es um sich für die Zukunft im Labor mit KI fit zu machen? Der Workshop gibt einen Überblick und praktische Beispiele, u.a. wie man sich seinen eigenen Assistenten schafft oder sich mit Avataren schnell und einfach komplexe Texte erschließen kann
Maik Lange, Bayer AG
13:15 – 14:30 Uhr
Mittagspause und Networking
14:30 – 15:30 Uhr
Paneldiskussion: KI im Labor der Zukunft: Chancen, Risiken
Dr. Hans-Joachim Müller, General Manager Promega; Dr. Stephan Gantner, Vorstandsvorsitzender des AK-BTA im VBiO e.V.; Maik Lange, Bayer AG, Dr. Uwe. Lohmeier, BerlinBioScience Academy, Berlin (Moderation)
15:30 – 16:00 Uhr
Kaffeepause
16:00 – 17:00 Uhr Session C mit parallelen Veranstaltungen „Wahlpflicht 3“
Vortrag: Das CRISPR/Cas-System - DNA gezielt schneiden und verändern
„Genome Editing mittels CRISPR/Cas ist schnell, präzise und kostengünstig. Eine Einführung in diese Technologie vermittelt Grundlagenwissen und nennt Anwendungsbeispiele.
Dr. Michael Strehle, Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC)
Führung: Proteomics - Einblicke in die globale Proteinanalyse mittels Massenspektrometrie
Proteine sind mit die wichtigste Stoffklasse in Zellen und in fast alle zellulären Prozesse involviert. Proteomics, als Teilbereich der Systembiologie, hat dabei das Ziel die Gesamtheit aller Proteine qualitativ und quantitativ zu erfassen. Die Führung in ein Labor am Max Delbrück Center gibt einen Einblick, inwieweit wir dieses Ziel mithilfe der Massenspektrometrie erreichen können. Im Mittelpunkt steht dabei die Vermittlung wesentlicher Praktiken und Methoden.
Dr. Henrik Zauber, MDC
Führung: Campus Berlin-Buch: Wissenschafts- und Technologiestandort
Berlin-Buch ist ein international renommierter Wissenschafts-, Medizin- und Technologiestandort und einer der elf Berliner Zukunftsorte. Rund 6.500 Menschen arbeiten hier in der Gesundheitswirtschaft. Herzstück ist der Campus Berlin-Buch, der exzellente Forschungsinstitute auf den Gebieten der molekularen Medizin und Pharmakologie sowie der klinischen Forschung beherbergt – und einen der größten Biotechparks Deutschlands. Lernen Sie den Campus auf einem Rundgang kennen.
Annett Krause, Campus Berlin-Buch GmbH
Führung: Automatisierte Mikroskopie und Bildanalyse in der Zellbiologie
Nach einer kurzen Einführung in die Fluoreszenzmikroskopie zeigen wir automatisierte Mikroskope bei der Arbeit und wie wir digitale Bilddaten quantitativ auswerten.
Dr. Martin Lehmann, Cellular Imaging Facility (CIF), FMP
Vortrag: Wie hilft uns Bioinformatik in der modernen Welt der Labordatenverarbeitung?
Moderne Analysetechniken führen zu ungeahnten Datenmengen. Um diese Informationen nutzen zu können, bedarf es eines besonderen Datenmanagements. Hier hilft uns die Bioinformatik. Diese Session (/dieser Workshop) beschäftigt sich mit verschiedenen webbasierte biologischen Datenbanken. Anfängern sowie erfahreneren Nutzern wird hier eine Einführung in webbasierte biologische Datenbanken zu Sequenzformaten (GenBank, FASTA), der Speicherung und Bearbeitung von Nukleotid- und Aminosäure-Sequenzen, sowie als Recherchetool geboten.
Dr. Stephan Gantner, Vorstandsvorsitzender des AK-BTA im VBiO e.V.
Vortrag: Effizienter Arbeiten im Labor – Wie GPT den Laboralltag unterstützt. "Develop Yourself - Forum III
KI revolutioniert die Arbeitsweise in biologischen Laboren. Für Medizinisch-Technische Assistenten und z.B. Biologie-Laboranten bietet der Einsatz von GPT-basierter Technologie zahlreiche Vorteile – von der Unterstützung bei der Versuchsdokumentation und Fehleranalyse bis hin zur Optimierung von Protokollen und der schnellen Recherche wissenschaftlicher Informationen. In diesem Vortrag wird praxisnah erläutert, wie GPT als digitales Assistenzwerkzeug genutzt werden kann, um Routineaufgaben effizienter zu gestalten, Prozesse zu verbessern und die Qualität wissenschaftlicher Arbeit zu steigern. Durch konkrete Beispiele wird gezeigt, wie KI-Technologie den Laboralltag erleichtert und zur Weiterentwicklung der Labormethoden beiträgt. Ziel ist es, die Möglichkeiten von GPT verständlich darzustellen und Begeisterung für den Einsatz in biologischen Laboren zu wecken.
Dr. Hans-Joachim Müller, General Manager Promega GmbH
Vortrag: 3D-Druck im Labor 4.0 – Vom Kunststoff bis zum Bioprinting
Die Einsatzmöglichkeiten des 3D-Drucks im Labor sind so vielfältig wie seine Materialien - angefangen von den biobasierten Kunststoffen über lichtsensible Harze bis hin zu Hydrogelen, die es ermöglichen, lebende Zellen zu drucken. Die 3D-Druckverfahren und die Herausforderungen, die das moderne Laborumfeld mit sich bringen, werden anhand von praxisnahen Anwendungen genauer beleuchtet. Zudem wird gezeigt, wie die Nachhaltigkeit durch biologisch abbaubare Materialien und die ressourcenschonende additive Fertigungstechnologie gestärkt wird. Darüber hinaus zeigt ein Ausblick für welche Anwendungen das Bioprinting in Zukunft genutzt werden kann.
Daniel Gorzawski, Gebietsleiter, Carl Roth GmbH + Co. KG
Workshop: Entspannungstraining II (Wiederholung Session B)
Häufiger und andauernder Stress kann krank machen. Das Erlernen einer Entspannungsmethode kann Ihnen bei der Stressbewältigung helfen. Mit welcher Technik Sie sich am besten entspannen können finden Sie durch Ausprobieren heraus. In unserem Workshop werden unterschiedliche Methoden der Entspannung von Body-Scan über Fantasiereisen bis hin zur Atementspannung vorgestellt und praktiziert. Diese lassen sich gut in den Alltag integrieren.
Annette Pfister, CampusVital, Berlin-Buch
17:15 – 17:45 Uhr
Abschlussveranstaltung: Das Labor der Zukunft
Mit einem Quiz fassen wir mit allen die Kernthemen, Inhalte und Take-Home Messages des Tages zusammen.
Dr. Atakan Aydin, MDC; Dr. Uwe. Lohmeier, BerlinBioScience Academy, Berlin (Moderation)
17:45 – 18:00 Uhr
Abschluss und Ausgabe der Teilnahme-Zertifikate
Dr. Uwe. Lohmeier, BerlinBioScience Academy, Berlin
10:30 bis 18:00 Uhr
INDUSTRIEAUSSTELLUNG IM FOYER MDC.C
Brand GmbH + Co. KG, Wertheim; Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe; Collaborative Drug; Discovery, Inc., Cambridge (UK); IntegraBiosciences GmbH, Biebertal; Promega GmbH, Walldorf; Qiagen GmbH, Hilden; Thermo Fisher Scientific, Darmstadt.
Zielgruppe:
Der Weiterbildungstag richtet sich an Technische Angestellte und Laboranten*innen mit abgeschlossener Berufsausbildung.
- Verschaffen Sie sich einen Überblick über Labormethoden und Trends der Zukunft
- Vertiefen Sie Ihr Verständnis für Digitalisierung, KI, Nachhaltigkeit und Selbstmanagment an Ihrem Arbeitsplatz
- Wenden Sie modernste Labortechnik mit den Dozent*innen direkt am Gerät an
- Lernen Sie Life Science Zukunftstechnologien beim Besuch von Laboren auf dem Campus kennen, z.B. am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft oder am Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP)
- Tauschen Sie sich mit Kolleginnen und Kollegen sowie Firmen aus unterschiedlichsten Forschungs- und Entwicklungsbereichen aus
- Erwerben Sie mit der Teilnahme an individuell kombinierbaren Sessions eine persönliche Weiterqualifizierung – bestätigt durch das Abschlusszertifikat der BBA
Termin & Veranstaltungsort:
23. Mai 2025, Campus Berlin-Buch, Max Delbrück Communication Center (MDC.C), C 83, Robert-Rössle-Straße 10, 13125 Berlin
Dauer:
Die Veranstaltung dauert von 9:00 – 18:00 Uhr inklusive Mittags-und Kaffeepausen, Registrierung ab 08:00 Uhr.
Zielgruppe:
Der Weiterbildungstag richtet sich an Technische Angestellte und Laboranten*innen mit abgeschlossener Berufsausbildung aus wissenschaftlichen Einrichtungen, Unternehmen und Servicelabors in den Life Sciences.
Teilnahmegebühr:
195,00 € zzgl. MwSt.
Für Selbstzahlende wird ein Rabatt von 10% auf die Kursgebühr gewährt.
Gemäß dem Berliner Bildungszeitgesetz (BiZeitG) vom 05. Juli 2021 kann für den Weiterbildungstag Bildungszeit geltend gemacht werden.
Bitte beachten: https://www.glaesernes-labor-akademie.de/de/service
Weitere Informationen:
Dr. Uwe Lohmeier per E-Mail: u.lohmeier@campusberlinbuch.de
Quelle: Berlin BioScience Academy
Weitere Informationen und Anmeldung
Research, Living, Patient care / 04.04.2025
In memory of Professor Peter M. Schlag

The Max Delbrück Center mourns the loss of Professor Peter M. Schlag (1948–2025). He was a pioneer of cancer research and a passionate physician. Schlag worked as a group leader at our research center for more than two decades.
A trailblazing researcher, dedicated doctor, visionary, and key figure in cancer research and treatment in Berlin – the Max Delbrück Center mourns the loss of its long-standing colleague and research group leader Professor Peter M. Schlag, who passed away on February 28, 2025.
Schlag belonged to the founding generation of the Max Delbrück Center. Born in Bavaria, he studied medicine at the University of Düsseldorf and completed his medical training at the University of Ulm. He later specialized in surgical oncology and also worked in the United States. In 1982, he was appointed a professorship at the University of Heidelberg. Ten years later, in 1992 – the year our research center was established – he moved to Berlin. On the Berlin-Buch campus at the Max Delbrück Center, he led the Surgical Oncology group until 2013.
Together with Professor Ulrike Stein and his lab team, he made a major contribution to cancer research: They identified a new gene (MACC1) that promotes tumor growth and metastasis in colorectal cancer. When the activity of this gene is low, patients have a better prognosis. Based on this discovery, the researchers developed a blood test to assess the likelihood of a tumor metastasizing. They also showed that MACC1 gene activity is linked to patient prognosis in other types of cancer as well.
Founder of the Charité Comprehensive Cancer Center
Peter Schlag combined scientific curiosity and pioneering spirit with a deep passion for medicine and patient care. “From bench to bedside” – this principle defined his work: From 1992 to 2008, he also served as Director of the Department of Surgery and Surgical Oncology at the Robert Rössle Clinic, Charité, and from 2001 to 2008 as its Medical Director. Providing the best possible treatment to his patients was always his top priority. In 2008, he founded the Charité Comprehensive Cancer Center at Charité – Universitätsmedizin Berlin, which he led until 2013.
Schlag was ahead of his time in recognizing the potential of computer-assisted surgery. He developed 3D visualization tools for surgical planning and helped shape clinical practice through the introduction of new technologies. He also conducted research on innovative therapeutic approaches such as tumor cell vaccination, hyperthermia and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy – a method that combines surgery with chemotherapy for certain abdominal cancers.
A member of the German National Academy of Sciences Leopoldina since 2002, Schlag received numerous awards, including the K. H. Bauer Prize of the German Society for Surgery (1981), the Scientific Award of the European Society of Surgical Oncology (1984), and the Carlo Erba Research Award (1986). In 1999, together with Professor Walter Birchmeier of the Max Delbrück Center, he was honored with the German Cancer Award.
Beyond the lab and the clinic, Schlag also advocated for cancer research and patient care, serving as chair of the Berlin Cancer Society (2005–2015) and founder of the Berlin Cancer Foundation.
Schlag was an outstanding scientist and physician. At the Max Delbrück Center, we remember him as a valued colleague, dedicated mentor, and inspiring role model for clinician scientists. Our deepest condolences go out to his family and all who worked with him.
Living / 02.04.2025
Neu: Kostenlose Hilfe bei Steuererklärung für Senior:innen
Die Seniorenvertretung Pankow bietet ab sofort eine kostenlose Information bei der Erstellung der Steuererklärung für das Jahr 2024 an. Die Erklärung für 2024 muss bis spätestens 30. Juni 2025 abgegeben werden. Ob eine Steuererklärung für Rentner:innen erforderlich ist und welche Aspekte dabei zu berücksichtigen sind, erläutert Rechtsanwalt Horst Beckmann, Mitglied der Pankower Seniorenvertretung und ehrenamtlicher Fachmann auf diesem Gebiet.
„Die kostenlose Hilfestellung zur Steuererklärung ist eine wunderbare Unterstützung für unsere älteren Bürgerinnen und Bürger“, sagt Dominique Krössin, Bezirksstadträtin für Soziales und Gesundheit. „Es ist uns ein Anliegen, dass alle Rentner:innen die Möglichkeit haben, ihre steuerlichen Pflichten einfach und stressfrei zu erfüllen. Wir möchten, dass sich jeder gut informiert und unterstützt fühlt“, so die Stadträtin weiter.
Anmeldung erforderlich
Um das Angebot zu nutzen, ist eine Anmeldung erforderlich. Rechtsanwalt Horst Beckmann ist unter der E-Mail-Adresse lens_13129@gmx.de für Terminabsprachen erreichbar. Die nächsten Beratungstermine im Büro der Seniorenvertretung im Bezirksamt Pankow finden an den folgenden Tagen jeweils von 10 bis 12 Uhr statt: 16. und 23. April, 15. Mai und 18. Juni 2025.
Weitere Informationen bei der Seniorenvertretung Pankow, Fröbelstraße 17, Haus 2, Raum 330, 10405 Berlin.
/ 31.03.2025
Unraveling cell polarity with the help of AI
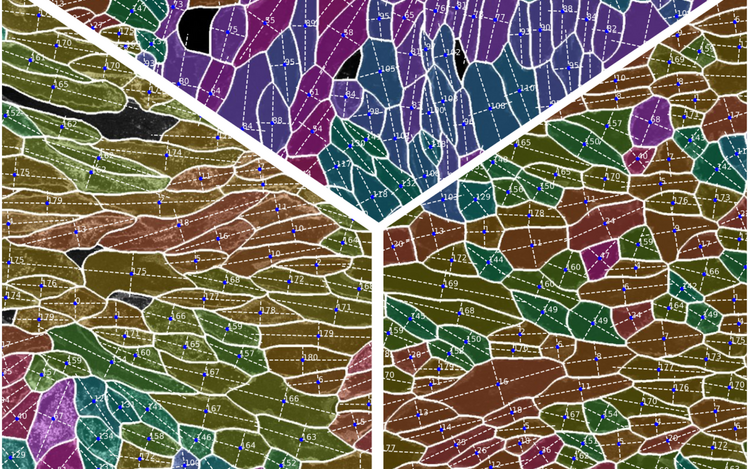
Max Delbrück Center and Helmholtz Imaging scientists have developed open-source software that simplifies the study of cell polarity with fluorescence microscopy. Published in “Nature Communications,” the innovation may streamline research on many basic biological processes such as tissue repair.
At first glance, the human body may appear symmetrical. But a closer look might reveal many asymmetries – a crooked smile, or a foot larger than the other. On a microscopic level, our cells too are not uniform, but rather show cell polarity – an asymmetry in their shape, structure or the organization of their cellular components. Studying cell polarity with florescence microscopy can yield clues about health and disease. But turning microscopy data into knowledge has been hampered by the incompatibility of existing tools.
In a study led by Dr. Wolfgang Giese in the Integrative Vascular Biology lab of Professor Holger Gerhardt at the Max Delbrück Center and Jan Philip Albrecht, a computer scientist working with Deborah Schmidt (Image Data Analysis platform) at Helmholtz Imaging, researchers introduce Polarity-JaM – an open-source, freely available and user-friendly tool to analyze cell polarity data from fluorescence microscopy images. The study was published in “Nature Communications.”
“We wanted to create a tool that enables scientists, including those with minimal programming experience, to explore and analyze cell polarity data in a straightforward and reproducible way,” says Giese. “By integrating circular statistics and user-friendly visualization, Polarity-JaM helps researchers uncover patterns in cell behavior that were previously difficult to analyze quantitatively.”
Addressing a challenge in cell image analysis
Researchers study cell polarity to better understand processes such as tissue repair, organ development and immune responses. But despite advances in fluorescence microscopy that have made it easy to capture detailed images of cell polarity, tools to analyze the data remain fragmented, time-consuming, or require specialized coding skills. This makes large-scale, reproducible research nearly impossible.
Polarity-JaM combines analyses of cell polarity, morphology, and cell-cell contact formation among other features into a single, holistic software package that takes advantage of deep learning.
The tool quantifies and helps to visualize multiple aspects of cell polarity, including the position of Golgi organelles with respect to cell nuclei, cell shape and orientation, and the location of cellular organelles, to name just a few examples. To demonstrate the tool’s capabilities, the researchers showed that they could study how endothelial cells alter their shape, orientation, and signaling responses when exposed to different shear stresses – conditions that mimic blood flow.
Understanding cell polarity can help to explain how the body maintains healthy organs and tissues and what goes wrong in diseases like cancer, cardiovascular disorders, and inflammation, says Gerhardt. “The ability of machine learning-based segmentation tools to accurately identify and outline cells within a microscopic image almost as well as a human expert exceeded our expectations,” he adds. “It demonstrates the potential for further automation in biological research and beyond, freeing up scientists to focus on higher-level analysis and discovery.”
An open-source solution
The researchers have made Polarity-JaM documentation and tutorials available at https://polarityjam.readthedocs.io. The site includes a how-to video, ensuring that users can easily learn and apply the tool to their research. In addition, a web-based application hosted at www.polarityjam.com enables researchers to perform circular statistical analyses – which involves analyzing data that is circular in nature such as angles or the orientation of cellular structures in 3D space – and visualize their data without requiring users to install software, making the tool accessible to a broader audience.
“The open-source nature of Polarity-JaM allows researchers, developers, and the wider scientific community to contribute, improve, and expand its capabilities, ensuring continuous development and adaptation to new research challenges,” says Albrecht. The team is now looking to expand the capabilities of PolarityJaM to be able to analyze 3D tissue and organoid models, for example. They also hope to include analyses of other subcellular structures, time lapse imaging and dynamic tracking to study how cell polarity evolves over time, and to add other features as well.
Figure: The image shows how cell polarity changes when endothelial cells are exposed to different shear stress parameters – conditions which mimic blood flow. © Julia Kraxner, Emir Akmeric (Gerhardt Lab), Jan Philipp Albrecht (Helmholtz Imaging)
Patient care, Education / 31.03.2025
Curious minds at UniStem Day 2025

Around 220 high school students from across Berlin came to the conference center of the Max Delbrück Center in Buch in mid-March with one topic on their minds: stem cell research. For the tenth time, the German Stem Cell Network (GSCN, stem cell research dialogue platform at BIH) hosted UniStem Day.
“The talks were a total hit!” – the biology-loving students were thrilled by the range and depth of stem cell research they encountered during UniStem Day. The day was packed with information: in the lecture hall Axon 1, Dr. Sebastian Diecke welcomed the students on behalf of the Max Delbrück Center, and Dr. Daniel Besser (GSCN) introduced them to the field.
Things got even more engaging with Professor Simone Spuler (Max Delbrück Center), who gave a compelling and easy-to-follow talk about her research and early clinical trials on muscular dystrophies. Spuler and her team use CRISPR gene editing to modify muscle stem cells. Professor Sina Bartfeld (TU Berlin) took the students on a molecular journey into the development of the stomach and intestine, leading to the creation of intestinal organoids – a new and fascinating topic for many of the participants. The final talk came from Professor Christof Stamm (Deutsches Herzzentrum at Charité), who presented regenerative therapy approaches for the human heart, captivating the audience with impressive images from his heart surgeries.
After a break, the students headed into their workshops: exploring organoids with Dr. Ines Lahmann in Dr. Mina Gouti’s lab, learning about gene and cell therapies with Dr. Elke Luger, discussing animal research with Nadja Daberkow-Nitsche, understanding CRISPR-Cas9 with Dr. Michael Strehle, debating the ethics of germline intervention with Hannah Schickl, discovering the rescue efforts for the northern white rhino with Dr. Vera Zywitza and Steven Seet, exploring the Max Delbrück Center’s biobank with Dr. Jürgen Janke, and identifying lichens on campus with Uwe Lohmeier.
This year, the startup lab tours received particularly enthusiastic feedback. Companies like FyoniBio, CARTemis Therapeutics GmbH, and Silence Therapeutics welcomed students from biotech-focused high schools, sparking lively conversations and insightful questions.
All in all, it was a fantastic day filled with hands-on science, respectful discussion, molecular insights, visionary researchers – and a big gain in perspective for the students into the world of scientific discovery.
Text: Stefanie Mahler, GSCN
Innovation / 27.03.2025
Eckert & Ziegler: Record year 2024 with new all-time highs
Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) achieved a new record in the 2024 financial year with sales of € 295.8 million based on the preliminary annual financial statements*. Compared to the previous year, sales increased by almost € 50 million (+20%). EBIT before special items from continuing operations (adjusted EBIT) rose by around € 19.0 million to € 65.9 million (+40%) compared to the previous year. Net income increased by € 7.0 million (+27%) to € 33.3 million, corresponding to earnings per share of € 1.60.
In the Medical segment, sales increased by € 33.2 million (+29%) to € 148.4 million. The growth in sales was driven in particular by strong demand in radiopharmaceuticals.
The Isotope Products segment generated sales of € 147.5 million, an increase of € 16.6 million (+13%) compared to the previous year. This rise is attributable to both annual price adjustments and volume effects.
For the 2025 financial year, the Executive Board expects sales of around € 320 million and EBIT from continuing operations before special items (adjusted EBIT) of around € 78 million. The forecast is based on a weighted average exchange rate of USD 1.05 per euro.
* The presentation of the final audited and approved annual financial statements will follow a few days later, solely due to the outstanding technical ESEF tagging, which will take additional time due to the cyber-attack in February 2025. The Executive Board's proposal on the appropriation of the net profit and a corresponding resolution by the Supervisory Board will be made promptly and in the context of the Supervisory Board's balance sheet meeting on the annual financial statements for the 2024 financial year.
The preliminary 2024 financial statements can be found here: https://www.ezag.com/fy2024en/
About Eckert & Ziegler.
Eckert & Ziegler SE with more than 1.000 employees is a leading specialist for isotope-related components in nuclear medicine and radiation therapy. The company offers a broad range of services and products for the radiopharmaceutical industry, from early development work to contract manufacturing and distribution. Eckert & Ziegler shares (ISIN DE0005659700) are listed in the TecDAX index of Deutsche Börse.
Contributing to saving lives.
Living / 27.03.2025
Sommerferienreisen für Kinder und Jugendliche – Bis 20. Juni Anmeldung beim Jugendamt möglich
Das Jugendamt Pankow bietet in den kommenden Sommerferien wieder Reisen für Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 17 Jahren an. Ob ein Trip ans Meer, an den See, in den Wald; ob nach Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen oder Bayern – es ist für alle etwas dabei.
Vielfältige Reiseziele und Konzepte
In Kooperation mit vier Partnerorganisationen hat das Jugendamt insgesamt elf verschiedene Reisen für entdeckungsfreudige junge Menschen zusammengestellt. Die Konzepte sind genauso vielseitig wie die Reiseziele in Bolmsö (Schweden), Le Marze (Toskana), St. Maximin (Frankreich), Pyrenäen und Costa Brava (Spanien), Rathen, Lübben, Kiez Frauensee, Versmold, Altenhausen, Klietz und Schönberger Strand.
Bei den meisten Angeboten steht das gemeinsame Naturerleben im Vordergrund.
Anmeldung bis 20. Juni möglich
Voraussetzung für eine Teilnahme ist, dass die Kinder und Jugendlichen ihren Wohnort im Bezirk Pankow haben. Für die Teilnahme sind Kostenbeteiligungen vorgesehen, die bei Vorlage entsprechender Nachweise ermäßigt werden können. Der Anmeldeschluss ist am 20. Juni 2025.
Weitere Informationen und Online-Anmeldung auf der Website des Jugendamtes:
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/sommerreisen/
Kontakt im Jugendamt Pankow bei Rückfragen zu den Reisen:
jug.reisen@ba-pankow.berlin.de
Innovation / 20.03.2025
Eckert & Ziegler and AtomVie Global Radiopharma Sign a Global Agreement for Lutetium-177 Supply
Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) and AtomVie Global Radiopharma Inc. (AtomVie) today announced a global supply agreement. Eckert & Ziegler will provide its high-quality non-carrier added Lutetium-177 chloride (n.c.a. Lu-177, Theralugand®) to support AtomVie’s CDMO activities for radiopharmaceutical manufacturing.
The collaboration covers both early and late-stage development and extends to global programs. Through this partnership, Atomvie secures reliable access to Theralugand®, which will enable further development of Lu-177 based radiopharmaceuticals in their facility. The flexibility of the agreement makes it possible to respond dynamically to the needs of pharmaceutical partners at different stages of radiopharmaceutical development and commercialization, while addressing regulatory requirements worldwide.
“We are happy to support AtomVie in advancing global radiopharmaceutical development programs with Theralugand®,” stated Dr. Harald Hasselmann, CEO of Eckert & Ziegler SE. “By providing our high-quality radionuclides, we vitally contribute to the further development of therapeutic approaches in nuclear medicine.”
Bruno Paquin, CEO of AtomVie commented “Partnering with Eckert & Ziegler is a significant step in ensuring that our global partners developing Lutetium-177 based radiopharmaceuticals have the support they need. With our new facility set to open later this year, this collaboration enhances our ability to provide reliable, high-quality manufacturing services. Together with our partners, we look forward to further advancing innovation and transforming patients' lives.”
About Eckert & Ziegler
Eckert & Ziegler SE, with more than 1,000 employees, is a leading specialist in isotope-related components for nuclear medicine and radiation therapy. The company offers a broad range of services and products for the radiopharmaceutical industry, from early development work to contract manufacturing and distribution. Eckert & Ziegler shares (ISIN DE0005659700) are listed in the TecDAX index of Deutsche Börse.
Contributing to saving lives.
About AtomVie Global Radiopharma Inc.
AtomVie is a global leading CDMO for the GMP manufacturing and worldwide distribution of clinical and commercial radiopharmaceuticals. AtomVie offers the full range of scientific, technical, regulatory, quality and logistics combined with a specialized infrastructure for the development of radiopharmaceuticals from clinical studies to the commercial marketplace. AtomVie currently serves international clients conducting studies in over 25 countries worldwide. For more information, visit https://www.atomvie.com/
Source: Press Release Eckert & Ziegler
Research, Innovation, Patient care / 19.03.2025
Leibniz-Preis für 2 Berliner Spitzenforschende: Prof. Ana Pombo vom Max Delbrück Center und Prof. Volker Haucke vom FMP
Prof. Dr. Ana Pombo, Genombiologin am Max Delbrück Center für Molekulare Medizin (MDC) und Prof. Dr. Volker Haucke Biochemiker und Zellbiologe am Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP) werden heute in der Brain City Berlin mit dem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis ausgezeichnet. Der wichtigste deutsche Forschungsförderpreis und ist mit jeweils 2,5 Millionen Euro dotiert. In diesem Jahr wird er bereits zum 40. Mal verliehen.
Wenn heute im Abend im Café Moskau der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis feierlich vergeben wird, können sich zwei Berliner Forschende besonders freuen: Dr. Ana Pombo, Vizedirektorin des Berliner Institut für Systemische Sytembiologie am Max Delbrück Center und Professorin für „Transkriptionale Regulation und Genom-Architektur“ an der Humboldt-Universität zu Berlin und Professor Volker Haucke, Direktor des Leibniz-Forschungsinstituts für Molekulare Pharmakologie (FMP) in Berlin und Professor für Molekulare Pharmakologie an der Freien Universität Berlin gehören zu den zehn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die heute mit dem wichtigsten begehrten deutschen Forschungspreis geehrt werden.
Volker Haucke erhält die mit jeweils 2,5 Millionen Euro dotierte Auszeichnung für seine bahnbrechende Forschung im Bereich Lipidsignaling und der synaptischen Signalübertragung. In seiner Arbeit hat er neue Erkenntnisse über das Zusammenspiel von neuronalen Proteinkomplexen, die Zellkommunikation und Mechanismen beim Abbau zelleigener Bestandteile gewinnen können. Seine Forschungsergebnisse gehen beispielsweise in die Entwicklung neuer Ansätze für therapeutische Anwendungen in der Krebsforschung ein. Volker Haucke studierte Biochemie an der Freien Universität Berlin und promovierte am Biozentrum der Universität Basel. Nach einem Postdoc-Aufenthalt an der Yale University leitete er eine Nachwuchsgruppe an der Universität Göttingen. 2003 kehrte er als Professor für Biochemie an die FU Berlin zurück. Seit 2012 leitet er das Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie in Berlin. Volker Haucke erhielt zahlreiche Preise und Förderungen, darunter einen ERC Advanced Grant und den Feldberg-Preis 2020. Er ist unter anderem Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, der Academia Europaea und der European Molecular Biology Organization (EMBO).
Ana Pombo entwickelte neue Methoden, um in einzelnen Zellen die dreidimensionale Organisation von DNA zu kartieren. Als Erste entdeckte sie wichtige Kontakte innerhalb von Chromosomen, aber auch zwischen verschiedenen Chromosomen. Ihre Entdeckungen ermöglichen es unter anderem, Krankheitsprozesse besser zu verstehen. Die gebürtige Portugiesin Ana Pombo studierte zunächst Biochemie an der Universität Lissabon. Nach der Promotion an der Universität Oxford arbeitete sie als Gruppenleiterin am MRC London Institute of Medical Sciences des Imperial College London. 2013 kam sie als Laborleiterin an das Max Delbrück Center in Berlin-Buch. Zeitgleich übernahm sie die Professur an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ana Pombo ist stellvertretende Direktorin des MDC-BIMSB und stellvertretende Programmsprecherin des Max Delbrück Center. 2007 erhielt sie den Robert-Feulgen-Preis. Sie ist außerdem Mitglied der European Molecular Biology Organization (EMBO) und der Europäischen Akademie der Wissenschaften.
Der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis wird seit 1986 jährlich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) verliehen. Inklusive der diesjährigen Auszeichnungen wurden in 40 Jahren 428 Leibniz-Preise an Forschende aus Natur-, Geistes-, Lebens- und Sozialwissenschaften verliehen. Da der Preis und das Preisgeld in Ausnahmefällen geteilt werden können, ist die Zahl der Ausgezeichneten höher als die der Preise. Insgesamt haben bisher 455 Nominierte den Preis erhalten: 377 Wissenschaftler und 78 Wissenschaftlerinnen. Das Preisgeld können die Preisträgerinnen und Preisträger bis zu sieben Jahre lang ohne Vorgaben für ihre Forschung verwenden. (vdo)
Mehr Informationen
- Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis 2025
- https://www.mdc-berlin.de/de/news/press/leibniz-preis-geht-ana-pombo
- https://leibniz-fmp.de/de/newsroom/news/detail/professor-volker-haucke-mit-leibniz-preis-2025-der-deutschen-forschungsgemeinschaft-geehrt
Quelle: BrainCity Berlin
https://braincity.berlin/stories/story/leibniz-preis-fuer-2-berliner-spitzenforschende
Research / 17.03.2025
Inflammatory messenger fuels Alzheimer’s
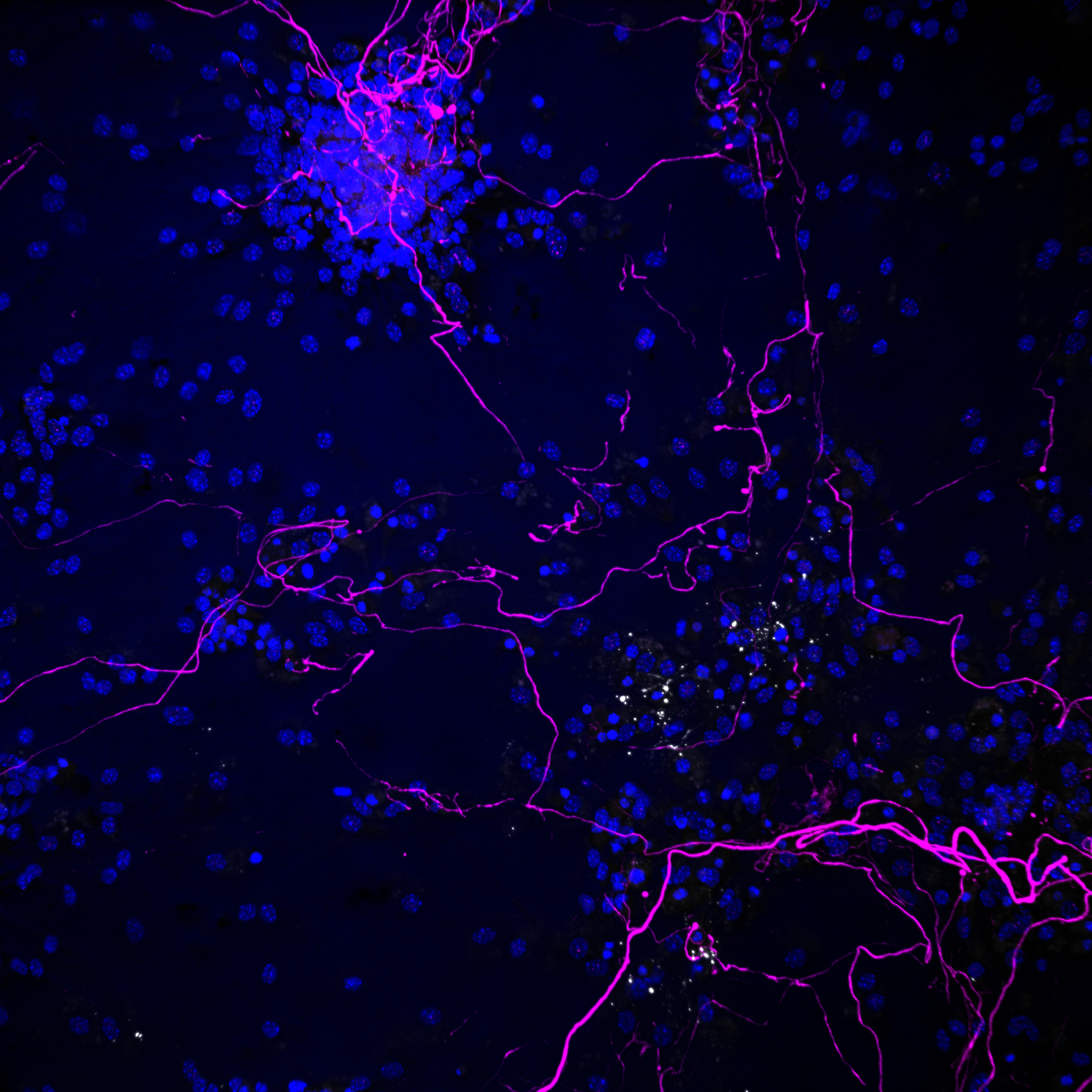
Researchers from Charité – Universitätsmedizin Berlin and the Max Delbrück Center have detailed the precise mechanism through which the inflammatory signaling molecule IL-12 contributes to Alzheimer’s disease. The study was published in the journal “Nature Aging.”
Joint press pelease of Charité – Universitätsmedizin Berlin and the Max Delbrück Center
Microglia, the brain’s immune cells, usually serve as diligent guardians. They eliminate intruders such as microbes and clear away cellular debris – including the plaques typical of Alzheimer’s disease. However, as our brains age, microglia also change. While some continue to function effectively, others gradually lose their protective role and start secreting small amounts of inflammatory messengers.
One such messenger is interleukin-12 (IL-12). Through meticulous analyses, research teams led by Professor Frank Heppner, Director of the Department of Neuropathology at Charité – Universitätsmedizin Berlin, and Professor Nikolaus Rajewsky, Director of the Berlin Institute for Medical Systems Biology at the Max Delbrück Center (MDC-BIMSB), along with additional partners, have identified how IL-12 might trigger and accelerate Alzheimer’s dementia. Their study, published in “Nature Aging,” could pave the way for new combination therapies.
“For decades, Alzheimer’s research focused almost exclusively on amyloid-beta and tau deposits, while inflammation was considered a side effect,” says Heppner. “Only recently have we begun to recognize that inflammatory processes may be a primary driver of disease progression.” In 2012, Heppner’s lab reported in Nature Medicine that blocking IL-12 and IL-23 significantly reduced Alzheimer’s-related brain changes in mice. “But we couldn’t unravel the underlying mechanism with standard techniques,” Heppner explains. He reasoned that single cell analyses might provide more decisive clues, so he asked Rajewsky to collaborate.
Sticky and tangled brain cells
Throughout life, cells refer to their genetic instructions to respond to external stimuli. Researchers use single-cell analyses to observe this process, reconstructing which genes are being read and translated into proteins in thousands of individual cells simultaneously. These analyses generate massive datasets, which can now be analyzed with the help of artificial intelligence and machine learning. However, a major challenge in using single cell sequencing technology is isolating individual cells from a tissue sample without damaging them or causing unintended changes. “In aging mouse brains – especially those with Alzheimer’s plaques – cells are so stuck together and tangled that separating them cleanly is nearly impossible,” Rajewsky explains.
His team spent several years perfecting a workaround. Instead of isolating entire cells, they extract cell nuclei from brain tissue and analyze the RNA present in each cell. By cross-referencing with publicly available data, such as the Allen Brain Atlas, they can ensure that their method provides a representative snapshot of all cell populations. For the present study, they sequenced RNA from over 80,000 cell nuclei and developed specialized workflows to process the data. They also reconstructed communication between cells. “Our teams repeatedly sat together to try to interpret this highly complex data,” Rajewsky says. “This painstaking early optimization was crucial – without it, we would not have been able to detect these connections.”
How IL-12 damages the Alzheimer’s brain
IL-12, previously known primarily for its role in autoimmune diseases like Crohn’s disease and rheumatoid arthritis, appears to play a pivotal role in Alzheimer’s progression. It damages two key brain cell types: mature oligodendrocytes, which normally produce myelin – the fatty insulating layer around nerve fibers essential for rapid signal transmission; and interneurons, which are particularly important for cognition and memory. IL-12 binding to interneurons causes them to die. A vicious circle begins: As more microglia produce IL-12, more brain cells sustain damage. Meanwhile, remaining functional microglia become overburdened by the task of clearing the additional cellular debris, and thus fail to remove Alzheimer’s plaques.
To verify this mechanism, researchers tested it in mice and in human tissue. When Heppner's team blocked IL-12 in cell cultures and mouse models, they could stem disease-related changes. Electron micrographs of mouse brain tissue taken at the Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences in Göttingen also showed how myelin structure and nerve fiber density changed depending on whether the IL-12 signaling pathway was present or absent. Mass spectrometric analyses (lipidomics) at the University of Zurich confirmed the altered composition of the fat-rich insulating layer. Study of autopsy tissue from Alzheimer's patients provided further confirmation of the results – the more advanced the disease, the more IL-12 was present in the tissue. Cell cultures with human oligodendrocytes were also extremely sensitive to IL-12.
Potential combination therapy
“We now have a highly detailed picture of this mechanism, with single-cell technologies serving as a crucial catalyst. The only remaining question is which cell type IL-12 impacts first – oligodendrocytes, interneurons, or both simultaneously,” says Heppner, who is also Group Leader in Neuroimmunology at the Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE).
The study has immediate implications as there are already drugs on the market that block IL-12. The researchers hope that clinicians will build on their findings and initiate clinical trials. “If these drugs prove effective, they would be a new arrow in the quiver. Alzheimer's doesn't just have one cause. One axis of the disease is also controlled by the immune system, at least in some patients. Slowing neurodegeneration will require combination therapy,” Heppner emphasizes. Such an approach could start early in the disease process, as IL-12 can be measured in blood or cerebrospinal fluid, he adds.
Meanwhile, the teams at Charité and the Max Delbrück Center are exploring a new hypothesis: Could microplastic in the brain drive microglia to produce IL-12? “Microglia may struggle to process microplastic, triggering inflammatory reactions,” Rajewsky suggests. “This could reveal a link between environmental factors and widespread diseases.” While unproven, both teams consider it a compelling and important research direction.
Further information
- N. Rajewsky Lab
- Systems Biology of Gene Regulatory Elements
- Heppner lab
- Press release on Nature Medicine study from 2012
Living / 17.03.2025
Erstes Pankower Klimaschutzkonzept veröffentlicht
Sein erstes Klimaschutzkonzept hat jetzt das Bezirksamt Pankow veröffentlicht. Ab sofort stehen die vollständige Fassung und eine Kurzversion auf der Website der Leitstelle Klimaschutz unter www.berlin.de/ba-pankow/klimaschutzkonzeptzum Download bereit.
Mit über 419.000 Einwohner:innen ist Pankow der zweitgrößte Bezirk Berlins – und bis 2030 wird ein Bevölkerungswachstum von mehr als 16 Prozent erwartet. Diese Entwicklung, zusammen mit den zunehmenden Auswirkungen der Klimakrise, macht ambitionierte Maßnahmen in Klimaschutz und Klimaanpassungunerlässlich und stellt den Bezirk vor große Herausforderungen.
Das Klimaschutzkonzept wurde zwischen März 2023 und August 2024erarbeitet und am 15. Oktober 2024 vom Bezirksamt beschlossen. Die Datenerhebung endete im August 2024. Erstmals wurde umfassend analysiert, wie viel Energie der Bezirk verbraucht, welche Maßnahmen bereits umgesetzt wurden und welche weiteren Schritte erforderlich sind, um die Berliner Klimaziele zu erreichen. In enger Kooperation der beteiligten Ämter und der Öffentlichkeit entstand so eine fundierte Grundlage für das künftige Klimaschutzengagement Pankows.
Konkretes Maßnahmenpaket
Das Konzept umfasst über 40 Maßnahmen, die gemeinsam mit den Fachämtern entwickelt wurden, um den Klimaschutz im Bezirk voranzutreiben. Darunter ist beispielsweise das Thema nachhaltige Mobilität: Die Radinfrastruktur im Bezirk wird ausgebaut und der Straßenraum soll sozial- und klimafreundlicher gestaltet werden. Dazu gehört auch die Umsetzung weiterer Kiezblocks. Zudem wird die Nutzung erneuerbarer Energien in öffentlichen Gebäuden verstärkt und die Machbarkeit von Dach- und Fassadenbegrünung geprüft und umgesetzt. Im Rahmen der Städtebauförderung werden Quartiere zunehmend klimaangepasst umgestaltet, unter anderem durch Maßnahmen wie Entsiegelung oder Regenwasserbewirtschaftung. Innovative Sharing-Konzepte wie die „Bibliothek der Dinge“ tragen zur Reduzierung von Verschwendung bei, indem sie gemeinschaftliche Nutzung statt Neukauf fördern. Eine ausführliche Beschreibung aller Maßnahmen findet sich im vollständigen Klimaschutzkonzept
Leitstelle Klimaschutz mit neuer Webseite
Erste Maßnahmen werden auch bereits umgesetzt. Beispielsweise wurde im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes die Webseite der Leitstelle Klimaschutz umfassend überarbeitet und optimiert. Diese Maßnahme fiel in das Handlungsfeld „Private Haushalte und Konsum“ und zielt darauf ab, eine effektive Klimakommunikation zu fördern. Die Webseite bietet Interessierten eine klar strukturierte, benutzerfreundliche Plattform, die gezielt Wissen vermittelt und das Bewusstsein für Klimaschutz stärkt. Neben der verbesserten Nutzung schafft sie Transparenz über aktuelle und geplante Klimaschutzprojekte im Bezirk. Ein besonderer Fokus lag darauf, nicht nur zu informieren, sondern die Bevölkerung aktiv für Klimaschutz zu begeistern.
„Mit der optimierten Webseite schaffen wir eine wichtige Grundlage, um Klimaschutz für alle greifbarer zu machen, bezirklichen Klimaschutzprojekte vorzustellen und den Umsetzungsstand des Klimaschutzkonzeptes aufzuzeigen. Es ist uns ein Anliegen, die Menschen mitzunehmen, ihnen Wissen an die Hand zu geben und sie für einen nachhaltigen Alltag zu motivieren,“ erklärt Angelika Haaser, die Klimaschutzbeauftragte von Pankow.
Die Webseite stellt zudem relevante Informationen, Tipps und praktische Hinweise bereit, wie sich Bürgerinnen und Bürger im Alltag klimafreundlicher verhalten können.
Kontakt: Leitstelle Klimaschutz Pankow, E-Mail: Klimaschutz@ba-pankow.berlin.de
Living / 12.03.2025
Pankow setzt auf Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Raum – Zielvereinbarung zwischen Senat und Bezirk unterzeichnet
Der Berliner Senat und das Bezirksamt Pankow haben eine Zielvereinbarung zum Thema „Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Raum“ unterzeichnet. Ziel der Initiative ist es, durch regelmäßige Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen die Müllverschmutzung im Bezirk nachhaltig zu reduzieren und so das Stadtbild sowie die Aufenthaltsqualität zu verbessern.
Überwachung durch „Waste Watcher“
Die Zielvereinbarung ist zunächst bis zum 31. Dezember 2025 befristet und umfasst Maßnahmen, die direkt vor Ort umgesetzt werden. Der Bezirk erhält dafür Sachmittel in Höhe von 20.000 Euro, um individuelle Präventionsstrategien entwickeln und umsetzen zu können. Zudem wurden zwei befristete Stellen für sogenannte „Waste Watcher“ bewilligt, die im Laufe des Jahres zügig besetzt werden sollen. Sie werden an bekannten Müll-Hotspots Kontrollen durchführen und die Einhaltung der Sauberkeitsvorgaben überwachen. Ein Fokus liegt dabei auf der Bekämpfung von Kleinstablagerungen wie Hundekot und Zigarettenkippen sowie größeren Ablagerungen, etwa Sperrmüll und Gewerbeabfällen. Die Einsatzkräfte werden gezielt in Bereichen aktiv, die häufig von Verschmutzungen betroffen sind. Außerdem sind Präventionsmaßnahmen im Rahmen von Sperrmüll-Kieztagen und anderen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen geplant, um über die Auswirkungen von illegalem Müll im öffentlichen Straßenland aufzuklären.
Die Bezirksstadträtin für Ordnung und Öffentlichen Raum, Manuela Anders-Granitzki: „Im letzten Jahr erhielt das Ordnungsamt Pankow mehr als 17.500 Meldungen aus der Bevölkerung zu Problemen mit Müll im öffentlichen Raum. Das sind mehr als doppelt so viel wie noch im Jahr 2019 und 4.000 Meldungen mehr als im Jahr 2023. Jede einzelne Meldung ist eine zu viel. Mit dieser Zielvereinbarung gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung einer sauberen und lebenswerten Stadt. Sauberkeit im öffentlichen Raum ist ein grundlegender Beitrag für die Lebensqualität der Menschen in Pankow. Neben der Zielvereinbarung wird Pankow daher auch im Jahr 2025 an den überaus erfolgreichen und gemeinsam mit den Berliner Stadtreinigungsbetrieben durchgeführten Sperrmüll-Kieztagen sowie an den aus dem vergangenen Jahr bekannten Aktionstagen zur Beseitigung sogenannter Schrotträder festhalten. Bis die zusätzlichen „Waste Watcher“ ihren Dienst aufnehmen können, werden wir im Rahmen der personellen Möglichkeiten und unter Berücksichtigung des sonstigen Einsatzgeschehens entsprechende Maßnahmen bereits mit dem Bestandspersonal intensivieren“.
Living, Education / 12.03.2025
Pankower Frauenpreis 2025 an Alexandra Torres verliehen
Anlässlich des Internationalen Frauentages wurde am 10. März 2025 der diesjährige Pankower Frauenpreis an Alexandra Torres verliehen. Sie erhielt den Preis im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im BVV-Saal des Bezirksamtes Pankow.
Wer ist Alexandra Torres?
In seiner Laudatio würdigte Dr. Oliver Jütting, Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung Pankow, Alexandra Torres und fasste die Schwerpunkte ihrer Arbeit zusammen: „Die Stärkung von Frauen, der Austausch alter und neuer Nachbarinnen und Nachbarn und natürlich die gelebte Mehrsprachigkeit der Menschen vor Ort.“
Selbst aus Kolumbien immigriert, gelang es Alexandra Torres, ein tragfähiges Netzwerk von migrantischen und nichtmigrantischen Gemeinschaften aufzubauen. Auf dieser Grundlage übernahm sie 2018 die Koordination des Projekts "Buch und Karow in Bewegung" des Vereins MaMis en Movimiento e.V. Ursprünglich darauf ausgerichtet, Frauen und Mädchen der spanisch- und arabischsprachigen Gemeinschaften in Karow und Buch zu unterstützen, bezog das Projekt mehr und mehr Frauen und Mädchen ein, die in Unterkünften lebten.
Als Netzwerkerin und Vermittlerin bot Alexandra Torres mehrsprachige Empowerment-Workshops, kulturelle Veranstaltungen und IT-Kurse an, brachte in den Stadtteilbibliotheken Menschen, Kompetenzen und Erfahrungen zusammen.
In Würdigung all dieser Leistungen wurde Alexandra Torres „für ihren engagierten Einsatz für geflüchtete Frauen, Kinder und Familien in Pankow sowie für ihr besonderes Engagement für Menschen in Buch und Karow“ ausgezeichnet. Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert.
Nominierte für den Frauenpreis 2025:
• Carolin Gaffron, Bildung4Finance gUG
• Michi Brosig und Nadine Hoff, OC 23 Jugendclub und tivo* -Zentrum für feministische Mädchen*arbeit
• Ina Rosenthal
• Alexandra Torres, MaMis en Movimiento e.V.
• Xochicuicatl e.V.
Pankower Frauenpreis ehrt seit 2020 gleichstellungspolitisches Engagement
Der Pankower Frauenpreis wurde 2019 durch die Bezirksverordnetenversammlung Pankow initiiert und im darauffolgenden Jahr erstmalig verliehen. Bisherige Preisträgerinnen sind Renate Laurentius (2020), Raja Al Khlefawi (2021), Christina „Tina“ Pfaff (2023) und Malalai Murr (2024). Im Jahr 2022 konnte der Preis aufgrund der Haushaltssperre im Land Berlin nicht verliehen werden.
Der Preis ehrt Einzelpersonen, Frauenprojekte, Initiativen oder Unternehmen in Pankow, die sich im Bezirk für die Rechte von Frauen und Mädchen einsetzen und die Geschlechterdemokratie fördern. Ausgezeichnet wird das besondere gleichstellungspolitische Engagement, welches beispielsweise auf die Einhaltung und Förderung der Rechte von Frauen und Mädchen abzielt, marginalisierte Frauengruppen unterstützt oder innovativ-nachhaltige Gleichstellungsprojekte entwickelt.
Living, Education / 11.03.2025
Kommunale Begegnungsstätten für Jung und Alt in Pankow werden Anmeldestellen für "KulturLeben Berlin"
Der Verein KulturLeben Berlin – Schlüssel zur Kultur e.V. vermittelt seit 15 Jahren kostenlos nicht verkaufte Kulturplätze an Menschen mit geringem Einkommen. Ob Theater, Ausstellungen, Museen, Varieté, Kabarett, Konzerte oder Sport – dank 600 Kulturpartnern können Menschen mit kleinem Budget eine Vielzahl an Kulturerlebnissen genießen. Pro Monat stehen 4.000 Kulturplätze zur Verfügung. Die kommunalen Begegnungsstätten in Pankow sind beginnend ab März 2025 offizielle Anmeldestellen für das KulturLeben-Angebot.
Pankower:innen mit geringem Einkommen können sich ab sofort in den Begegnungsstätten für das Kulturprogramm registrieren lassen. Anmelden können sich alle Menschen, die maximal 1.100 Euro (netto) monatlich zur Verfügung haben oder staatliche Transferleistungen beziehen. Zur Anmeldung wird lediglich ein Einkommensnachweis benötigt.
Die Bezirksstadträtin für Soziales und Gesundheit, Dominique Krössin, erklärt: „Die Partnerschaft mit KulturLeben Berlin e.V. ist ein wichtiger Schritt, um das kulturelle Angebot für alle Pankowerinnen und Pankower zugänglich zu machen. Wir freuen uns, Teil dieses großartigen Projekts zu sein, das es ermöglicht, dass jede und jeder in unserem Bezirk die vielfältige Kultur von Berlin erleben kann – unabhängig von finanziellen Möglichkeiten.“
Über KulturLeben Berlin – Schlüssel zur Kultur e.V.:
KulturLeben Berlin – Schlüssel zur Kultur e.V. setzt sich dafür ein, dass Menschen mit wenig Geld an kulturellen Erlebnissen teilhaben können. Mit mehr als 600 Kulturpartnern bietet der Verein eine breite Palette an kostenlosen Tickets für Veranstaltungen in Berlin. Das Angebot wird durch zahlreiche soziale Partnerorganisationen unterstützt, die bei der Anmeldung und Beratung helfen.
Termine in den Pankower Begegnungsstätten:
Begegnungsstätte Am Friedrichshain
Am Friedrichshain 15, 10407 Berlin
Telefon 030 425 4821
jeden zweiten Donnerstag im Monat von 10:00 – 12:00 Uhr ab 13.03.2025
Begegnungsstätte An der Panke im Stadtteilzentrum
Schönholzer Str. 10a, 13187 Berlin
Telefon 030 4741 1234
jeden vierten Dienstag im Monat von 14:30 – 16:30 Uhr seit 25.02.2025
Begegnungsstätte Tollerstraße
Tollerstraße 5, 13158 Berlin
Telefon 030 916 6050
jeden ersten Freitag im Monat von 14:00 – 16:00 Uhr ab 04.04.2024
Begegnungsstätte Am Kollwitzplatz
Husemannstr. 12, 10435 Berlin
Telefon 030 442 2514
jeden letzten Donnerstag im Monat von 11:00 – 13:00 Uhr ab 27.03.2025
(Ausnahme Mai: 22.05.2025 / also vorletzter Donnerstag im Monat)
Begegnungsstätte Am Arnimplatz
Paul-Robeson-Str. 15, 10439 Berlin
Telefon 030 4471 9955
jeden zweiten Donnerstag im Monat von 14:00 – 16:00 Uhr ab 13.03.2025
Weitere Informationen zur Anmeldung unter: https://kulturleben-berlin.de/gast-werden/
Kontakt:
KulturLeben Berlin – Schlüssel zur Kultur e.V.
Presseabteilung
Email: presse@kulturleben-berlin.de
11.03.2025
Projekt „Bäume für Pankow“ startet am 17. März
„Bäume für Pankow“ heißt eine Aktion des Umwelt- und Naturschutzamtes Pankow, die am Montag, dem 17. März 2025 startet. Dann haben Interessierte aus Pankow die Möglichkeit, sich für die Pflanzung eines hochstämmigen Laubbaumes auf ihrem Grundstück zu bewerben. Das Umwelt- und Naturschutzamt stellt die Bäume kostenlos zur Verfügung und übernimmt auch die Kosten für die fachgerechte Pflanzung durch eine Fachfirma. Nicht nur Eigentümerinnen und Eigentümer, sondern auch Mieterinnen und Mieter können sich bewerben, sofern sie die Zustimmung ihres Vermieters einholen.
Bewerbungen bis 31. Mai möglich
„Bäume verschönern nicht nur das Landschaftsbild, sondern bieten auch einen wichtigen Lebensraum für zahlreiche Tierarten. Sie tragen zur Verbesserung der Luftqualität und des Mikroklimas bei und sind in stark verdichteten urbanen Gebieten als Schattenspender sowie als Staub- und Schadstofffilter sehr wertvoll“, erklärt Manuela Anders-Granitzki, Bezirksstadträtin für Ordnung und Öffentlichen Raum. „Aus diesem Grund fördert das Pankower Umwelt- und Naturschutzamt die Pflanzung neuer Bäume auf Privatgrundstücken mit Mitteln aus der Ausgleichsabgabe gemäß der Baumschutzverordnung“, so die Stadträtin weiter.
Der Bewerbungsschluss ist der 31. Mai 2025.Weitere Informationen und das Online-Bewerbungsformular gibt es auf der Bezirksamts-Website:
10.03.2025
Absage des BSR-Kieztages am 11.03.2025 am Hofzeichendamm in Karow
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di hat die Beschäftigten der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) für die gesamte Woche vom 10.-15. März zum Streik aufgerufen. Deshalb kann der morgige BSR-Kieztag am Hofzeichendamm in Karow nicht stattfinden.
Es wird darum gebeten, keinen Sperrmüll an der geplanten Veranstaltungsfläche abzuladen. Es ist vorgesehen, dass zeitnah ein Ersatztermin angeboten wird.
Weitere BSR-Kieztage in Bezirk Pankow: https://www.berlin.de/ba-pankow/sperrmuell
Research, Patient care / 07.03.2025
Inequality raises disease risk, especially for women
A study led by researchers at the Max Delbrück Center has found that low socioeconomic status raises the risk of cardiovascular disease in women more so than in men. The study underlines the importance of gender-specific prevention.
A growing number of studies are reporting gender differences in diseases such as stroke, heart attack and high blood pressure. “It is known from previous studies that a lower socioeconomic status is associated with a higher cardiovascular risk. The relationship between social status and the cardiovascular risk profile, and in particular whether this relationship differs between men and women, has been insufficiently researched in Germany to date,” says Professor Dr. Tobias Pischon, an author of the publication and member of the Board of Directors of NAKO e.V. The German National Cohort (NAKO) is Germany's largest long-term study on the development of diseases.
The researchers analyzed data from 204,780 participants in the NAKO collected between 2014-2019 – 50% of the participants are women. The analysis was based on self-reported information on socioeconomic factors such as education, income and employment status, the use of antihypertensive medication, chronic cardiovascular and metabolic conditions, lifestyle factors such as smoking and alcohol consumption, as well as measured values from medical examinations at the NAKO study centers, such as blood pressure, blood test results and other measurements. The scientists took various other factors into account in the calculations.
Heart attack, high blood pressure, overweight
The study found that women with low socioeconomic status were more likely to have an adverse cardiovascular risk profile compared to a comparable group of men and women with high socioeconomic status. “In women compared with men, low socioeconomic status was more strongly associated with myocardial infarction, hypertension, obesity, use of antihypertensive medication and risky alcohol consumption, but – in contrast to men – less strongly associated with active or former smoking,” says Dr. Ilais Moreno Velásquez, scientist at the Max Delbrück Center in Berlin-Buch and lead author of the study. In addition, “compared to those with a high socioeconomic status, women with low education and income had higher odds of a high 10-year risk of cardiovascular events than men of comparable socioeconomic status.”
Pischon and his team plan to investigate the correlations further: “In our current evaluation, we have estimated the risk of future cardiovascular events on the basis of internationally established algorithms. With the many scientifically valuable data that we are gaining from the NAKO study through repeated examination of study participants, we will be able to check these results in the future with regard to newly diagnosed cardiovascular diseases. Overall, however, our results already indicate that the risk of cardiovascular disease in women is more strongly dependent on social status than in men. For our health policy in Germany, this underscores the importance of taking social inequalities into account in cardiovascular disease prevention strategies,” says Pischon.
07.03.2025
Wohlfühlmomente beim Sprechlaufwandern erleben
Pankow. Sich in der Natur bewegen, den Kopf freibekommen für die eigene Lebensplanung und andere Mütter kennenlernen: Das alles ermöglicht ein neues Projekt für Alleinerziehende im Bezirk Pankow.
Ziel des neuen Projektes des Sozialunternehmens „Sprechlaufwandern“ ist es, den Teilnehmerinnen neue Perspektiven zu eröffnen, mit denen sie einen Weg aus dem „Hamsterrad“ ihres Alltags finden. In der Regel stehen für Alleinerziehende ihre Kinder an erster Stelle. Eine Balance zwischen deren Erziehung und beruflichen Herausforderungen zu finden, kostet Kraft. Manchmal fällt den Müttern dabei sprichwörtlich „die Decke auf den Kopf“. Das eigene gesundheitliche und psychische Wohlbefinden rückt leider oft in den Hintergrund.
Mit einem neuen, ganzheitlichen Ansatz möchte das Projekt „Perspektive für Alleinerziehende“ die Teilnehmerinnen dabei unterstützen, Körper, Seele und Geist zu stärken. Dabei wird die persönliche und berufliche Entwicklung auf unterschiedlichen Ebenen gefördert.
Kern des Projektes sind wöchentliche Wandertouren durch die Natur. Gemeinsam werden zwischen acht und zehn Kilometer durch herrliche Gegenden in und um Berlin gelaufen. Geschulte Buddies begleiten die Gruppe. Beim Wandern können die Teilnehmerinnen andere Alleinerziehende kennenlernen, mit ihnen ins Gespräch kommen und neue Kontakte knüpfen. Bei den Touren kommen sie aber nicht nur in Bewegung, sie bekommen bei frischer Luft auch den Kopf frei.
Neben dem Sprechlaufwandern bietet dieses neue Projekt außerdem ein Coaching für all die Teilnehmerinnen an, die Interesse daran haben. Ziel dieser Kombination aus körperlicher Herausforderung und Anregungen zur Alltagsbewältigung ist es, die physische und psychische Gesundheit zu stärken.
Dass es dieses neuartige Projekt für Alleinerziehende in Pankow gibt, ist der „Erfinderin“ von Sprechlaufwandern, Claudia Kerns zu verdanken. Sie erprobte die förderliche Wirkung des gemeinsamen Wanderns in kleinen Gruppen durch die Natur bereits mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Weil ihre Idee in der Praxis so gut angenommen wurde, erfand sie dafür das Kompositum „Sprechlaufwandern“, das übrigens noch nicht im Duden steht.
Dass sie es nun explizit zur Förderung des Wohlbefindens und zur Stärkung Alleinerziehender anbieten kann, ist dem Land Berlin und dem Europäischen Sozialfonds Plus zu verdanken. Diese stellen für das Projekt die nötigen Mittel zur Verfügung, damit Alleinerziehende kostenfrei an diesem Projekt teilnehmen können.
Das Sprechlaufwander-Projekt für Alleinerziehende startet am ersten Juni-Wochenende 2025. Es läuft dann über sechs Wochen mit jeweils einer Tour durch die Natur pro Woche. Zeit und Treffpunkt werden mit den Teilnehmerinnen abgestimmt.
Im Vorfeld des Projektstarts finden alle zwei Wochen Online-Informationsveranstaltungen statt, die erste am 20. März um 16.30 Uhr, die letzte am 15. Mai um 16.30 Uhr. Außerdem wird sich die Gruppe vor der ersten Wanderung einmal vor Ort in den Räumlichkeiten der Sprechlaufwandern GmbH treffen.
Alleinerziehende, die an diesem neuen kostenfreien Projekt teilnehmen möchten, können sich ab sofort über den Link https://bit.ly/alleinerziehend-pankow anmelden.
Bildunterschrift zu den Fotos:
Beim neuen Projekt von „Sprechlaufwandern“ stellen sich die Teilnehmerinnen körperlichen Herausforderungen und bekommen zugleich den Kopf frei, um neue Perspektiven für sich entwickeln zu können. © Sprechlaufwandern GmbH/ Archiv Claudia Kerns
Kontakt:
Sprechlaufwandern GmbH
Boxhagener Straße 16
Alte Pianofabrik
10245 Berlin
Telefon +49.151.20236645
E-Mail service@sprechlaufwandern.de
07.03.2025
Girls’ Day am 3. April 2025: Ein Tag mit der Bezirksstadträtin
Am Donnerstag, dem 3. April 2025 lädt die Bezirksstadträtin für Ordnung und Öffentlicher Raum, Manuela Anders-Granitzki, in der Zeit von 9:00 – 15:00 Uhr Pankower Schülerinnen ab dem 12. Lebensjahr für einen Blick hinter die Kulissen kommunaler Bezirkspolitik und Verwaltung ein. Ziel ist es, Mädchen aus dem Bezirk einen Einblick in geschlechteruntypische Berufsgruppen des Bezirksamts zu ermöglichen und sich nach Möglichkeit an der einen oder anderen Stelle auch einmal selbst auszuprobieren. Nach einer Einführung durch die Bezirksstadträtin werden die Schülerinnen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes sowie des Straßen- und Grünflächenamtes in die jeweiligen Aufgabenbereiche eingeführt.
Einblicke in die Aufgaben von Ordnungsamt, Straßen- und Grünflächenamt und Lebensmittelkontrolle
Durch verschiedene Aktivitäten wird im Laufe des Girls’ Days anschaulich dargestellt, wie spannend und abwechslungsreich die Arbeit in der Bezirksverwaltung sein kann. Hierzu zählt ein gemeinsamer Rundgang mit den Mitarbeitern des Ordnungsamtes in der Fröbelstraße, eine Präsentation der für Schulessen und Lebensmittelhygiene zuständigen Lebensmittelkontrolleure sowie der Besuch eines Revierstützpunktes im Bürgerpark Pankow inkl. Tiergehege.
„Der Girls’ Day soll den Schülerinnen einen Einblick in Berufe ermöglichen, in denen Frauen noch immer unterrepräsentiert sind und von denen sie vielleicht noch gar keine konkrete Vorstellung haben. Der Girls’ Day erfüllt außerdem den Wunsch von Kindern und Jugendlichen nach früher beruflicher Orientierung. Ich wünsche mir, dass wir die Schülerinnen durch diesen hoffentlich für sie spannenden Tag für eine zukünftige berufliche Tätigkeit im Bezirksamt begeistern können“, betont Manuela Anders-Granitzki.
Aktuell sind nur noch wenige freie Plätze verfügbar. Wer Fragen hat oder sich anmelden möchte, kann sich per E-Mail an das Büro der Bezirksstadträtin wenden: buero.umordsga@ba-pankow.berlin.de
Weitere Informationen:
https://www.girls-day.de/.oO/Show/bezirksamt-pankow-gb3/berlin/ein-tag-mit-der-bezirksstadtraetin
Research / 05.03.2025
New treatment approach for rare blood cancer of the skin
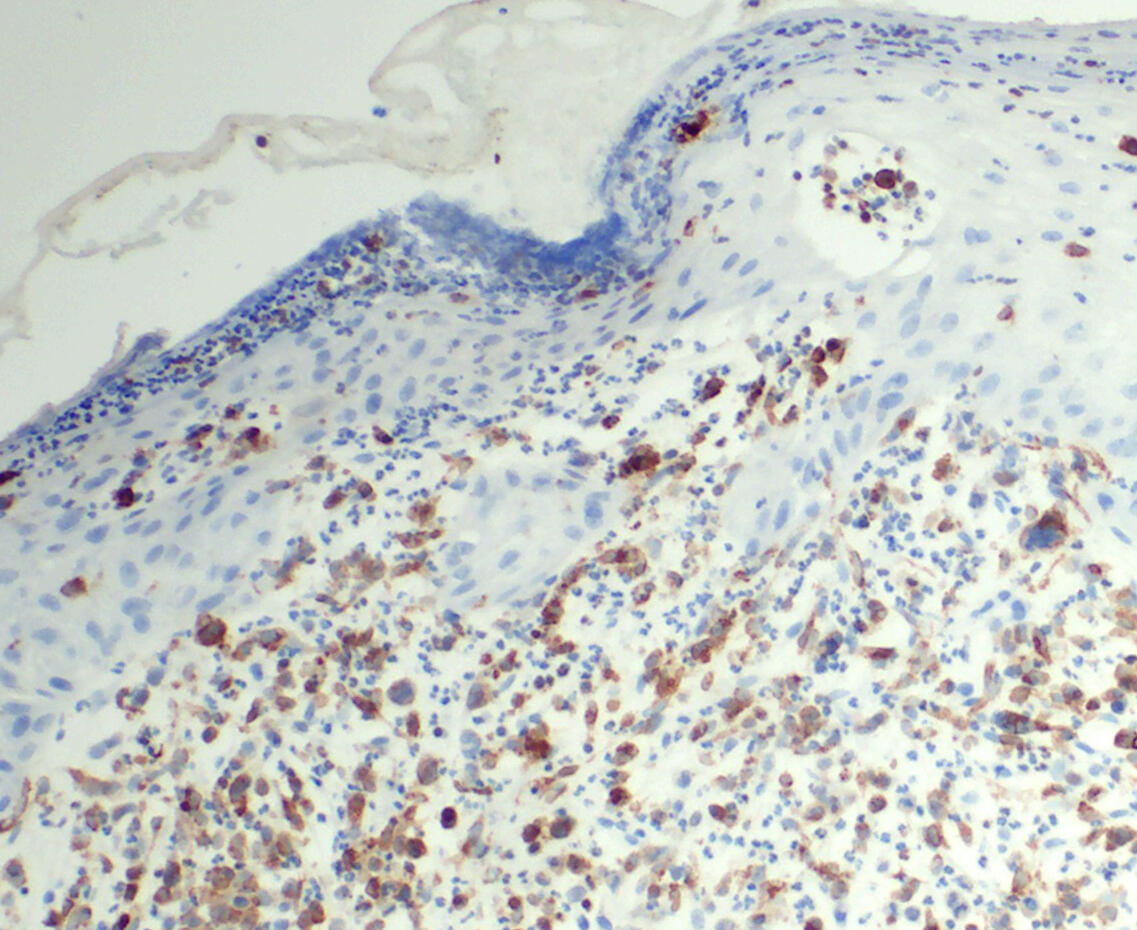
Researchers from Medical University of Vienna, Charité Berlin and Max Delbrück Center have identified the CD74 protein as a new drug target to treat deadly skin lymphoma. The study was published in the “British Journal of Dermatology.”
Cutaneous T-cell lymphoma (CTCL) is a rare form of blood cancer that primarily affects the skin. In Europe, the disease is diagnosed in about 0.5 per 100,000 inhabitants per year. Advanced stages are associated with a poor prognosis and quality of life.
A team of researchers led by Professor Olaf Merkel in the Department of Experimental Pathology at Medical University of Vienna and Professor Stephan Mathas at the Experimental and Clinical Research Center, a joint institution of the Max Delbrück Center and Charité – Universitätsmedizin Berlin, points to CD74 protein as a promising new target for innovative therapies to treat CTCL. In a preclinical model, the researchers showed that so-called antibody-drug conjugates (ADCs), which specifically bind to CD74, can effectively kill CTCL cells.
New therapeutic approach for a difficult-to-treat disease
Although monoclonal antibodies and ADCs are already successfully being used to induce remission in CTCL patients, existing treatments do not provide a cure. ADCs that target CD74 offer a potentially new treatment approach. The research team showed that CD74 is strongly and consistently expressed in various CTCL subtypes, including particularly difficult-to-treat forms such as Sézary syndrome and advanced stages of mycosis fungoides.
“Our results show that CD74 is not only an attractive target molecule for antibody therapy, but that its blockade can lead to complete tumor eradication in preclinical models,” says Merkel. It is particularly noteworthy that the treatment was highly effective even in TP53-defective CTCL cells - an aspect of great clinical relevance. TP53 is an important tumor suppressor gene that is mutated in many cancers.
The basis for future clinical studies
The study findings provide a solid basis for further developing new antibody-based treatments that target CD74 and pave the way for clinical trials. “Our results open up new perspectives for the treatment of CTCL patients who currently have inadequate treatment options,” add the study authors.
The researchers see CD74-targeted therapy as an especially promising approach to improve treatment for patients with advanced CTCL, who currently have very limited options.
Research, Innovation, Patient care, Education / 03.03.2025
“Jugend forscht” at Campus Berlin-Buch

From better 3D printers for biological structures to soil remediation with microorganisms – in the 60th round of “Jugend forscht,” regional students presented their exciting research projects on the Berlin-Buch campus.
“Turn questions into answers” – this challenge inspired many Berlin students to once again participate in the nationwide “Jugend forscht” and “Jugend forscht Junior” competitions. At sponsor institution Campus Berlin-Buch, 37 projects from a total of 84 were on display. On February 26, young researchers presented their projects to the jury and to the public. Participants also had the chance to visit laboratories at the Max Delbrück Center, the Leibniz Research Institute for Molecular Pharmacology, and the biotech company FyoniBio. Additionally, they conducted hands-on experiments in two workshops at the Gläsernes Labor student lab.
Students aged 10 to 18 participated in the competition, exploring a wide range of exciting and practical research questions such as: How can AI and stenography improve keyboards, whether bacteria or fungi can help clean copper-contaminated soil, and how to build an affordable 3D printer for research projects involving cell structure. Other topics included developing an environmentally friendly alternative to glow sticks, finding solutions to remove pollutants and plastic from plants, testing coffee grounds as a substitute for traditional fertilizers, and analyzing how slime molds react to heat. Former national Jugend forscht winner Alois Bachmann competed again in the Mathematics/Informatics category with his project “The next GENErAltion – deciphering transcription factors with AI.” And Amelie Stadermann once again won a regional victory in biology in the Jugend forscht category — she won an award last year in the Junior category.
At the award ceremony, Kirstin Bodensieck, acting Administrative Director of the Max Delbrück Center, welcomed the participants: “You have set out to find answers to research questions that are important to society — whether in biology, technology, or sustainability. Each project and your dedication to science are remarkable and have helped make our world a little more understandable. Just like the scientists on our campus who tackle urgent health questions to better understand and treat diseases.”
Bodensieck encouraged the young researchers to stay curious: “Why not pursue a career in science one day? Feel free to reach out to us, take a look at the everyday life of researchers, and seize the opportunity for a future as a scientist.”
Award ceremony and special prizes
The jury awarded nine first-place prizes – seven in the Jugend forscht category and two in the Jugend forscht Junior category. The winners will have the opportunity to advance to the state competition held at the Technical University of Berlin.
In addition to first through third place prize winners, special awards recognized achievements in areas such as Resource Efficiency, Environmental Technology, and Renewable Raw Materials. Some winners received exclusive invitations to visit the Berlin-Buch campus, the Free University campus, or the DESY research laboratory.
The three outstanding projects that won the special prize are:
- Biology: “Substrates in NFT Aquaponics – A Comparative Study” by Jan Brüggemann, Luca Wroblewski, and Hannes Schweizer (Martin-Buber-Oberschule)
- Mathematics/Informatics: “Can synthetically generated training data improve AI object recognition models?” by Tom Smee (Nelson-Mandela-Schule)
- Technology: “A low-cost bioprinter for printing structures from biocompatible materials” by Rufus Dreger (John-Lennon-Gymnasium)
Additionally, Campus Berlin-Buch GmbH awarded a special prize for outstanding commitment in the Jugend forscht category to project mentor Sascha Werner from Kurt-Tucholsky-Oberschule.
“We are always impressed by the dedication students bring to their projects. Jugend forscht inspires young people to engage with STEM subjects, learn scientific methods, and to fiddle with and to stick to scientific research,” says Dr. Ulrich Scheller. “A big thank you also goes to our volunteer jury, whose members provided valuable motivation and guidance for the young researchers.”
We congratulate the winners of the regional competition at Campus Berlin-Buch!
Workplace
Vibbodh Somani, Yamahn Tanjour, Sarah Ali
Nelson-Mandela-Schule
“Creating More Efficient Keyboards with AI and Stenography”
Best Interdisciplinary Project (Workplace)
Youanna Banjamin, Johann Bredemeyer, Paul Bierbüße
Heinrich-Hertz-Gymnasium
“Device for Assessing Motor Conditions Using Artificial Intelligence”
Biology
Lilja Gemballa, Liese Kalklösch, Frederik Maass
Rückert-Gymnasium
“Nurturing Coffee”
Amelie Stadermann, Cosima Tödt
Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner
“Physiological Stress Memory? The Slime Mold During and After Temperature Stress”
Leo Heinkelmann, Ella Bahat Treidel, Kjell Wenzel (Jugend forscht junior)
Martin-Buber-Oberschule
“Bacteria vs. Fungi – Comparing Microorganisms for Copper-Contaminated Soil Remediation”
Chemistry
Josephine Kosin, Stella Maria Blöbaum, Frederik Bär
Lessing-Gymnasium
“NatürLICHT – The Environmentally Friendly Alternative to Glow Sticks”
Tim Gies, Emilia Schröter, Theodor Rauschning (Jugend forscht junior)
Grundschule am Tegelschen Ort
“Cola against Rust – Does the Type of Soda Make a Difference?”
Mathematics/Informatics
Tom Smee
Nelson-Mandela-Schule
“Can Synthetically Generated Training Data Improve AI Object Recognition Models?”
Victor Güsmar
Heinrich-Hertz-Gymnasium
“Angles of View in the Plane”
Physics
Vibbodh Somani, Bhuvana Reddi, Kerem Semiz
Nelson-Mandela-Schule
“Acceleration of Water Rockets”
Further information
Research, Patient care / 25.02.2025
Not all heart inflammation is the same
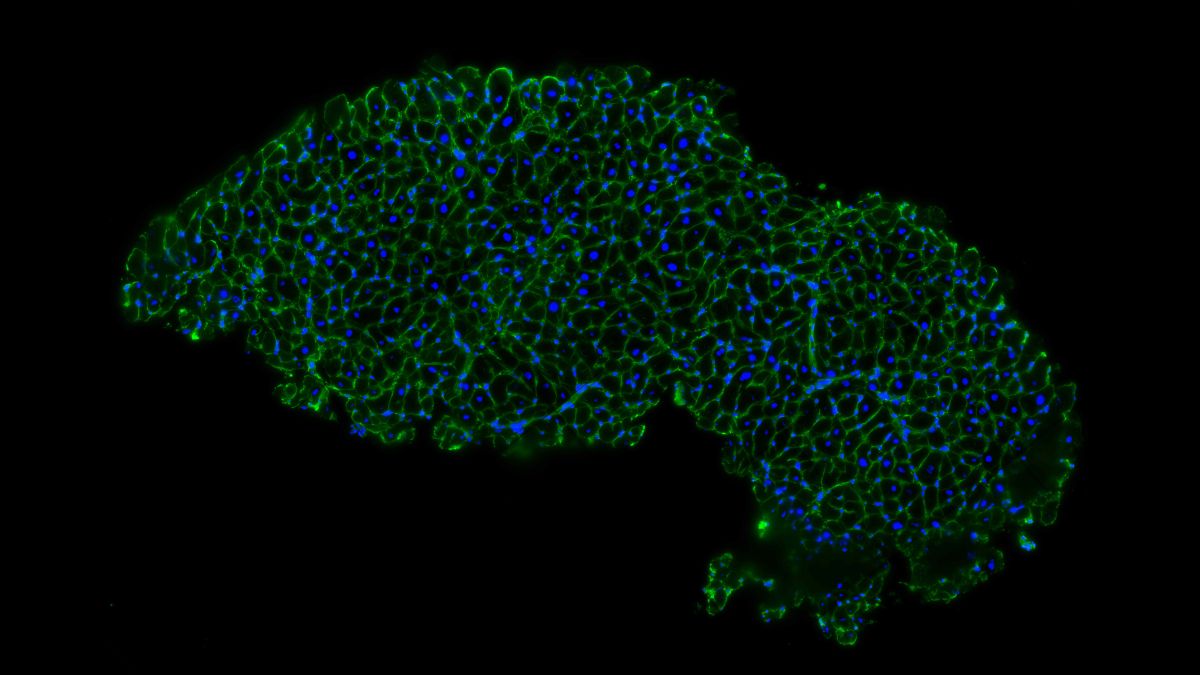
A group of Berlin researchers in collaboration with international scientists have found differences in heart inflammation caused by COVID-19, anti-COVID-19 vaccination, and non-COVID-19 myocarditis. The find paves the way for more personalized therapies, they report in “Nature Cardiovascular Research.”
Heart inflammation, or myocarditis, differs depending on its cause. A collaborative study led by Dr. Henrike Maatz, a scientist in the Genetics and Genomics of Cardiovascular Diseases lab of Professor Norbert Hübner at the Max Delbrück Center in Berlin, identified distinct immune signatures in myocarditis caused by SARS-CoV-2 infection and mRNA vaccines compared to non-COVID-19 myocarditis. The study was published in “Nature Cardiovascular Research.”
“We found clear differences in immune activation,” says Maatz, co-lead author. “This knowledge might help to develop new and more personalized therapies that are tailored to specific types of inflammation.”
A unique opportunity during the pandemic
Myocarditis is caused by various types of infections, autoimmune disorders, genetic and environmental factors, and rarely, vaccination. COVID-19 is primarily a respiratory disease, but it is well known that SARS-CoV-2 infection can injure the heart. In children and young adults, SARS-CoV-2-infection can cause multisystem inflammatory syndrome, with myocarditis being the most prevalent clinical feature, although this is rare.
When the coronavirus pandemic hit, researchers at the Max Delbrück Center, the Berlin Institute of Health at Charité (BIH) and Charité – Universitätsmedizin Berlin saw a unique opportunity to study whether myocarditis differs on a cellular and molecular level depending on the cause.
The Hübner lab has long had an interest in studying cardiac disease at the single-cell level. They teamed up with Professor Carsten Tschöpe, a cardiologist at the Deutsches Herzzentrum der Charité (DHZC), head of the BIH research group for Immunocardiology and principal investigator at Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK). His team had been collecting biopsy samples from patients presenting with suspected myocarditis. “At the DHZC, we have a widely recognized Myocarditis Unit, specializing in performing endomyocardial biopsies in selected cases,” says Tschöpe.
“The study program, which was initiated by Charité during the COVID-19 crisis, was integrated into the curriculum and forms part of the PERSONIFY- Program supported by the DZHK. Within this framework, patients with myocarditis undergo highly specific and targeted investigations, ensuring a comprehensive and advanced approach to their clinical and scientific evaluation.”
“We are deeply grateful to the patients for their trust and invaluable contributions and to our specialist heart failure nurses for their essential role in identifying patients, ensuring meticulous data management, careful tissue and blood handling, and overall patient care,” Tschöpe adds.
Distinct immune activation
Researchers at the Max Delbrück Center performed single-nucleus RNA sequencing (snRNA-seq) on biopsied heart tissue to study gene expression and to create transcriptional profiles of each cell. These profiles served to identify the different cell types of the heart. They examined the molecular changes in each cell, and the abundance of the different cell types in three different sets of myocarditis tissue: COVID-19 positive samples, cases caused by mRNA vaccines, and non-COVID-19 heart inflammation caused by viral infections before the pandemic.
They found that while some gene expression changes were similar across the three groups, there were significant differences in levels of immune cell gene expression. What’s more, transcriptional profiles also showed that immune cells differed in abundance, depending on the cause of the myocarditis.
“Such differences were unexpected,” says Dr. Eric Lindberg, co-lead author of the paper, former postdoc in the Hübner lab, who now heads a research group at the LMU hospital in Munich. The researchers for example found that post-vaccination, CD4 T-cells were more abundant whereas post SARS-CoV-2 infection, CD8 T cells tended to be more dominant. In the non-COVID-19 myocarditis samples, the CD4 to CD8 cell ratio was about 50/50, he adds. Gene expression data suggested that the CD8 T cells in the post-COVID-19 group also appeared to be more aggressive than in non-COVID myocarditis. The researchers also found a small population of T cells present in post-COVID-19 myocarditis that have previously only been observed in the blood of severely sick COVID-19 patients.
“Together, these findings suggest a stronger immune response in post-COVID-19 myocarditis compared to pre-pandemic forms of myocarditis, while the myocardial inflammation appeared to be milder in post-vaccination,” says Professor Norbert Hübner of the Max Delbrück Center and Charite – Universitätsmedizin Berlin, corresponding author on the paper and a principal investigator at the DZHK. Although the sample size from patients with post-vaccination myocarditis was small, the results are in line with other studies of post-vaccination myocarditis, Hübner adds.
Implications for treatment
Being able to differentiate between inflammation caused by different kinds of infections and vaccination paves the way to improve treatment tailored to specific types of inflammation, says Maatz. Based on the research, one could develop new therapies to control the side effects from vaccines, for example, she adds.
Also, biopsy samples of the heart are generally tiny – they are no larger than a pin head. It was a challenge to get the snRNA-seq technique to work using such minute amounts of tissue, Maatz says. “But I think the resolution and depth of insight we were able to generate really shows the power of this method – perhaps in the future also in a diagnostic setting.”
Photo:
Heart biopsy tissue from a patient with COVID-19. New technologies can image the cellular landscape of heart tissue in detail. Heart cell boundaries are stained green, the cell nuclei in blue.
© Eric Lindberg, Max Delbrück Center / LMU Klinikum
Source: Press Release Max Delbrück Center
Not all heart inflammation is the same
Research, Innovation, Patient care / 24.02.2025
„Macht aus Fragen Antworten“ – Jugend forscht startet in neue Runde / Besuchertag am 26. Februar
Drei Einrichtungen des Campus Berlin-Buch sind wieder Paten im Wettbewerb und betreuen junge Forscherinnen und Forscher auf Regionalebene
Junge Talente in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) starten im Februar in Berlin beim 60. bundesweiten Nachwuchswettbewerb Jugend forscht & Jugend forscht Junior. Das diesjährige Motto lautet: „Macht aus Fragen Antworten“.
Im Regionalwettbewerb auf dem Campus Berlin-Buch werden 37 Projekte von mehr als 80 Berliner Schülerinnen und Schülern zwischen zehn und 19 Jahren betreut. Die Projekte bilden sechs der sieben Fachbereiche des Wettbewerbs ab: Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Mathematik, Physik und Technik.
Pateneinrichtungen des Campus sind das Max Delbrück Center, das Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie, die Campus Berlin-Buch GmbH und – angeschlossen – das Experimental and Clinical Research Center von Max Delbrück Center und Charité – Universitätsmedizin Berlin. Die Paten richten das Programm für die beiden Wettbewerbstage am 26. und 28. Februar aus.
Einladung der Öffentlichkeit zum Besuchertag
Am 26. Februar stellen die jungen Forscherinnen und Forscher ihre Projekte an Ständen im Foyer des Max Delbrück Communications Centers (MDC.C) von 16 - 18 Uhr der Öffentlichkeit vor, bevor zum Abschluss am 28. Februar die Preisträger:innen feierlich geehrt werden.
„Wir freuen uns auf die vielen Ideen im diesjährigen Wettbewerb. Jedes Jahr erleben wir sehr engagierte Kinder und Jugendliche, die eigenständig Forschungsfragen entwickeln und sie untersuchen. Ihre Arbeit würdigen wir unter anderem, indem wir sie in die Forschungslabore des Campus einladen“, sagt Dr. Ulrich Scheller, Geschäftsführer der Campus Berlin-Buch GmbH. „Jugend forscht ist eine ausgezeichnete Form der Nachwuchsförderung in den MINT-Berufen, die wir sehr gern unterstützen.“
Über den Wettbewerb
Jugend forscht ist Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb. Ziel ist, Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern, Talente zu finden und zu fördern. Pro Jahr gibt es bundesweit mehr als 120 Wettbewerbe. Teilnehmen können Jugendliche ab der 4. Klasse bis zum Alter von 21 Jahren. Wer mitmachen will, sucht sich selbst eine interessante Fragestellung für sein Forschungsprojekt.
www.jugend-forscht.de
Über den Campus Berlin-Buch
Der Campus Berlin-Buch ist ein moderner Wissenschafts-, Gesundheits- und Biotechnologiepark. Alleinstellungsmerkmale sind der klare inhaltliche Fokus auf Biomedizin und das enge räumliche und inhaltliche Zusammenwirken von Forschungsinstituten, Kliniken und Biotechnologie-Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Erforschung molekularer Ursachen von Krebs,- Herzkreislauf- und neurodegenerativen Erkrankungen, eine interdisziplinär angelegte Grundlagenforschung zur Entwicklung neuer Therapien und Diagnoseverfahren, eine patientenorientierte Forschung und die unternehmerische Umsetzung biomedizinischer Erkenntnisse.
Dank exzellenter Wissenschaftseinrichtungen und Unternehmen im BiotechPark hat der Campus ein herausragendes Innovations- und Wachstumspotenzial. Dazu gehören als Einrichtungen der Grundlagenforschung das Max Delbrück Center und das Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie, das gemeinsam von Max Delbrück Center und Charité – Universitätsmedizin Berlin betriebene und auf klinische Forschung spezialisierte Experimental and Clinical Research Center sowie das Berlin Institute of Health. Der BiotechPark Berlin-Buch gehört mit 75 Unternehmen, 850 Beschäftigten und rund 45.000 Quadratmetern Büro- und Laborfläche zu den führenden Technologieparks in Deutschland. Seit 1992 sind über 600 Millionen Euro an öffentlichen Fördermitteln durch die EU, den Bund und das Land Berlin in den Campus Berlin-Buch investiert worden, um diese Synergien zu unterstützen.
www.campusberlinbuch.de
„Macht aus Fragen Antworten“ – Jugend forscht startet in neue Runde
Patient care / 12.02.2025
When blood cancer starts to spread
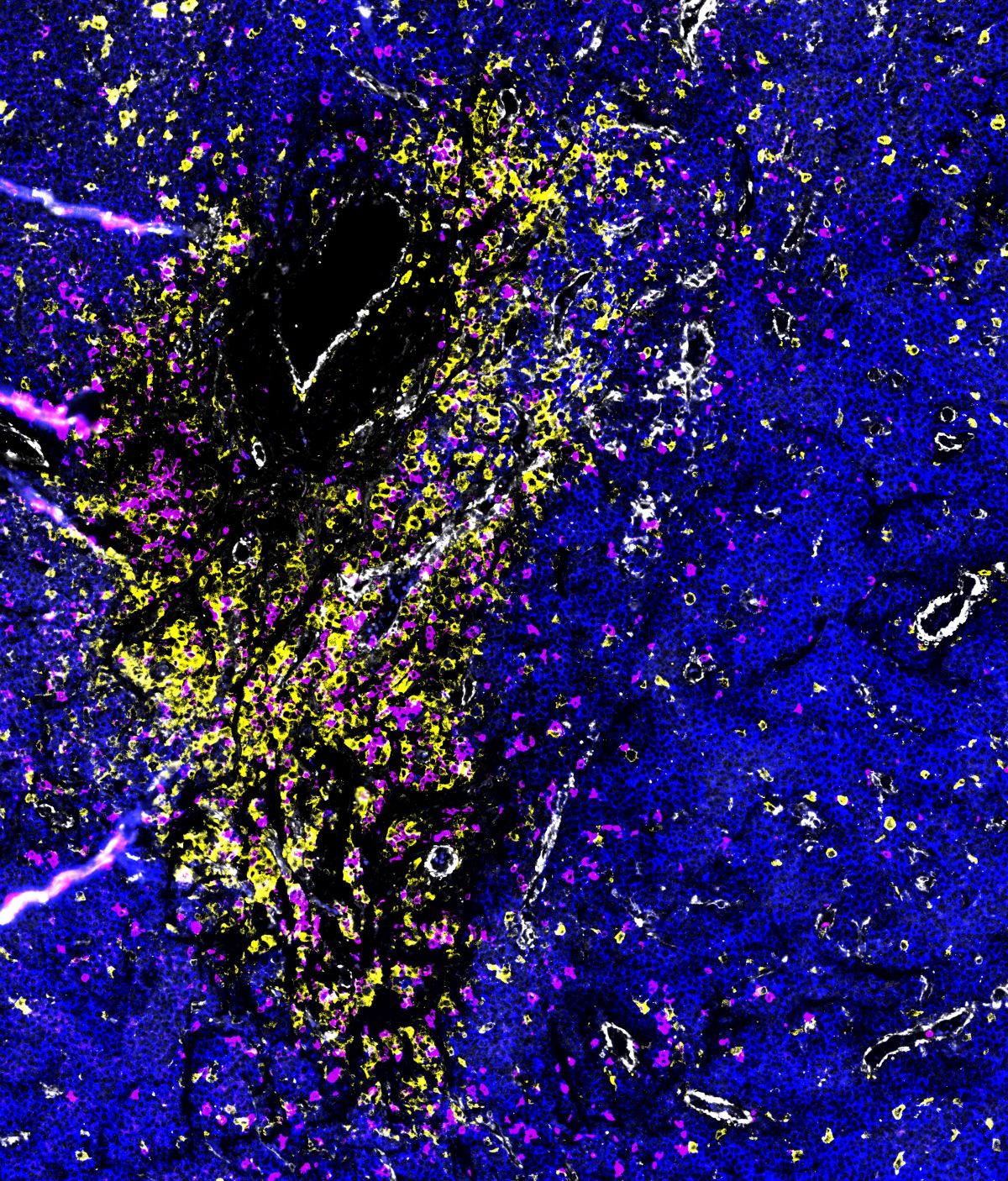
When blood cancer cells break through the bone and multiply, tumor cells become dangerously diverse and the immune response in the region changes, researchers from Berlin and Heidelberg report in “Science Immunology.” The detailed insights into cancer progression could advance diagnostics and treatment.
The incurable bone marrow cancer “multiple myeloma” often develops unnoticed in the bone marrow over decades. In advanced stages, lesions form that can destroy the bone and spread to other parts of the body. An interdisciplinary team from the Berlin Institute of Health at Charité (BIH), the Max Delbrück Center, the Queen Mary University of London's Precision Healthcare University Research Institute (PHURI), the Myeloma Center at Heidelberg University Hospital (UKHD), the University of Heidelberg and the German Cancer Research Center (DKFZ), together with other national and international partners, have been investigating what happens in these lesions when myeloma cells first break through the bone. The researchers discovered that the tumor cells diversify drastically when exiting the bone marrow, which also affects the immune cells in the cancer lesions. The new findings could contribute to more precise diagnostics and therapy, they report in “Science Immunology.”
When the tumor cells leave the bone, they find themselves in a completely different environment with different environmental conditions. “We suspect that this diversity helps the cancer cells adapt to survival outside the bone, enabling them to spread to other areas of the body,” says Dr. Niels Weinhold, head of Translational Myeloma Research at the UKHD's Department of Hematology, Oncology and Rheumatology.
Using innovative single-cell and spatial omics technologies, the team also examined for the first time how the immune system reacts to this “outbreak” of cancer cells from the bone. They discovered significant changes in the type and number of immune cells in the microenvironment of the cancerous lesions. For example, certain immune cells, known as T cells, had very different receptors and surface molecules in the foci outside the bone – a possible adaptation to the newly emerged heterogeneity of the tumor cells.
Uncovering the interaction between the immune system and cancer
“There seems to be a co-evolution between tumor and immune cells, in which both sides react to changes in the other,” says Professor Simon Haas, co-corresponding author of the study. He heads a lab in the joint focus area “Single-cell approaches for personalized medicine” at the BIH, Max Delbrück Center, and Charité – Universitätsmedizin Berlin. He is also chair for single cell technologies and precision medicine at PHURI. The researchers hypothesize that this intensified interaction between the immune system and the cancer may both promote and hinder the fight against the disease. The team is currently investigating which factors contribute positively or negatively to this interaction.
For their analyses, the international team used tissue samples that originated from myeloma lesions in various parts of the body. The material was obtained either by image-guided biopsies or during operations on fracture-prone or already broken bones. “Single-cell analysis and spatial multi-omics technologies enabled us to simultaneously investigate a wide range of properties of thousands of individual cells, taking into account their exact position in the tissue,” says Dr. Llorenç Solé Boldo, one of the first authors of the study.
The results could influence the diagnosis and therapy of myeloma in the future. Currently, samples for diagnosis are usually taken from the iliac crest (part of the pelvis) of patients. However, since the study has shown that cancer and immune cells in hotspots where the cancer cells break out of bone differ significantly from those in the iliac crest, these sites may be better suited for sample collection and allow a more precise assessment of the disease and possible adjustment of therapy.
Text: UKHD
12.02.2025
Neues Angebot – Seniorenvertretung bietet kostenfreie Rentenberatung an
Im Amt für Soziales gibt es ab Donnerstag, dem 20. Februar 2025 ein neues kostenfreies Beratungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger. Mit Michael Musall als Rentenberater und Mitglied der Pankower Seniorenvertretung steht ein ausgewiesener, ehrenamtlich tätiger Fachmann bereit, um bei Fragen zu dem komplexen Feld des Rentenrechts, der medizinischen Rehabilitation und der Rentenversicherung zu beraten sowie bei der Antragstellung zu helfen. Musall übt das Ehrenamt des Versichertenberaters bereits seit vielen Jahren aus.
Notwendiges Angebot
„Die Einführung der kostenlosen Rentenberatung ist eine wichtige Unterstützung für die Bürgerinnen und Bürger und ich freue mich über die Initiative der Seniorenvertretung“, erklärt Dominique Krössin, Bezirksstadträtin für Soziales und Gesundheit. „Das Angebot ist positiv und notwendig, um den Menschen in Fragen rund um das Rentenrecht und die Rentenversicherung zu helfen“, so die Stadträtin weiter.
Anmeldung erforderlich
Eine Anmeldung und Terminabsprache bei Michael Musall unter Tel.: 0177-6377733 ist zwingend erforderlich. Weitere Termine sind der 20.03., 17.04., 15.05., 05.06.2025 jeweils ab 10:30 Uhr. Zusätzliche Termine ab Juli 2025 können erfragt werden.
Die Beratung findet im Büro der Seniorenvertretung im Bezirksamt Pankow, Fröbelstraße 17, 10405 Berlin, Haus 2, Raum 330, statt.
Innovation / 06.02.2025
U.S. FDA Grants Orphan Drug Designation to Ariceum Therapeutics’ Proprietary Radiopharmaceutical Cancer Therapy
- 225Ac-satoreotide is a first-in-class Actinium-labelled somatostatin receptor 2 antagonist targeting extensive-stage Small Cell Lung Cancer or Merkel Cell Carcinoma
- Orphan Drug Designation follows outstanding preclinical data and FDA IND clearance
- Phase I/II human trials set to commence in Q1 2025 as a ‘theranostic’ targeted radionuclide treatment
Berlin, Germany, 6 February 2025 – Ariceum Therapeutics (Ariceum), a private biotech company developing radiopharmaceutical products for the diagnosis and treatment of certain hard-to-treat cancers, today announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has granted Orphan Drug Designation (ODD) to 225Ac-SSO110 (satoreotide) for the treatment of patients with Small Cell Lung Cancer (SCLC).
SCLC is a deadly condition that represents a significant unmet medical need due to the limited number of treatment options available to patients with this aggressive form of cancer. Two-thirds of SCLC patients are diagnosed at an advanced stage where the disease has already spread significantly, resulting in a poor prognosis and a 5-10% overall five-year survival rate. Ariceum will commence Phase I/II human clinical development of 225Ac-satoreotide under the trial name, SANTANA-225 in Q1 2025.
Manfred Rüdiger, Chief Executive Officer at Ariceum Therapeutics, said: “Receiving ODD for 225Ac-satoreotide is a recognition of its potential as a treatment option for patients with SCLC and an important regulatory milestone for Ariceum. The FDA’s ODD will support our objective to accelerate the development of 225Ac-satoreotide through human trials to provide a potentially life-saving therapy to patients with limited alternatives.”
The FDA provides ODD to drugs and biologics that demonstrate potential for the diagnosis and/or treatment of rare diseases or conditions that affect fewer than 200,000 people in the U.S. The designation provides development and commercial incentives for designated compounds and medicines, including eligibility for seven years of market exclusivity in the U.S. after product approval, FDA assistance in clinical trial design, and an exemption from FDA user fees.
In October 2024, Ariceum published outstanding preclinical data demonstrating the significant potential of 225Ac-satoreotide to outperform SSTR2 targeting agonists. 225Ac-satoreotide showed a high frequency of complete durable responses and 100% survival supporting advanced clinical development in SCLC, MCC, and other aggressive cancers. 225Ac-satoreotide in combination with its companion patient selection tracer 68Ga-SSO120 is being developed as a ‘theranostic pair’ for the combined diagnosis and targeted radionuclide treatment of multiple indications expressing SSTR2, such as SCLC, MCC, and other aggressive, hard-to-treat cancers.
About Ariceum Therapeutics
Ariceum Therapeutics is a private, clinical stage radiopharmaceutical company focused on the diagnosis and precision treatment of certain neuroendocrine and other aggressive, hard-to-treat cancers. The name Ariceum is an anagram of ‘Marie Curie’ whose discovery of radium and polonium have been huge contributions to finding treatments for cancer.
Ariceum’s lead targeted systemic radiopharmaceutical candidate, SSO110 (“satoreotide”) labelled with Lutetium-177 (177Lu) and Actinium-255 (225Ac) is an antagonist of the somatostatin type 2 (SSTR2) receptor which is overexpressed in aggressive neuroendocrine tumours (NETs) such as small cell lung cancer (SCLC) or Merkel Cell Carcinoma (MCC), all of which have limited treatment options and poor prognosis. Satoreotide is being developed as a ‘theranostic pair’ for the combined diagnosis and targeted radionuclide treatment of these tumours. Ariceum is also developing a radiolabelled PARP-inhibitor (ATT001), currently in Phase 1 clinical development under the trial name CITADEL-123. ATT001 was part of the acquisition of Theragnostics Ltd which was closed in June 2023.
Ariceum Therapeutics, launched in 2021, acquired all rights to satoreotide from Ipsen, which has remained a shareholder of the Company. Ariceum is headquartered in Berlin, with operations in Germany, Switzerland, Australia, the United Kingdom, and the United States.
Ariceum is led by a highly experienced management team and supported by specialist investors including EQT Life Sciences (formerly LSP), HealthCap, Pureos Bioventures, Andera Partners, and Earlybird Venture Capital. For further information, please visit www.ariceum-therapeutics.com.
Research, Innovation, Patient care / 31.01.2025
Tubulis Announces First Patient Dosed in Phase I/IIa Trial Evaluating ADC TUB-030 in Advanced Solid Tumors
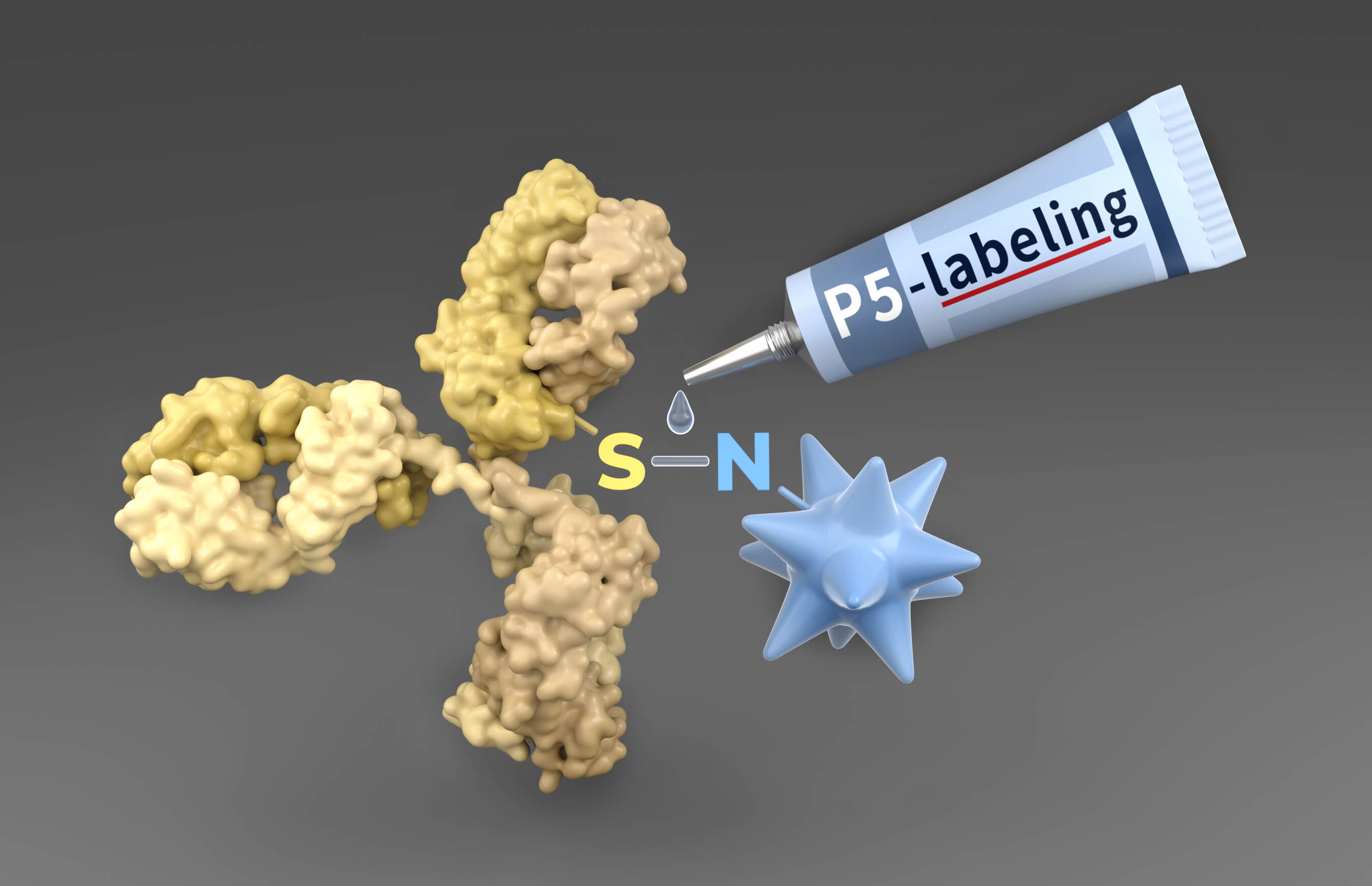
Tubulis (a joint spin-off of the FMP and the Ludwig-Maximilians-Universität Munich) announced today that its second drug candidate, TUB-030, has entered clinical evaluation with successful dosing of the first patient in the 5-STAR 1-01 Phase I/IIa trial (NCT06657222). The study is evaluating TUB-030, Tubulis’ next-generationntibodydrug conjugate (ADC), in patients with advanced solid tumors. The ADC targets 5T4, an oncofetal antigen expressed in a broad range of solid tumors. The program was developed using Tubulis’ proprietary Tubutecan linker-payload platform, which enables superior biophysical properties for precise and sustained on-tumor payload delivery.
“This milestone for TUB-030 demonstrates our ability to execute on our strategy to advance innovative programs into our proprietary pipeline and rapidly bring them into the clinic,” said Dominik Schumacher, PhD, Chief Executive Officer and Co-founder of Tubulis. “As an organization, Tubulis has made a large step forward with two differentiated ADC molecules in clinical evaluation in less than a year. Our goal is to continue being an innovation driver in the field by delivering on the transformative potential of our platforms for patients.”
The multicenter, first-in-human, dose escalation and optimization Phase I/IIa study 5-STAR 1-01 aims to investigate the safety, tolerability, pharmacokinetics, and efficacy of TUB-030 as a monotherapy to treat a broad range of solid tumors. The trial will enroll a total of 130 patients and will be conducted at sites across the US and Canada. Phase I comprises dose escalation to determine the safety profile and to identify the maximum tolerated dose and/or the identified dose for optimization in patients with advanced solid tumor indications. Phase IIa will focus on dose optimization, safety, and preliminary efficacy of TUB-030 in selected indications.
“Building on our strong preclinical efficacy and safety data, we are expecting that targeting 5T4 with our high-performance ADC technology may offer a new precision therapy option for a variety of solid tumor indications. With our differentiated target, a strong bystander effect and efficient and durable target engagement via the Tubutecan platform, TUB-030 provides the potential to induce robust anti- tumor activity in 5T4-expressing tumors,” stated Günter Fingerle-Rowson, MD, PhD, Chief Medical Officer at Tubulis.
TUB-030 consists of a humanized, Fc-silenced IgG1 antibody targeting 5T4 equipped with Tubulis’ proprietary Tubutecan technology, which is based on P5 conjugation chemistry and the topoisomerase-1 inhibitor exatecan. Tubulis previously presented a comprehensive preclinical data set at AACR demonstrating TUB-030’s stability and minimal loss of linker-payload conjugation. In a range of preclinical models, TUB-030 produced high and long-lasting anti-tumor responses, including responses at relatively low 5T4 expression levels, while maintaining an excellent safety and tolerability profile. A single treatment with TUB-030 eliminated tumors in a triple-negative breast cancer mouse model, further underlining its potential efficacy. Preclinical analysis including safety, efficacy and pharmacokinetics demonstrated that TUB-030 has a therapeutic window in a large variety of solid tumors.
About TUB-030 and the Tubutecan Technology
Tubulis’ second antibody-drug conjugate (ADC) TUB-030 is directed against 5T4, an oncofetal antigen, expressed in a broad range of solid tumor types. It consists of an IgG1 antibody targeting 5T4 connected to the Topoisomerase I inhibitor exatecan through a cleavable linker system based on the company’s proprietary P5 conjugation technology with a homogeneous DAR of 8. P5 conjugation is a novel chemistry for cysteine-selective conjugation that enables ADC generation with unprecedented linker stability and biophysical properties. The candidate is currently being investigated in a multicenter Phase I/IIa study (5-STAR 1-01, NCT06657222) that aims to evaluate the safety, tolerability, pharmacokinetics, and efficacy of TUB-030 as a monotherapy in advanced solid tumors.
About Tubulis
Tubulis generates uniquely matched antibody-drug conjugates with superior biophysical properties that have demonstrated durable on-tumor delivery and long-lasting anti-tumor activity in preclinical models. The two lead programs from our growing pipeline, TUB-040, targeting NaPi2b, and TUB-030, directed against 5T4, are being evaluated in the clinic in high-need solid tumor indications, including ovarian, lung and head and neck cancers. We will solidify our leadership position by continuing to innovate on all aspects of ADC design leveraging our proprietary platform technologies. Our goal is to expand the therapeutic potential of this drug class for our pipeline, our partners and for patients. Visit www.tubulis.com or follow us on LinkedIn.
Research, Patient care, Education / 28.01.2025
Premiere: Prof. Dr. med. Martin A. Mensah verstärkt als erster Humangenetiker das Team im Helios Klinikum Berlin-Buch
Weniger als 20 Humangenetiker:innen gibt es in Berlin. Einer von ihnen ist Prof. Dr. med. Martin A. Mensah. Der gebürtige Berliner arbeitet seit dem 1. Januar im Helios Klinikum Berlin-Buch und ist im gesamten Unternehmen der Erste seiner Art. Mit seinem Amtsantritt markiert er einen wegweisenden Schritt in der Verbesserung der Patient:innenversorgung und setzt neue Maßstäbe für die Forschung und Lehre an der MSB Medical School Berlin.
Die Humangenetik ist ein sehr junges Fach, denn nach dem westlichen Ärztekammermodell gibt es den Facharzt für Humangenetik erst seit den 1990er-Jahren. Sie besteht aus drei Säulen: der Zytogenetik, der Molekulargenetik und der klinischen Genetik und vereint die Patient:innenversorgung mit der Expertise um humangenetische Laborverfahren. „Ein Genetiker arbeitet ähnlich wie ein Radiologe. Ich habe keine eigenen Patientinnen und Patienten, sondern ich übernehme sie, berate sie und übergebe sie dann in ihrer weiteren Behandlung wieder an die entsprechende Fachärztin oder den Facharzt“, beschreibt Prof. Martin A. Mensah seine Arbeit als Humangenetiker.
Vor seinem Arbeitsbeginn am Klinik- und Hochschulstandort Berlin-Buch studierte Prof. Mensah Humanmedizin an der Charité, wo er auch 2022 seinen Facharzt für Humangenetik abgeschlossen hat. Zudem habilitierte er am Institut für Medizinische Genetik und Humangenetik der Charité und war dort als Facharzt tätig. Somit bringt der Humangenetiker auch umfassende Expertise aus den Bereichen Forschung und Lehre mit. Weshalb er nicht nur in der Klinik, sondern auch an der MSB Medical School Berlin wirken wird. „Wir freuen uns sehr, dass wir Prof. Martin Mensah nicht nur für unseren Klinikstandort, sondern vor allem auch für die Professur der Humangenetik an der Medical School Berlin gewinnen konnten. Mit dem Amtsantritt von Herrn Mensah legen wir den Grundstein für eine genetische Versorgung unserer Patientinnen und Patienten sowie die Basis für die humangenetische Forschung und Lehre am Hochschulstandort Berlin-Buch“, sagt Prof. Dr. med. Henning T. Baberg, Ärztlicher Direktor des Helios Klinikums Berlin-Buch und Rektor der MSB.
Ausbau der genetischen Laborverfahren
Ein Schwerpunkt von Prof. Mensahs Arbeit wird der Aufbau und die Weiterentwicklung der klinischen Laborverfahren sein. Während in der bestehenden Zytogenetik bereits umfangreiche Kompetenzen in der hämatologischen und onkologischen Diagnostik bestehen, wird er die Molekulargenetik in Berlin-Buch auf neue Füße stellen: „Wenn wir zukünftig mit genetischen Laborverfahren das ganze Spektrum genetischer Erkrankungen abbilden wollen, müssen wir basengenau die DNA untersuchen können, um Mutationen, die nur eine einzige Base betreffen, zu entdecken. Und genau hierfür braucht es eine Molekulargenetik,“ erklärt der Humangenetiker. „Jedoch müssen wir beim Aufbau und der Etablierung von diesen genetischen Laborverfahren nicht bei null beginnen, denn in Berlin-Buch existiert bereits die Zytogenetik und somit ein sehr guter Grundstein. Zudem kann ich hier auf die Expertise des Chefs des Labors Prof. Dr. med. Dirk Peetz und seinem Team bauen, wofür ich sehr dankbar bin, denn bislang lag mein Schwerpunkt auf der Patientenversorgung und weniger bei der Labororganisation“, führt Prof. Mensah weiter fort.
Genetische Beratung von Patient:innen und Angehörigen
Die klinische Genetik war bislang der berufliche Schwerpunkt und ist das Steckenpferd des Humangenetikers. „Als Humangenetiker werde ich zukünftig im Helios Klinikum Berlin-Buch genetische Beratungen von Patientinnen und Patienten anbieten und somit zu einer verbesserten Patientenversorgung beitragen. Von diesem Angebot werden nicht nur Patientinnen und Patienten profitieren, die bereits in Behandlung sind, sondern auch Angehörige von beispielsweise Krebspatienten oder Familien mit genetischen Erbkrankheiten, die Beratung bei der Familienplanung wünschen,“ erklärt Prof. Mensah. Hiermit erweiterter der Bucher Maximalversorger sein Beratungs- und Behandlungsangebot, denn die Beratung von Ratsuchenden dürfen aus rechtlichen Gründen ausschließlich Humangenetiker:innen durchführen. Eine Patientinnengruppe, die hiervon zukünftig profitieren soll, sind Familienangehörige von Patientinnen mit familiären Brust- und Eierstockkrebs, denn „als erstes Projekt werde ich mich zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen des Hauses der Zertifizierung des Bucher Brustzentrums als FBREK Konsortialzentrum annehmen“, skizziert Mensah eine seiner ersten Aufgaben als Humangenetiker an seiner neuen Wirkungsstätte.
www.helios-gesundheit.de24.01.2025
Sanierungskonzept und Ergänzungsplan anerkannt – Haushaltsbeschränkungen aufgehoben
Die vorläufige Haushaltswirtschaft im Bezirksamt Pankow ist beendet. Am 22. Januar 2025 hat der Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses dem Sanierungskonzept und dem Ergänzungsplan des Bezirksamtes Pankow für 2025 zugestimmt. „Für uns ist das ein großer Erfolg und auch eine Anerkennung für die harte und konstruktive Arbeit unserer Finanzabteilung“, erklärt Bezirksbürgermeisterin Dr. Cordelia Koch. „Ich bedanke mich bei den Beschäftigten des Bezirksamtes, die das Konzept professionell und unter hohem zeitlichen Druck erarbeitet haben, dem Finanzsenat sowie bei den beteiligten politischen Akteuren für die gute und sinnvolle Entscheidung zum Wohle unseres Bezirkes“, so Koch weiter.
Research, Innovation, Patient care / 23.01.2025
Wirtschaftliches Erfolgsmodell: Zukunftsort Berlin-Buch
IBB-Studie zeigt: Geplante Investitionen könnten bis 2035 bis zu 3.800 Arbeitsplätze am Standort und darüber hinaus schaffen, eine zusätzliche Wirtschaftskraft von 1,44 Milliarden Euro sowie zusätzliche Einnahmen für das Land Berlin in Höhe von 125 Millionen Euro.
Mit rund 6.500 Beschäftigten in der Gesundheitswirtschaft leistet der Zukunftsort Berlin-Buch einen zentralen Beitrag für die Branche in der Hauptregion. Mehr als jeder zweite Arbeitsplatz ist in der Forschung und Entwicklung angesiedelt. Auf dem international renommierten Campus Berlin-Buch arbeiten 3.000 Menschen aus über 70 Nationen, davon allein rund 1.200 Wissenschaftler:innen, die an der Medizin der Zukunft arbeiten.
Die heute veröffentlichte Analyse der Investitionsbank Berlin (IBB) zeigt, dass der Zukunftsort auch wirtschaftlich ein Erfolgsmodell ist. Geplante Investitionen in Höhe von 728 Mio. Euro für die bauliche Erweiterung des Zukunftsortes können signifikante Wertschöpfungseffekte und zusätzliche öffentliche Einnahmen von 125 Mio. Euro erzeugen.
Hinrich Holm, Vorsitzender des Vorstands der IBB: „Zukunftsorte wie Berlin-Buch sind der Schlüssel zur wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Stärke Berlins. Als Landesförderbank unterstützen wir die Entwicklung dieser Standorte auch mit Förderprogrammen. Sie konzentrieren Innovationen, schaffen hochwertige Arbeitsplätze und machen unsere Stadt zu einem internationalen Magneten für Talente und Investitionen. Denn hier entstehen nicht nur wissenschaftliche Durchbrüche, sondern auch innovative Geschäftsmodelle, die Start-ups und etablierte Unternehmen gleichermaßen anziehen.“
Der Gesundheitsstandort Buch bietet ein ideales Umfeld für Life-Science-Unternehmen, biomedizinische Grundlagen- und klinische Forschung. Zwischen international renommierten Forschungseinrichtungen, Biotechnologie-Start-ups und hochmodernen Produktionsanlagen zur Arzneimittelherstellung liegen hier nur wenige Meter. Durch die Nähe von Wissenschaft und Wirtschaft ist der Zukunftsort besonders attraktiv für Neuansiedlungen von Unternehmen der Gesundheitswirtschaft. Die Forschungseinrichtungen, Kliniken und Unternehmen in Berlin-Buch verzeichneten 2023 Umsätze in Höhe von rund 870 Mio. Euro – das sind 3,3% der gesamten Gesundheitswirtschaft in Berlin. Trotz einer wirtschaftlich herausfordernden Lage wollen sie ihre Beschäftigtenzahl in den kommenden Jahren um fast 10% erhöhen. Da bereits sämtliche Flächenpotenziale vor Ort ausgeschöpft sind, müssen in den kommenden Jahren weitere Baufelder erschlossen werden.
Erweiterung des Campus könnte rund 3.800 Arbeitsplätze schaffen
Die Analyse der IBB-Volkswirte zeigt, dass die geplanten Investitionen der Unternehmen vor Ort zusammen mit den baulichen Erweiterungen des Campus in den Jahren 2027 bis 2035 Investitionen in Höhe von insgesamt 728 Mio. Euro auslösen dürften. Mithilfe ihres Berliner Regionalmodells zeigen sie, dass diese Investitionen über die nächsten zehn Jahre einen positiven wirtschaftlichen „Zukunfts-Impuls“ geben könnten – mit BIP-Zuwächsen in Höhe von 1,44 Mrd. Euro. Werden die gesamten Investitionen und der kumulierte BIP-Effekt ins Verhältnis gesetzt, dann entfaltet jeder in Buch investierte Euro eine wirtschaftliche Leistung von rund 2 Euro. Realistische Modellannahmen zeigen, dass die Investitionen rund 125 Mio. Euro zusätzliche öffentliche Einnahmen und fast 3.800 Arbeitsplätze unter anderem in den Bereichen Biotech, Medizin, Bau sowie Handel, Dienstleistungen und Handwerk schaffen könnten. Die Volkswirte betonen jedoch, dass dies nur mit einer klaren politischen Unterstützung erreichbar ist. Neben einer zügigen Erschließung der Flächenpotenziale zur Erweiterung des Campus sollte daher auch zeitnah eine bessere Verkehrsanbindung geschaffen werden.
„Die Ergebnisse der Studie untermauern die bedeutsamen Effekte, die von der geplanten Campuserweiterung ausgehen können. Es ist wichtig, der wirtschaftlichen Dynamik am Standort Raum zu geben – schnell wachsende Unternehmen der medizinischen Biotech-Branche benötigen verfügbare Kapazitäten für Labore und Produktionsstätten. Dies zahlt unmittelbar auf die Entwicklung des Ökosystems am Zukunftsort Berlin-Buch und in der Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg ein“, sagt Dr. Christina Quensel, Geschäftsführerin der Campus Berlin-Buch GmbH. „Wir sind dankbar für die Unterstützung des Bezirks Pankow und des Landes Berlin und wünschen uns, dass unsere gemeinsamen Anstrengungen zügig zu einer erweiterten und bestmöglichen Infrastruktur führen, um medizinischen Innovationen den Weg in die Anwendung zu ebnen.“
Den vollständigen Bericht sowie weitere volkswirtschaftliche Analysen und Berichte finden Sie unter https://www.ibb.de/berlin-aktuell.
IBB
Die IBB ist die Förderbank des Landes Berlin und Teil der IBB Gruppe. Im Auftrag des Landes Berlin fördert und finanziert die IBB Investitionsvorhaben und setzt sich dafür ein, die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Lebensbedingungen in Berlin zu verbessern und damit die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Neben den Geschäftsfeldern Wirtschaftsförderung und Immobilien- und Stadtentwicklung, wurde ihr Portfolio 2022 um die Arbeitsmarktförderung erweitert.
Campus Berlin‐Buch
Der Campus Berlin‐Buch ist ein moderner Wissenschafts‐, Gesundheits‐ und Biotechnologiepark. Alleinstellungsmerkmale sind der klare inhaltliche Fokus auf Biomedizin und das enge räumliche und inhaltliche Zusammenwirken von Forschungsinstituten, Kliniken und Biotechnologie‐Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Erforschung molekularer Ursachen von Krebs,‐ Herzkreislauf‐ und neurodegenerativen Erkrankungen, eine interdisziplinär angelegte Grundlagenforschung zur Entwicklung neuer Therapien und Diagnoseverfahren, eine patientenorientierte Forschung und die unternehmerische Umsetzung biomedizinischer Erkenntnisse. Dank exzellenter Wissenschaftseinrichtungen und Unternehmen im BiotechPark hat der Campus ein herausragendes Innovations‐ und Wachstumspotenzial. Dazu gehören als Einrichtungen der Grundlagenforschung das Max‐Delbrück‐Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz‐Gemeinschaft (Max Delbrück Center) und das Leibniz‐Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP), das gemeinsam von MDC und Charité – Universitätsmedizin Berlin betriebene und auf klinische Forschung spezialisierte Experimental and Clinical Research Center (ECRC) sowie das Berlin Institute of Health (BIH) in der Charité. Seit 1992 sind ca. 700 Millionen Euro an öffentlichen Fördermitteln durch die EU, den Bund und das Land Berlin in den Campus Berlin‐Buch investiert worden, um diese Synergien zu unterstützen. www.campusberlinbuch.de
BiotechPark Berlin‐Buch
Der BiotechPark Berlin‐Buch gehört mit 76 Unternehmen, 870 Beschäftigten und rund 30.000 Quadratmetern Büro‐ und Laborfläche (inklusive Gründerzentrum BerlinBioCube) zu den führenden Technologieparks in Deutschland. Ausgründungen im Bereich der Life Sciences finden hier ideale Bedingungen, vom Technologietransfer bis hin zu branchenspezifischen Labor‐ und Büroflächen. Die Life Science Community vor Ort ermöglicht einen direkten Austausch und gemeinsame Projekte. Der BiotechPark trägt maßgeblich zur dynamischen Entwicklung der Biotechnologie‐Region Berlin‐Brandenburg bei und stärkt in besonderem Maße die industrielle Gesundheitswirtschaft.
Quelle: Pressemitteilung der IBB
Research, Innovation, Patient care, Education / 22.01.2025
„Senat vor Ort“ am Zukunftsort Berlin-Buch
Sitzung des Senats von Berlin im Bezirk Pankow – Auszeichnung des Campus Berlin-Buch und Bezirkstour
Der Senat von Berlin war am 21. Januar 2025 zu Gast im Bezirk Pankow und hielt seine Sitzung auf dem Campus Berlin-Buch ab, einem der elf Zukunftsorte Berlins. Nach einer gemeinsamen Sitzung mit dem Bezirksamt trugen sich die Mitglieder des Senats ins Goldene Buch des Bezirks ein.
Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, hob die Bedeutung des Zukunftsorts Berlin-Buch hervor. „Der Campus Berlin-Buch ist ein Leuchtturm moderner Wissenschaft und Innovation in unserer Stadt. Mit seiner herausragenden Expertise in der Biomedizin und seiner beispielhaften Integration von Forschung, Technologie und Unternehmensgründungen steht der Campus für die Zukunft Berlins als internationale Wissenschafts- und Technologiehauptstadt. Besonders der BiotechPark und das neue Gründerzentrum BerlinBioCube zeigen, wie hier Talente, Ideen und unternehmerische Kraft zusammenkommen, um Fortschritte für Gesundheit und Gesellschaft zu erzielen. Mein Dank gilt allen, die den Campus zu einem Ort der Spitzenforschung und Zusammenarbeit machen – Sie prägen Berlins Ruf als führenden Wissenschaftsstandort.“
Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner übergab gemeinsam mit der Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Franziska Giffey, der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege, Ina Czyborra und Pankows Bezirksbürgermeisterin Cordelia Koch eine Auszeichnung in Form einer Plakette an den Zukunftsort Berlin-Buch.
Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Franziska Giffey: „Wir freuen uns, dass wir heute noch einmal besiegeln können, dass der Campus Berlin-Buch ein ganz herausragender Zukunftsort ist. Er steht für unser wirtschaftspolitisches Ziel, Berlin zum Innovationsstandort Nummer eins in Europa zu entwickeln. Es ist ein Ort, an dem Spitzenforschung stattfindet, aus der gleichzeitig Unternehmensgründungen entstehen. Wir fördern dies mit Mitteln des Landes, des Bundes und der EU – in den letzten Jahren sind 78 Millionen Euro in den Standort investiert worden. Insbesondere mit dem Gründungszentrum BerlinBioCube zeigen wir, dass Berlin in Innovation und Technologie investiert, und dass wir auch die richtigen Orte und Räume schaffen, um Talente aus der ganzen Welt willkommen zu heißen. Der Campus Berlin-Buch trägt wesentlich dazu bei, dass Berlin auf der internationalen Landkarte von Life Science und Biotech ganz vorn mitspielt.“
Zusammenspiel von Bezirk und Senat
Der Regierende Bürgermeister lobte die gute Zusammenarbeit zwischen dem Bezirk Pankow und dem Senat, die wichtig ist, um Herausforderungen hinsichtlich der geplanten neuen Stadtquartiere in der Region gemeinsam anzugehen. Dazu zählt die Anpassung der verkehrlichen Anbindung, aber auch der sozialen Infrastruktur. Bezirksbürgermeisterin Dr. Cordelia Koch begrüßte bezogen auf Letzteres eine neu geplante Gemeinschaftsinitiative mit dem Berliner Senat für Buch. Sie unterstrich die Bedeutung Buchs, das in Pankow für Gesundheit, Wissenschaft, Wirtschaft und Naturräume stehe. Der Bezirk unterstützt nicht zuletzt aktiv die Erweiterung des Campus mit dem aktuell laufenden Bebauungsplanverfahren. Damit ermöglicht er die Ansiedlung weiteren forschungsnahen Gewerbes und fördert neue Arbeitsplätze am Zukunftsort.
Bezirkstour startete auf dem Campus Berlin-Buch
Anschließend begaben sich der Regierende Bürgermeister Kai Wegner, Bezirksbürgermeisterin Dr. Cordelia Koch und Mitglieder von Senat und Bezirksamt auf eine Tour durch den Bezirk, die mit einer Führung über den Wissenschafts- und Technologiecampus startete.
Dr. Christina Quensel, Geschäftsführerin der Campus Berlin-Buch GmbH, begrüßte die Gäste und stellte die erfolgreiche Entwicklung des Wissenschafts- und Biotechcampus mit seinen biomedizinischen Forschungseinrichtungen und dem Biotechnologiepark mit 76 Unternehmen vor. Die Campusmanagerin verwies unter anderem auf die beeindruckenden wirtschaftlichen Effekte, die laut einer aktuellen IBB-Studie eine Erweiterung des Campus auf einer Fläche von fünf Hektar auf der ehemaligen Brunnengalerie mit sich bringen könnten: Bis zu 3.800 weitere Arbeitsplätze könnten am Standort und darüber hinaus geschaffen werden, eine zusätzliche Wirtschaftskraft von 1,44 Milliarden Euro sowie zusätzliche Einnahmen für das Land Berlin in Höhe von 125 Millionen Euro.
Aus Wissenschaft wird Wirtschaft: Beispiel T-knife
Auf einem gemeinsamen Rundgang durch das Gründerzentrum BerlinBioCube besuchten die Gäste das junge biopharmazeutische Unternehmen T-knife. Das Spin-off von Max Delbrück Center zusammen mit der Charité – Universitätsmedizin Berlin entwickelt neuartige Immuntherapien gegen Krebs und hat mittlerweile 70 Beschäftigte am Standort Buch. Mitgründerin und Chief Technology Officer Dr. Elisa Kieback erläuterte die Vorzüge des Gründerzentrums für T-knife und betonte, dass Berlin nach wie vor sehr attraktiv für Biotechs sei. Unter anderem gehörten die Verfügbarkeit von qualifizierten Mitarbeitenden und erschwingliche Labore zu den Vorzügen. In puncto Risikokapital müsse der Standort allerdings aufholen.
Nachwuchsförderung im Gläsernen Labor
Vom Gründerzentrum ging es zum Gläsernen Labor, dem gemeinsamen MINT-Schülerlabor der Campuseinrichtungen. Hier kamen die Gäste mit einer Schulklasse, die im Chemielabor experimentierte, ins Gespräch. Das Gläserne Labor bietet als außerschulischer Lernort Experimente zur Molekularbiologie, Neuro- und Zellbiologie, Protein- oder Wirkstoffchemie, Radioaktivität sowie Ökologie – mit engem Bezug zu den Forschungsthemen des Campus Berlin-Buch. Jugendliche lernen dort beispielsweise durch eigenständiges Experimentieren, wie die Genschere CRISPR/Cas funktioniert.
Weitere Stopps in Französisch-Buchholz und Prenzlauer Berg
Der Senat besuchte weiterhin das Gelände der „Alten Schäferei“ an der Schönerlinder Straße in Französisch-Buchholz. Dort soll ein neues Stadtquartier entstehen - mit mehr als 2.000 Wohneinheiten, öffentlichen Grünflächen, einer Gemeinschaftsschule und Kitas.
Zum Abschluss der Bezirkstour wurde das Frauenzentrum EWA e.V. im Prenzlauer Berg vorgestellt, das Beratungs- und Kulturangebote, Coachings sowie Sprach-, Computer- oder Sportkurse für Frauen bietet.
Hintergrundinformationen
Campus Berlin‐Buch
Der Campus Berlin‐Buch ist ein moderner Wissenschafts‐, Gesundheits‐ und Biotechnologiepark. Alleinstellungsmerkmale sind der klare inhaltliche Fokus auf Biomedizin und das enge räumliche und inhaltliche Zusammenwirken von Forschungsinstituten, Kliniken und Biotechnologie‐Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Erforschung molekularer Ursachen von Krebs,‐ Herzkreislauf‐ und neurodegenerativen Erkrankungen, eine interdisziplinär angelegte Grundlagenforschung zur Entwicklung neuer Therapien und Diagnoseverfahren, eine patientenorientierte Forschung und die unternehmerische Umsetzung biomedizinischer Erkenntnisse. Dank exzellenter Wissenschaftseinrichtungen und Unternehmen im BiotechPark hat der Campus ein herausragendes Innovations‐ und Wachstumspotenzial. Dazu gehören als Einrichtungen der Grundlagenforschung das Max‐Delbrück‐Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz‐Gemeinschaft (Max Delbrück Center) und das Leibniz‐Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP), das gemeinsam von MDC und Charité – Universitätsmedizin Berlin betriebene und auf klinische Forschung spezialisierte Experimental and Clinical Research Center (ECRC) sowie das Berlin Institute of Health (BIH) in der Charité. Seit 1992 sind über 600 Millionen Euro an öffentlichen Fördermitteln durch die EU, den Bund und das Land Berlin in den Campus Berlin‐Buch investiert worden, um diese Synergien zu unterstützen. www.campusberlinbuch.de
BiotechPark Berlin‐Buch
Der BiotechPark Berlin‐Buch gehört mit 76 Unternehmen, 870 Beschäftigten und rund 30.000 Quadratmetern Büro‐ und Laborfläche (inklusive BerlinBioCube) zu den führenden Technologieparks in Deutschland. Ausgründungen im Bereich der Life Sciences finden hier ideale Bedingungen, vom Technologietransfer bis hin zu branchenspezifischen Labor‐ und Büroflächen. Die Life Science Community vor Ort ermöglicht einen direkten Austausch und gemeinsame Projekte. Der BiotechPark trägt maßgeblich zur dynamischen Entwicklung der Biotechnologie‐Region Berlin‐Brandenburg bei und stärkt in besonderem Maße die industrielle Gesundheitswirtschaft.
Mit dem Gründerzentrum BerlinBioCube baut der BiotechPark seine Spitzenposition aus und trägt zur weiteren Profilierung Berlins als Gründerhauptstadt bei. 50 Prozent der Fläche des Gründerzentrums sind bereits vermietet. Unter den neun Start-ups, die gemietet haben, sind Spin-offs aus Forschungseinrichtungen des Campus. Sie entwickeln innovative Gen- und Zelltherapien oder Wirkstoffe, um Krebs oder andere Volkskrankheiten wirksam zu bekämpfen. Ihre medizinischen Innovationen beruhen zum Teil auf jahrzehntelanger Grundlagenforschung, die jetzt ihren Weg in die Anwendung finden.
Campus Berlin‐Buch GmbH
Als Betreibergesellschaft des Campus ist die Campus Berlin‐Buch GmbH (CBB) Partner für alle dort ansässigen Unternehmen und Einrichtungen. Biotechnologieunternehmen – von Start‐ups bis zu ausgereiften Firmen – anzusiedeln, zu begleiten und in allen Belangen zu unterstützen, gehört zu ihren wesentlichen Aufgaben. Hauptgesellschafter der CBB ist mit 50,1 % das Land Berlin. Weitere Gesellschafter sind das Max‐Delbrück‐Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz‐Gemeinschaft (29,9 %) und der Forschungsverbund Berlin e.V. für das Leibniz‐Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (20 %).
Max Delbrück Center
Das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (Max Delbrück Center) gehört zu den international führenden biomedizinischen Forschungszentren. Nobelpreisträger Max Delbrück, geboren in Berlin, war ein Begründer der Molekularbiologie. An den Standorten in Berlin-Buch und Mitte analysieren Forscher:innen aus rund 70 Ländern das System Mensch – die Grundlagen des Lebens von seinen kleinsten Bausteinen bis zu organ-übergreifenden Mechanismen. Wenn man versteht, was das dynamische Gleichgewicht in der Zelle, einem Organ oder im ganzen Körper steuert oder stört, kann man Krankheiten vorbeugen, sie früh diagnostizieren und mit passgenauen Therapien stoppen. Die Erkenntnisse der Grundlagenforschung sollen rasch Patient:innen zugutekommen. Das Max Delbrück Center fördert daher Ausgründungen und kooperiert in Netzwerken. Besonders eng sind die Partnerschaften mit der Charité – Universitätsmedizin Berlin im gemeinsamen Experimental and Clinical Research Center (ECRC) und dem Berlin Institute of Health (BIH) in der Charité sowie dem Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK). Am Max Delbrück Center arbeiten 1560 Menschen. Finanziert wird das 1992 gegründete Max Delbrück Center zu 90 Prozent vom Bund und zu 10 Prozent vom Land Berlin. www.mdc-berlin.de
Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP)
Wie entstehen Krankheiten? Mit welchen Wirkstoffen kann man gezielt in die Biochemie des Körpers eingreifen? Um diese Fragen dreht sich die Arbeit am Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP), Deutschlands einzigem außeruniversitären Forschungsinstitut für Pharmakologie. Chemiker, Biologen, Pharmakologen, Physiker und Mediziner arbeiten eng zusammen und legen die Grundlagen für zukünftige Medikamente. Ziel der Grundlagenforschung des FMP ist es, neue bioaktive Moleküle zu identifizieren und ihre Wechselwirkung mit ihren biologischen Zielen in Zellen oder Organismen zu charakterisieren. Solche Moleküle dienen als Werkzeuge in der biomedizinischen Grundlagenforschung und liefern Ansatzpunkte für die Entwicklung neuer Wirkstoffe und Strategien für die Behandlung, Prävention oder Diagnose von Krankheiten. Das 246 Mitarbeiter:innen zählende Institut ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft und gehört dem Forschungsverbund Berlin e.V. an. leibniz-fmp.de
Berliner Zukunftsorte
Zukunftsorte sind Standorte, an denen vor Ort Netzwerkstrukturen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft existieren bzw. geschaffen werden sollen. Der tatsächlich gelebte Austausch und die Kooperationen von Wirtschafts-, Forschungs-, und Technologieeinrichtungen fördern die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft. Zukunftsorte generieren Wachstum basierend auf zukunftsweisenden Produkten durch wertschöpfende Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe fördert diesen europaweit einzigartigen Zusammenschluss u. a. durch die gemeinsame Geschäftsstelle der Zukunftsorte Berlin. zukunftsorte.berlin
T-knife GmbH
T-knife Therapeutics ist ein Spin-off von Max Delbrück Center zusammen mit der Charité – Universitätsmedizin Berlin: Als biopharmazeutisches Unternehmen entwickelt es innovative T-Zell-basierte Therapien zur Behandlung von Krebs. Durch die Kombination von fortschrittlichen Technologien in den Bereichen Immuntherapie und Genomeditierung will das Unternehmen die Wirksamkeit und Präzision der Krebstherapien verbessern. T-knife fokussiert sich auf die Entwicklung von T-Zellen, die speziell auf Tumorzellen abzielen, um so die Tumorbekämpfung zu optimieren und gleichzeitig gesunde Zellen zu schonen. Das Unternehmen befindet sich in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase seiner klinischen Studien. Für seine Innovation konnte T-knife Risiko-Kapital in Höhe von rund 200 Millionen Dollar einwerben und gehört damit zu den bestfinanzierten Start-ups der deutschen Biotech-Szene. www.t-knife.com
Gläsernes Labor
Das Gläserne Labor gehört zu den ersten Schülerlaboren in Deutschland und ist Vorreiter für viele Entwicklungen im außerschulischen Bereich. Heute besuchen bis zu 14.000 Schüler:innen jährlich die Kurse. In sechs authentischen Laboren bietet es u.a. Experimente zur Molekularbiologie, Neuro- und Zellbiologie, Protein- oder Wirkstoffchemie, Radioaktivität sowie Ökologie – mit engem Bezug zu den Forschungsthemen des innovativen Wissenschafts- und Biotechnologie-Campus Berlin-Buch. Jugendliche lernen beispielsweise durch eigenständiges Experimentieren, wie die Genschere CRISPR/Cas funktioniert. Das Schülerlabor fördert den MINT-Nachwuchs vom Grundschulalter bis zur Abitur- und Studienvorbereitung. Es richtet als Pate den Regionalwettbewerb Jugend forscht mit aus, bietet Projektwochen, Vorlesungen, Arbeitsgemeinschaften, Praktika und Plätze im Freiwilligen Ökologischen Jahr. Das Gläserne Labor ist das gemeinsame Schülerlabor von Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (Max Delbrück Center), Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP) und Campus Berlin-Buch GmbH. Es wird durch zahlreiche Förderer und Sponsoren, darunter Campuspartner Eckert & Ziegler SE, unterstützt. www.glaesernes-labor.de
Research, Innovation, Patient care / 22.01.2025
Wechsel im Aufsichtsrat der Campus Berlin-Buch GmbH
Prof. Dr. Hans-Jörg Schmedes ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats
Seit dem 17. Januar 2025 ist Prof. Dr. Hans-Jörg Schmedes Vorsitzender des Aufsichtsrats der Betreiber- und Entwicklergesellschaft des Wissenschafts- und Biotechnologiecampus Berlin-Buch, der Campus Berlin-Buch GmbH. Er tritt die Nachfolge von Heidrun Rhode-Mühlenhoff an, die den Vorsitz seit 2019 innehatte.
„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Schmedes“, erklärt Dr. Christina Quensel, Geschäftsführerin der Campus Berlin-Buch GmbH. Co-Geschäftsführer Dr. Ulrich Scheller bekräftigt dies und ergänzt: „Mit Prof. Dr. Schmedes wurde ein in Politik, Verwaltung und Wirtschaft sehr erfahrener Experte in den Aufsichtsrat berufen.“
Prof. Dr. Hans-Jörg Schmedes ist Leiter der Abteilung Betriebe und Strukturpolitik der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und Honorarprofessor am Institut für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Research / 17.01.2025
Heike Graßmann new State Secretary in Saxony

The Max Delbrück Center congratulates Professor Heike Graßmann, who has served as Administrative Director of the research center since 2018, on her appointment as State Secretary for Science, Culture, and Tourism in Saxony. Graßmann will assume her new role in Dresden on February 1, 2025.
Today, Saxony's Minister-President Michael Kretschmer (CDU) announced the appointment of Professor Heike Graßmann, previously the Administrative Director of the Max Delbrück Center for Molecular Medicine in the Helmholtz Association in Berlin, as the new State Secretary in the Ministry of Science, Culture, and Tourism. In her new role, Graßmann will work closely with State Minister Sebastian Gemkow.
“The scientific landscape in Saxony is outstanding. Our researchers and the diverse institutions in Saxony have an excellent international reputation. I am very much looking forward to helping shape science policy and further developing Saxony as a hub of excellence. I am eager to bring my extensive experience to this new role,” said Graßmann.
“I warmly congratulate my colleague Heike Graßmann and wish her every success in her new position. Heike is an excellent manager and a highly respected expert in the German scientific landscape,” said Professor Maike Sander, Scientific Director of the Max Delbrück Center. “I deeply appreciate her outstanding contributions to the Max Delbrück Center and our excellent collaboration. As Administrative Director, she has positioned our research center’s administration to meet future challenges effectively. Her efforts to advance digitalization, strengthen cooperation between science and administration, foster community spirit, and enhance diversity have left a lasting impact. She also played a pivotal role in strengthening the Max Delbrück Center’s network in Berlin.”
About Heike Graßmann
Born in Thuringia, Graßmann (53) is an accomplished science manager with an impressive career. Since October 2018, she has served as Administrative Director of the Max Delbrück Center, overseeing areas such as finance, human resources, legal affairs, and infrastructure. She has also driven initiatives in internationalization, digitalization of administration, and diversity and cultural topics.
Before joining the Max Delbrück Center, Graßmann, who holds a PhD in business administration, served as Administrative Managing Director of the Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) in Leipzig for many years. Since 2022, she has been a member of the University Council at Leipzig University and holds an honorary professorship at the State Academy for Studies in Leipzig, part of the University of Cooperative Education Saxony.
Graßmann has long been committed to talent management, gender equality, and diversity at the Max Delbrück Center and beyond. She mentors young women in various programs and served as treasurer for BR50, the Berlin Association of Non-University Research Institutes, where she helped establish a network for administrative leaders in Berlin. She currently chairs the organizing committee for the Long Night of Sciences in Berlin.
Graßmann studied business administration at Martin Luther University Halle-Wittenberg, where she also worked as a research associate. Before joining the UFZ, she served as personal assistant to the Executive Board at the Helmholtz Centre for Environmental Research and the Chancellor at Leipzig University. From 2012 to 2018, she led the finance department at the UFZ before becoming its Administrative Managing Director.
Source: Press Release Max Delbrück Center
Heike Graßmann new State Secretary in Saxony
Patient care / 17.01.2025
Helios Klinikum Berlin-Buch: Erweiterungsbau setzt neue Maßstäbe für Geburtshilfe und OP-Medizin
Mit einem umfassenden Erweiterungsbau investiert das Helios Klinikum Berlin-Buch in die Zukunft der medizinischen Versorgung. Der viergeschossige Neubau, der direkt an das Hauptgebäude anschließt, bietet auf einer Fläche von rund 4.200 Quadratmetern modernste Infrastruktur und innovative Technologien. Ziel ist es, die Versorgung für werdende Eltern sowie Patient:innen im ambulanten und stationären Bereich nachhaltig zu verbessern.
Das Helios Klinikum Berlin-Buch begann mit dem Spatenstich im Herbst 2022 sein aktuelles Bauprojekt und wird hiermit nicht nur neue Maßstäbe in der Patient:innenversorgung setzen, sondern sich auch als Vorreiter für innovative Medizin in Berlin positionieren. Die neuen Kapazitäten und Technologien werden nicht nur die Patient:innensicherheit verbessern,´sondern auch das medizinische Angebot für den stark wachsenden Berliner Norden und darüber hinaus nachhaltig stärken. Der moderne und lichtdurchflutete Erweiterungsbau fügt sich nicht nur harmonisch in die bestehende Architektur ein, sondern bleibt für die Mitarbeitenden sowie den Patient:innen dem Prinzip der kurzen Wege treu. „Das Erdgeschoss wird zukünftig ein ambulantes Operationszentrum beherbergen, während im ersten Obergeschoss zusätzliche OP-Säle für die stationäre Hochleistungsmedizin und ein ´OP der Zukunft´ untergebracht sind“, beschreibt Projektleiter Torsten Wegemund das neue Nutzungskonzept. Im zweiten Obergeschoss entsteht der erweiterte Kreißsaalbereich mit neuen Vorwehenzimmern, und im Gartengeschoss wird Platz für Technik geschaffen. Das Bauprojekt wird in enger Zusammenarbeit mit der Berliner Senatsverwaltung umgesetzt: „Wir sind sehr dankbar, dass sich die Berliner Senatsverwaltung bereits zu Beginn großzügig in die Planungen unseres Erweiterungsbaus eingebracht hat. Die Abstimmungen liefen und laufen nach wie vor sehr gut“, erklärt Klinikgeschäftsführerin Carmen Bier den gewinnbringenden Austausch mit dem Senat.
Mehr Komfort für Schwangere
„Im neuen Gebäude entsteht ein einzigartiger Vorwehenbereich, der insbesondere unseren schwangeren Patientinnen einen großen Zugewinn bietet“, erzählt Carmen Bier. „Hier können Schwangere, die sich in einer frühen Geburtsphase befinden, stationär aufgenommen werden. Hiervon profitieren nicht nur die werdenden Mütter, sondern auch die Partner:innen, die ebenfalls vor Ort bleiben können. Somit können sich die Paaren gemeinsam auf die Geburt vorbereiten.“
Die neuen Räumlichkeiten sind nahtlos mit dem bestehenden Kreißsaal verbunden, was weiterhin für Mitarbeitende und Patient:innen kurze Wege innerhalb der Geburtsklinik gewährleistet. Zudem können somit zwei zusätzliche Kreißsäle im Hauptgebäude eingerichtet werden, sodass zukünftig sechs statt vier Kreißsäle zur Verfügung stehen. Damit reagiert das Klinikum auf die stetig steigende Nachfrage: Rund 3.000 Geburten werden hier jährlich betreut.
Ambulantes OP-Zentrum und ein „OP der Zukunft“
Ein weiterer Schwerpunkt des Erweiterungsbaus ist das neue ambulante Operationszentrum. Mit vier hochmodernen OP-Sälen und einer Raumluftklasse 1 – der höchsten Qualitätsstufe, die für ambulante Settings eher selten ist – wird in Berlin-Buch ein neues Kapitel in der ambulanten Chirurgie aufgeschlagen. „Mit dem Bau eines neuen ambulanten OP-Zentrums können wir unsere stationären OP-Kapazitäten erhöhen, denn bislang finden auch viele ambulante Eingriffe in unserem Zentral-OP statt. Hiervon profitieren nicht nur unsere Ärztinnen und Ärzte, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Poliklinik sowie externe Ärztinnen und Ärzte“, so Bier. Das Baukonzept setzt zudem auf Gemütlichkeit und verzichte bewusst auf einen großen Aufwachraum wie Carmen Bier erklärt: „Um unseren Patientinnen und Patienten nach ihrem ambulanten Eingriff mehr Privatsphäre zu bieten, haben wir uns bewusst für den Bau von Einzel- und Zweibettzimmern zum Aufwachen entschieden.“
Der Erweiterungsbau umfasst auch einen „OP der Zukunft“, der den bestehenden Zentral-OP ergänzt. „Patientinnen und Patienten werden in Berlin-Buch zukünftig in einem höchst digitalen und robotergestützen OP-Saal behandelt werden können. Davon profitieren insbesondere die Fachbereiche, die bereits jetzt OP-Robotern einsetzen wie unsere ENDO-Klinik, die Urologie, die Allgemein-, Viszeral- und Onkologische Chirurgie aber auch die
Gynäkologie. Die zunehmende Einbindung von Robotik und KI-basierten Behandlungen wird sowohl die Patient:innensicherheit als auch die Behandlungsqualität weiter steigern“, gibt Klinikgeschäftsführerin Carmen Bier einen Ausblick in die Zukunft.
„Die Eröffnung des Erweiterungsbaus ist perspektivisch für den Jahreswechsel 2025/2026 anvisiert“, sagt Projektleiter Wegemund abschließend.
Das Helios Klinikum Berlin-Buch ist ein modernes Krankenhaus der Maximalversorgung mit über 1.000 Betten in mehr als 60 Kliniken, Instituten und spezialisierten Zentren sowie einem Notfallzentrum mit Hubschrauberlandeplatz. Jährlich werden hier mehr als 55.000 stationäre und über 144.000 ambulante Patienten mit hohem medizinischem und pflegerischem Standard in Diagnostik und Therapie fachübergreifend behandelt, insbesondere in interdisziplinären Zentren wie z.B. im Brustzentrum, Darmzentrum, Hauttumorzentrum, Perinatalzentrum, der Stroke Unit und in der Chest Pain Unit. Die Klinik ist von der Deutschen Diabetes Gesellschaft als „Klinik für Diabetiker geeignet DDG“ zertifiziert.
Zudem ist die Gefäßmedizin in Berlin-Buch dreifach durch die Fachgesellschaften der DGG (Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin), der DGA (deutsche Gesellschaft für Angiologie) und der DEGIR (deutsche Gesellschaft für interventionelle Radiologie) als Gefäßzentrum zertifiziert.
Gelegen mitten in Berlin-Brandenburg, im grünen Nordosten Berlins in Pankow und in unmittelbarer Nähe zum Barnim, ist das Klinikum mit der S-Bahn (S 2) und Buslinie 893 oder per Auto (ca. 20 km vom Brandenburger Tor entfernt) direkt zu erreichen.
Helios ist Europas führender privater Gesundheitsdienstleister mit 127.000 Mitarbeitenden. Zum Unternehmen gehören unter dem Dach der Holding Helios Health die Helios Gruppe in Deutschland sowie Quirónsalud in Spanien und Lateinamerika. Rund 26 Millionen Menschen entscheiden sich jährlich für eine medizinische Behandlung bei Helios. 2023 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von mehr als 12 Milliarden Euro.
In Deutschland verfügt Helios über mehr als 80 Kliniken, rund 230 Medizinische Versorgungszentren (MVZ) mit etwa 600 kassenärztlichen Sitzen, sechs Präventionszentren und 27 arbeitsmedizinische Zentren. Helios behandelt jährlich rund 5,5 Millionen Menschen in Deutschland, davon mehr als 4 Millionen ambulant. Seit seiner Gründung setzt Helios auf messbare, hohe medizinische Qualität und Datentransparenz und ist bei 89 Prozent der Qualitätsziele besser als der bundesweite Durchschnitt. In Deutschland beschäftigt Helios rund 78.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 7,3 Milliarden Euro. Sitz der Unternehmenszentrale ist Berlin.
Quirónsalud betreibt 57 Kliniken, davon sieben in Lateinamerika, über 100 ambulante Gesundheitszentren sowie rund 300 Einrichtungen für betriebliches Gesundheitsmanagement. Jährlich werden hier rund 20 Millionen Patient:innen behandelt, davon mehr als 19 Millionen ambulant. Quirónsalud beschäftigt 49.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von rund 4,8 Milliarden Euro.
Helios gehört zum Gesundheitskonzern Fresenius.
Innovation / 15.01.2025
Eckert & Ziegler Signs Licence Agreement for Actinium-225 with Chinese Joint Venture
Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) today signed a licence agreement with Qi Kang Medical, Ltd (QKM), a joint venture between Eckert & Ziegler and the Chinese company DC Pharma, for the cyclotron technology used by Eckert & Ziegler to manufacture Ac-225. The contract guarantees Eckert & Ziegler a one-time payment of EUR 10 million and additional royalties on Ac-225 sales.
For Eckert & Ziegler the licence and collaboration agreement is an important step towards establishing the company as a major supplier of Ac-225 for the radiopharmaceutical industry. Eckert & Ziegler is already supplying Ac-225 and will be able to provide the market with significantly increased quantities of Ac-225 in GMP quality from 2025.
Currently, Ac-225-based radiopharmaceuticals are under clinical investigation for various cancers, including prostate tumors, colorectal cancer, and leukemia. A substantial increase in the demand for Ac-225 is projected over the next decade, driven by its expanding clinical applications and the promising results seen in ongoing trials. Despite its therapeutic promise, sufficient quantities of Ac-225 remain scarce.
Source: Press Release Eckert & Ziegler
Eckert & Ziegler Signs Licence Agreement for Actinium-225 with Chinese Joint Venture
Innovation / 14.01.2025
FDA Clears Ariceum Therapeutics’ 225Ac-Satoreotide Phase I/II Clinical Study in Patients with Small Cell Lung Cancer or Merkel Cell Carcinoma
Berlin, Germany, 14 January 2025 – Ariceum Therapeutics (Ariceum), a private biotech company developing radiopharmaceutical products for the diagnosis and treatment of certain hard-to-treat cancers, today announced that the US Food and Drug Administration (FDA) has cleared its investigational new drug (IND) application to commence a Phase I/II clinical trial (‘SANTANA-225’) of its proprietary radiolabelled peptide, 225Ac-SSO110, in patients with small cell lung cancer (SCLC) or Merkel Cell Carcinoma (MCC).
The SANTANA-225 trial is a global, open-label Phase I/II study, that will assess the safety, tolerability, preliminary efficacy and recommended Phase II dose of 225Ac-SSO110 in patients with extensive-stage SCLC or MCC who are on first-line maintenance therapy with checkpoint inhibitors. Ariceum is working with its partners and clinical sites in the US and other countries to commence recruitment of patients in Q1 2025.
Germo Gericke, Chief Medical Officer at Ariceum Therapeutics, said: “This is an important milestone, not only for Ariceum but for the whole field of targeted radionuclide cancer treatments. 225Ac-SSO110 is the first somatostatin receptor 2 (SSTR2) antagonist labelled with Actinium-225 to undergo human trials, providing the optimum combination of a long half-life α particle emitter with a long tumour retention tracer. Based on encouraging clinical data with 177Lu-SSO110 and very promising pre-clinical data of 225Ac-SSO110, we are very optimistic about the potential for patients with difficult to treat cancers.”
225Ac-SSO110 is being developed together with its companion patient selection tracer 68Ga-SSO120 as a ‘theranostic pair’ targeted radionuclide treatment of multiple indications expressing SSTR2, such as SCLC, MCC, and other aggressive cancers. Ariceum has recently expanded its global supply agreements for the medical radionuclides Actinium-225 (225Ac) and Lutetium-177 (177Lu), which will be used to radiolabel SSO110.
-Ends-
About Ariceum Therapeutics
Ariceum Therapeutics is a private, clinical stage radiopharmaceutical company focused on the diagnosis and precision treatment of certain neuroendocrine and other aggressive, hard-to-treat cancers. The name Ariceum is an anagram of ‘Marie Curie’ whose discovery of radium and polonium have been huge contributions to finding treatments for cancer.
Ariceum’s lead targeted systemic radiopharmaceutical candidate, SSO110 (“satoreotide”) labelled with Lutetium-177 (177Lu) and Actinium-255 (255Ac) is an antagonist of the somatostatin type 2 (SSTR2) receptor which is overexpressed in aggressive neuroendocrine tumours (NETs) such as small cell lung cancer (SCLC) or Merkel Cell Carcinoma (MCC), all of which have limited treatment options and poor prognosis. Satoreotide is being developed as a ‘theranostic pair’ for the combined diagnosis and targeted radionuclide treatment of these tumours. Ariceum is also developing a radiolabelled PARP-inhibitor (ATT001), currently in Phase 1 clinical development under the trial name CITADEL-123. ATT001 was part of the acquisition of Theragnostics Ltd which was closed in June 2023.
Ariceum Therapeutics, launched in 2021, acquired all rights to satoreotide from Ipsen, which has remained a shareholder of the Company. Ariceum is headquartered in Berlin, with operations in Germany, Switzerland, Australia, the United Kingdom, and the United States.
Ariceum is led by a highly experienced management team and supported by specialist investors including EQT Life Sciences (formerly LSP), HealthCap, Pureos Bioventures, Andera Partners, and Earlybird Venture Capital. For further information, please visit www.ariceum-therapeutics.com.
Research, Innovation, Patient care / 13.01.2025
Neue Chance für „Werk Buch“
Für das Industriedenkmal Am Stener Berg wird eine neue Nutzung geplant. Interview mit dem Projektteam der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Von 1904 bis 1912 entstand das „Werk Buch“ unter Leitung des Stadtbaurats Ludwig Hoffmann. Welche Funktion hatte es? Wie ist der heutige Zustand?
Alexander Hörnke: Am Stener Berg befand sich die Versorgungszentrale für die umliegenden Krankenhäuser und Heilanstalten. Das „Werk Buch“ umfasste unter anderem ein Kesselhaus, ein Maschinenhaus, eine Bäckerei, eine Wäscherei und sogar ein Wasserwerk. Es gewährleistete den reibungslosen Betrieb der Gesundheitsinfrastruktur im Nordosten unserer Stadt, und zwar noch bis in die 1990er Jahre. Mit der Schließung etlicher Einrichtungen und dem Neubau des Helios Klinikums ging diese Bedeutung verloren, was aber verschiedene gewerbliche Nutzungen auf dem Grundstück ermöglichte. Heute ist das Gelände ein nicht mehr zeitgemäßes Gewerbeareal, das sowohl denkmalgeschützte Bestandsgebäude als auch Zweckbauten aus der DDR-Zeit umfasst.
Als landeseigene Gesellschaft von Berlin sind Sie beauftragt, eine neue Nutzung zu entwickeln. Wie ist der Stand?
Alexander Mittag: 2017 beschlossen das Land Berlin und der Bezirk Pankow, die Liegenschaft zu einem Gewerbestandort zu entwickeln. Bisherige Entwicklungsversuche scheiterten aber vor allem an der fehlenden Wirtschaftlichkeit. Jetzt möchte die BIM ein individuell zugeschnittenes Vermarktungskonzept für das Gelände erarbeiten. Mit der frühzeitigen Einbindung von wesentlichen Stakeholdern sowie einem zukunftsweisenden Branding sind wir überzeugt, das historische Gelände zu einem erfolgreichen Gewerbe- und Produktionscampus entwickeln zu können.
Den ersten Meilenstein markiert dabei ein seit Oktober 2024 vorliegendes Konzept für eine Bodenneuordnung und Erschließung des Areals. Es formuliert ein Profil für den Standort und bildet die Grundlage für die spätere Vermarktung der Flächen.
Welche Handlungsempfehlungen leiten sich daraus ab?
Laura Hurthe: Der wachsende Leerstand, steigende Instandsetzungskosten und der zunehmende Aufwand zur Sicherung der teilweise gesperrten, denkmalgeschützten Gebäude verdeutlichen einen akuten Handlungsbedarf. Die ersten konzeptionellen Ansätze zeigen Wege auf, wie eine behutsame Verdichtung des Areals dringend benötigte Gewerbeflächen für aus der Innenstadt verdrängte Betriebe schaffen und mit den Bedürfnissen der Bestandsmieter und Nachbarn vereinen kann, ohne die denkmalgerechten Anforderungen zu vernachlässigen. Derzeit ist vorgesehen, dass die Flächen weiterhin im Landeseigentum bleiben und durch Erbbaurechte an Unternehmen vergeben werden, die sich am Standort ansiedeln möchten.
Vor welchen Herausforderungen stehen Sie beziehungsweise künftige Nutzer?
Alexander Hörnke: Das Areal ist baulich unzureichend ausgenutzt und geprägt von einer stark sanierungsbedürftigen Gebäudesubstanz, anspruchsvoll ist auch die gegenwärtige Erschließungssituation. In Zeiten knapper Landeskassen stellt dies eine gewaltige Herausforderung dar, insbesondere, da die denkmalgeschützten Gebäude fachgerecht zu sanieren sind. Hierfür braucht es kreative Lösungen und einen langen Atem. Nicht zuletzt ist auch die unzureichende ÖPNV-Anbindung zu nennen.
Welchen Beitrag kann das Areal perspektivisch für den Zukunftsort Berlin-Buch leisten?
Alexander Mittag: Unsere Vision zeichnet für das Areal das Bild eines stadtweit bekannten Campus, welcher aufgrund seiner Attraktivität verschiedenste Unternehmen mit einem klaren Bezug vor allem zum Gesundheitsstandort Berlin-Buch anzieht. Der Wissenschaftscampus ist hier Vorbild. Gleichermaßen liegen uns natürlich der Erhalt des architektonischen Erbes sowie eine Mitgestaltung und damit verbundene Aufwertung des gesamten Quartiers am Herzen.
Welches sind die nächsten Schritte?
Laura Hurthe: Bis am Stener Berg die ersten Bagger rollen, wird noch einige Zeit vergehen. Erst müssen vorliegende Konzepte weiter in Richtung eines integrierten Masterplans vertieft und qualifiziert werden, bevor voraussichtlich in 2025 erste Vermarktungsaktivitäten starten können. Ein
besonderes Augenmerk ist auf die Revitalisierung der „Alten Bäckerei“ an der Schwanebecker Chaussee gerichtet. Vielleicht gelingt es, hier schnell wieder einen Anlaufpunkt für die Nachbarschaft zu schaffen. Vorschläge, Ideen oder Bewerbungen sind jedenfalls jederzeit willkommen.
Interview: Dr. Ulrich Scheller, Christine Minkewitz / Campus Berlin-Buch GmbH
Der Beitrag erschien zuerst im Standortjournal buchinside 02/2024.
Innovation / 13.01.2025
Eckert & Ziegler and GlyTherix Extend Collaboration With Actinium-225 Supply Agreement
Eckert & Ziegler (ISIN DE0005659700, SDAX) and GlyTherix Ltd (GlyTherix), an Australian targeted radiotherapy company specialising in developing antibody radiopharmaceuticals for solid tumors, today announced the expansion of their existing Lutetium-177 based collaboration with a global supply agreement for Actinium-225 (Ac-225). Eckert & Ziegler will provide high-quality Ac-225 to support GlyTherix’s clinical research and development activities on innovative alpha radiotherapeutics.
In December 2024 Eckert & Ziegler announced the start of their Ac-225 production as part of the collaboration with the Nuclear Physics Institute of the Czech Academy of Sciences (ÚJF). The establishment of Ac-225 manufacturing in GMP quality is ongoing and expected to be finalized in the first half of 2025, enabling new possibilities for pharmaceutical companies developing alpha-emitting drugs.
GlyTherix's radiotherapy approach combines a radionuclide with an antibody targeting Glypican-1, a protein found in aggressive cancers, to deliver localized radiation while sparing healthy tissue. Glypican-1 is an attractive tumor target that occurs in several aggressive and invasive cancers including prostate, pancreatic, bladder, lung, glioblastoma and ovarian cancer. GlyTherix plans to use 177Lu-DOTA-Miltuximab in its planned Australian Phase Ib in early 2025, followed by US Phase II trials in 2026. GlyTherix has commenced its Ac-225-based research and development activities at the Australian ARC Research Hub for Advanced Manufacture of Targeted Radiopharmaceuticals (AMTAR) at the University of Queensland.
“We are happy to extend our collaboration with GlyTherix to fully support the planned development activities also for Actinium-225-based radiopharmaceuticals,” said Dr. Harald Hasselmann, CEO of Eckert & Ziegler. ”Increasing the availability of Ac-225 is our key objective as it will accelerate both progress in clinical research and commercial applications, which will ultimately result in the improved access to cancer therapies for patients globally.”
Dr. Brad Walsh, GlyTherix Chief Executive Officer commented, “We are pleased to be able to rely on Eckert & Ziegler also for the supply of Actinium-225. Alongside with Lutetium-177, Actinium-225 will become an important part of our clinical program later this year. It is therefore vital securing a reliable network for global supply of the alpha emitter to consistently support our upcoming trials.”
About Eckert & Ziegler
Eckert & Ziegler SE, with more than 1,000 employees, is a leading specialist in isotope-related components for nuclear medicine and radiation therapy. The company offers a broad range of services and products for the radiopharmaceutical industry, from early development work to contract manufacturing and distribution. Eckert & Ziegler shares (ISIN DE0005659700) are listed in the TecDAX index of Deutsche Börse.
Contributing to saving lives.
About GlyTherix
GlyTherix Ltd is an Australian targeted radiotherapy company specializing in developing antibody radiopharmaceuticals for solid tumours. Miltuximab specifically targets Glypican-1, a protein found in solid tumours such as prostate, bladder, pancreatic, glioblastoma, oesophageal and ovarian cancers, and is not present in healthy tissue. The company has a strong proprietary and Intellectual Property position covering both Miltuximab and the antigen Glypican-1. This provides robust and long-term protection for the commercialization of important new treatments to people with little hope.
GlyTherix has completed a ‘First-in-Human’ trial of 12 patients using Miltuximab with no drug-related adverse events. Miltuximab will be used in a Phase Ib trial as an antibody theranostic. GlyTherix is interested in partnerships or collaborations with larger biotech and pharmaceutical partners.
Source: Press Release Eckert & Ziegler
Eckert & Ziegler and GlyTherix Extend Collaboration With Actinium-225 Supply Agreement
08.01.2025
Baustart im Waldhaus Buch
Seit kurzem kann der aufmerksame Beobachter Bautätigkeit auf dem Areal des denkmalgeschützten Waldhauses Buch an der Zepernicker Straße wahrnehmen. Das historische Pförtnerhaus wird saniert und auf der Freifläche hinter dem Waldhaus, dort, wo künftig 108 Eigentumswohnungen und 87 möblierte Apartments in vier Neubauten errichtet werden sollen (WaldhausQuartier), sind Bagger bei der Arbeit. Der erste Bauabschnitt hat begonnen.
Für das historische schlossähnliche Waldhaus, jetzt als WaldhausLab bezeichnet, ist Anfang Oktober die Baugenehmigung erteilt worden. 7500 m2 Gewerbeflächen soll es in der früheren Lungenheilstätte geben. Es ist geplant, die Immobilie, die bereits seit 1992 leer steht, für eine gewerbliche Nutzung im medizinischen Bereich denkmalgerecht zu revitalisieren. Zwischenzeitlich wurde das Dachgeschoss vollständig entkernt. Im März 2025 soll mit der Dachsanierung begonnen werden, damit die Gebäudesubstanz geschützt ist. Ob es bereits ernstzunehmende Mieter gibt, darüber wollen die Projektentwickler noch nicht reden. Das Bucher Großprojekt wurde initiiert von der Profi Partner AG und der Goldmann Group in Kooperation mit der landeseigenen Howoge, die weitere Neu bauten auf dem Gelände errichten will.
»Wir befinden uns derzeit noch in einem guten Planungs- und Abstimmungsprozess mit dem Bezirk Pankow«, erklärte Howoge-Sprecherin Annemarie Rosenfeld gegenüber »BB«. Die Howoge plant ca. 130 Mietwohnungen, dabei soll ein größerer Anteil an Familienwohnungen entstehen. Die Mieten sollen »leistbar« sein.
Das landeseigene Wohnungsunternehmen geht von einem Baustart Ende 2025 aus.
Der erste Bauabschnitt von Profi Partner und Goldmann Group hat begonnen. Investiert werden ca. 133 Mio Euro. Auf dem Programm steht derzeit die Tiefenenttrümmerung im Bereich der zukünftigen Tiefgarage, die über 114 Stellplätze verfügen wird. Die historische Parkanlage bleibt erhalten, alte Wege und ein Waldspielplatz werden neu angelegt.
Die Projektverantwortlichen setzen beim Bau auf Nachhaltigkeit und streben das Qualitätssiegel »Nachhaltiges Gebäude« an. »Die Neubauten entstehen im Effizienzhaus-40-Standard«, so Dirk Germandi, der Profi Partner-Projektentwickler. Die Fertigstellung des Projektes ist aktuell für 2027 geplant. Der Verkaufsstart für den ersten Bauabschnitt (28 Wohnungen und 87 möblierte Apartments) ist erfolgt.
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung: Der Artikel erschien zuerst in der Dezember-Ausgabe 2024 des Bucher Boten.
Research, Patient care / 07.01.2025
Developing a CRISPR therapy for muscular dystrophy
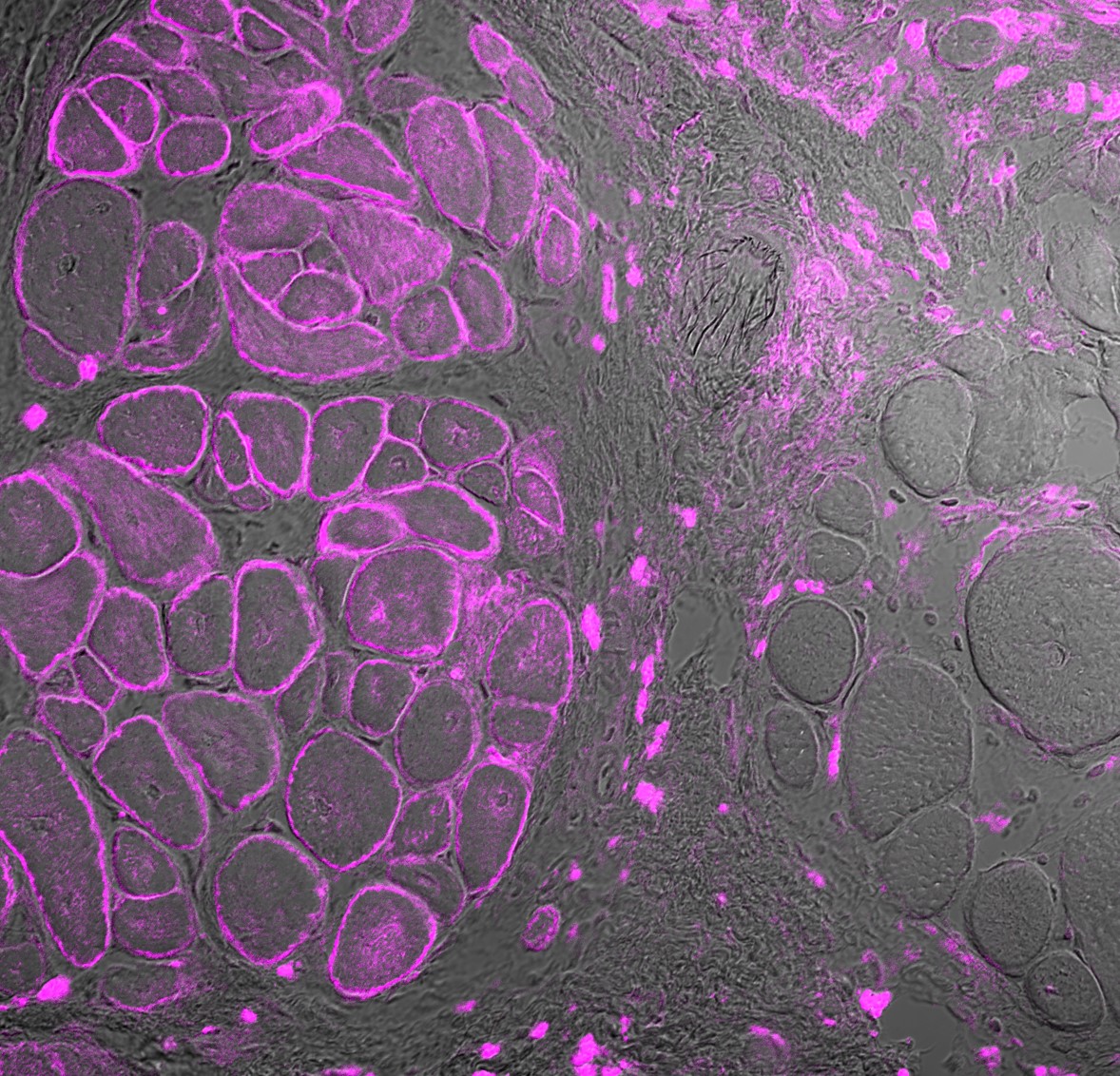
Researchers at the Experimental and Clinical Research Center in Berlin are developing a targeted treatment for muscular dystrophy with the help of gene-editing. Preclinical research led by the Spuler Lab published in “Nature Communications” now paves the way for first-in-human clinical trials.
Researchers at the Experimental and Clinical Research Center (ECRC), a joint institution of the Max Delbrück Center and Charité – Universitätsmedizin Berlin, have developed a promising gene-editing approach intended to restore the function of a protein that is essential to repair and regrow muscle in patients with muscular dystrophy diseases.
The dysferlin protein is primarily responsible for repairing cell membranes. People with certain mutations in the gene coding for dysferlin develop muscular dystrophy – a group of muscle wasting diseases that affect thousands around the world.
Professor Simone Spuler and her team led by Dr. Helena Escobar in the Myology Lab at ECRC have successfully removed muscle stem cells from two patients with limb-girdle muscular dystrophy, corrected the genetic error and restored functioning dysferlin proteins in cell culture. In new mouse models of the disease, they used the same process to collect cells, edit them and transplant the corrected cells back into mice, where protein function was restored and muscles began to regrow.
The preclinical findings, reported in “Nature Communications,” give the team confidence to move forward to human clinical trials. This would involve taking muscle cells from patients, editing them in the lab and transplanting the patient’s own cells back into targeted muscles. The researchers note this therapy is not a complete cure – it would be limited to one or two muscles.
“We have over 600 muscles in our body and it is not easy to target all of them,” says Spuler. “We are starting very humble with targeting one or two muscles. But if this therapy works, it will heal the muscle.”
Body of work
For nearly 20 years, Spuler and her collaborators have been working to understand dysferlin, its role in muscular dystrophy and ways to cure these rare but devastating inherited diseases. In the case of limb-girdle muscular dystrophy, muscle deterioration is progressive and young adults lose the ability to walk and normal use of their arms and hands.
“You go from being a good athlete in your teens to being in a wheelchair by 40,” says Spuler, who sees this first-hand with her patients at an outpatient clinic at ECRC.
Escobar, first paper author and molecular biologist in Spuler’s Lab, has been working on methods to collect muscle stem cells from patients and use gene-editing tools to fix mutations.
“We started with a more common mutation so that we can help as many patients as possible,” Escobar says.
Classical CRIPSR
To fix the dysferlin mutation, Escobar uses CRISPR-Cas9, which is often described as “gene-editing scissors” and for which a Nobel Prize was awarded in 2020. The molecular scissors are guided to a precise location along a DNA molecule and then cut it, forcing the cell to repair the DNA. The aim is for the mutation to be corrected during the repair process, resulting in a properly functioning gene. The researchers tested their editing system in several cellular models all with very similar results: It worked with a high success rate and minimal unintended consequences.
Notably, the editing did not result in an exact match to the desired genetic sequence and there were four changes in the generated dysferlin protein. The team conducted a thorough analysis of the changes in collaboration with Professor Oliver Daumke, who heads the Structural Biology of Membrane-Associated Processes Lab at Max Delbrück Center.
“Even with these four changes, the generated protein is very similar in function to the wild type, which is the version we see in healthy individuals. It localized along damaged cell membranes and muscle was regenerated,” Escobar says.
Crucial model and clinical trial
As part of this project, the researchers developed a new mouse model in collaboration with Dr. Ralf Kühn, who leads the Genome Engineering & Disease Models Lab at Max Delbrück Center. The mouse model closely mimics the specific dysferlin mutation and resulting disease, and enabled the researchers to evaluate how the complete therapy works – taking muscle stem cells, correcting them and transplanting the cells back. They especially wanted to learn if the immune system would reject the cells or attack the generated dysferlin proteins.
“We didn’t see an immune response against the transplanted cells or generated proteins, which is promising for taking this into a clinical trial,” Spuler says.
The team is now seeking funds to launch the first human clinical trial. If the trial is successful, it would still be many years before it is broadly accessible.
Simone Spuler and Helena Escobar are co-inventors on a pending patent application on gene editing of human muscle stem cells. Spuler is co-founder of MyoPax GmbH and MyoPax Denmark ApS. The study was funded by the Gisela Krebs foundation.
Left: Muscle fibers expressing dysferlin (purple) made from gene-edited muscle stem cells transplanted into a mouse that lacks dysferlin. Right: Muscle fibers from the recipient mouse that are diseased and lack dysferlin.© Andreas Marg, AG Spuler, ECRC
Source: Press Release Eckert & Ziegler
Developing a CRISPR therapy for muscular dystrophy
- News
- Events
- MAGAZINE „buchinside“
- Press service/Download
-
News Archiv
- Archive News 2025
- Archive News 2024
- Archive News 2023
- Archive News 2022
- Archive News 2021
- Archive News 2020
- Archive News 2019
- Archive News 2018
- Archive News 2017
- Archive News 2016
- Archive News 2015
- Archive News 2014
- Archive News 2013
- Archive News 2012
- Archive News 2011
- Archive News 2010
- Archive News 2009
- Archive News 2008