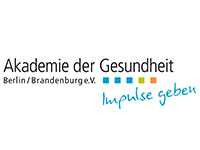News 2015
forschen / 23.12.2015
Wie die DNA Distanzen überbrückt: Ein neues Verständnis der räumlichen Organisation unseres Erbguts
Vor nunmehr 15 Jahren wurde die Entzifferung des menschlichen Genoms gefeiert. Damals hatten die Wissenschaftler die Abfolge der genetischen Buchstaben auf der gesamten DNA bestimmt. Mittlerweile ist bekannt, dass dies nur ein erster Schritt auf einer langen Reise war: Außer in ihrer Buchstabenfolge verschlüsselt die DNA ihre Information auch in der Art und Weise, wie sie im Zellkern gepackt ist. Ein Forscherteam unter Leitung von Ana Pombo vom Max-Delbrück-Centrum hat jetzt gemeinsam mit internationalen Kollegen aus Italien, Kanada und Großbritannien umfassende 3D-Karten der räumlichen Organisation des Erbguts von embryonalen Stammzellen der Maus bis hin zu voll entwickelten Neuronen erstellt und im Fachmagazin Molecular Systems Biology veröffentlicht. Diese Karten könnten künftig dabei helfen, die an Erbkrankheiten beteiligten Gene aufzuspüren.
\nVerschiedene Zellen unseres Körpers tragen die gleiche Erbinformation, niedergeschrieben in der Abfolge der genetischen Buchstaben auf der DNA. Seit langem erforschen Wissenschaftler intensiv, wie die auf dem langen DNA-Faden angeordneten Gene gesteuert werden. Denn welche Gene in einer Zelle abgelesen werden, entscheidet darüber, ob aus einer Zelle zum Beispiel eine Haut-, Herz- oder Nervenzelle wird; Fehler bei der Genregulation können zu Krankheiten führen.
\nDabei ist klar geworden, dass die lineare Abfolge der DNA-Buchstaben allein nicht ausreicht, um das Genom zu verstehen. „Die dreidimensionale Anordnung der DNA ist ebenfalls sehr wichtig“, sagt Ana Pombo, Leiterin der Arbeitsgruppe Epigenetische Regulation und Chromatinstruktur am MDC. Der DNA-Faden, in Mäusen auf 20 Chromosomenpaare aufgeteilt, ist im Zellkern dicht gepackt. Doch dieses Packen ist nicht zufällig. „Die komplexe räumliche Faltung der DNA der Chromosomen steuert die Aktivität von Genen”, erläutert die Wissenschaftlerin.
\nTatsächlich gab es während des letzten Jahrzehnts große Fortschritte bei der Bestimmung der dreidimensionalen Architektur der Chromosomen. So ist mittlerweile bekannt, dass diese in so genannte topologische Domänen unterteilt sind, das heißt in DNA-Abschnitte, die mehr interne Kontakte haben als zu ihren genomischen Nachbarn. „Bislang wurde jedoch nur die räumliche Struktur in und um diese Domänen bestimmt“, sagt Markus Schüler, Postdoc in Ana Pombos Gruppe am MDC und einer der Erstautoren der Studie. „Es fehlte uns ein vollständiges Bild, wie diese Domänen miteinander interagieren und ob diese Domän-Domän-Interaktionen mit der Genfunktion in Zusammenhang stehen.“
\nGenau das haben die Forscher vom MDC nun untersucht. Sie haben sich im Detail angesehen, wie die gesamte DNA der Chromosomen gefaltet ist und welche Regionen dabei bevorzugt miteinander interagieren. Als Modell diente ihnen dabei die Entwicklung der Nervenzellen der Maus von embroyonalen Stammzellen über einen Vorläufer bis hin zu ausdifferenzierten Nervenzellen. Für diese drei Zelltypen haben die Forscher Interaktionskarten, so genannte Hi-C-Daten, ausgewertet: Also Daten dazu, welche Regionen sich innerhalb der Chromosomen jeweils berühren .
\nAuf diese Weise konnten die Forscher für alle Chromosomen in allen drei Zelltypen eine Matrix der Kontakte aufstellen. Dabei haben sie herausgefunden, dass sich die Domänen in den Chromosomen zu größeren Meta-Domänen gruppieren. Dabei, und das ist entscheidend, ist die Faltung nicht zufällig. „Verschiedene Regionen auf einem Chromosom finden zusammen, weil sie etwas gemeinsam haben“, sagt Ana Pombo. „Regionen mit ähnlichen funktionellen Eigenschaften treten miteinander in Kontakt, zum Beispiel Gene, die aktiv sind oder die über denselben Mechanismus reguliert werden.“
\nUm das zu veranschaulichen, nimmt Ana Pombo einen Faden zur Hand, der die DNA darstellen soll. Damit bildet sie mehrere Schlaufen, an deren Basis sich der Faden immer wieder trifft: „Hier treffen sich die Regionen, die etwas gemeinsam haben.“ Diese Anordnung zu Schlaufen verdeutlicht eine besonders wichtige Erkenntnis: Regionen, zwischen denen auf der linearen DNA sehr große Distanzen liegen, können so räumlich in Kontakt treten. „Wir haben zum ersten Mal diese weitreichenden Kontakte zwischen den Domänen für ganze Chromosomen bestimmt“, sagt Ana Pombo.
Die Forscher konnten diese Interaktionen als eine baumartige Hierarchie von Domänen repräsentieren, die zeigt, wer mit wem in Kontakt steht. Beim Vergleich der Baumdiagramme von den embryonalen Stammzellen, Vorläufern und Nervenzellen beobachteten sie, dass bei der Ausdifferenzierung interessanterweise viele der weitreichenden DNA-Kontakte bestehen bleiben. Andere formieren sich dagegen neu, orientieren sich aber wieder an Gemeinsamkeiten. „Veränderungen der Genaktivität korrelieren mit Veränderungen in der räumlichen Organisation“, bringt Markus Schüler das auf den Punkt.
Die Wissenschaftler vom MDC glauben, dass diese Karte der Kontakte zukünftig helfen könnte, die genetischen Ursachen einiger Krankheiten zu finden. Zum einen könnten damit Translokationen, also Umlagerungen der DNA auf den Chromosomen, ausfindig gemacht werden, die bei einigen Leiden wie Krebs eine Rolle spielen. Zum anderen könnten die für Erbkrankheiten verantwortlichen Gene identifiziert werden. In den letzten Jahren gab es unzählige genomweite Studien, die Mutationen mit verschiedenen Erkrankungen in Verbindung gebracht haben. Bei vielen dieser genetischen Varianten ist allerdings nicht klar, wie sie die jeweilige Krankheit verursachen, zum Beispiel weil sie nicht ein einzelnes Gen treffen, sondern die Interaktion zwischen verschiedenen Genen beeinflussen.
„Unsere Karten erweitern jetzt den Pool der Regionen auf der DNA, die von einer einzelnen Mutation betroffen sein könnten“, sagt Ana Pombo. Für eine Genvariante kann jetzt nachgesehen werden, mit welchen anderen Bereichen auf der DNA sie in Kontakt steht. Die Berliner Forscher wollen als nächstes solche Zusammenhänge für neurologische Erkrankungen wie Autismus und für Skeletterkrankungen untersuchen.
\n
Link zur Studie:
http://msb.embopress.org/cgi/doi/10.15252/msb.20156492
Quelle: Molecular Systems Biology (2015) 11: 852
\n
"Hierarchical folding and reorganization of chromosomes are linked to transcriptional changes in cellular differentiation"
James Fraser, Carmelo Ferrai, Andrea M Chiariello, Markus Schueler, Tiago Rito,Giovanni Laudanno, MarianoBarbieri, Benjamin L Moore, Dorothee CA Kraemer,Stuart Aitken, Sheila Q Xie, Kelly J Morris, Masayoshi Itoh,Hideya Kawaji, InesJaeger, Yoshihide Hayashizaki, Piero Carninci, Alistair RR Forrest, , Colin A Semple,JoséeDostie, Ana Pombo, Mario Nicodemi
DOI 10.15252/msb.20156492| Published online 23.12.2015
Abbildung: (A) Schematische Darstellung der embryonalen Stammzellen der Maus (ESC) über einen neuronalen Vorläufer (NPC) bis hin zu ausdifferenzierten Nervenzellen (Neurons) (B) Meta-Domänen (metaTADs) werden durch das Clustern von individuellen topologischen Domänen (TADs) bestimmt (C) Teil der Interaktionskarte eines Chromosomes mit Domänen und Meta-Domänen als weiße Boxen dargestellt. (D) Baumhierarchie der Meta-Domänen des kompletten Chromosome 6 in Stammzellen (oben) und neuronalen Vorläuferzellen (unten). Die Farbskala zwischen den Bäumen zeigt ihre lokale Ähnlichkeit. Zwei Beispiele für sehr ähnliche (grüne) und unähnliche (rote) Regionen sind dargestellt. (Abb.: M. Schüler/AG Pombo)
\n
investieren, leben, bilden / 22.12.2015
Neue Kita in Buch eingeweiht
\n
1,8 Millionen Euro für Sanierung investiert
\nDer Bezirk Pankow hat damals Weitsicht bewiesen und Grundstück und Gebäude behalten, so die zuständige Bezirksstadträtin für Jugend und Immobilien, Christine Keil, auf der Einweihungsfeier am 3. Dezember 2015. Ohne Stadtumbau-Mittel wäre die Wiedereröffnung jedoch nicht möglich gewesen: Von den 1,8 Millionen Euro für die Sanierung und den Umbau des Gebäudes nach den Plänen des Büros mghs kamen 1,6 Millionen Euro aus dem Förderprogramm, der große Rest sind Eigenmittel des Trägers KVPB Kindertagesstätten gGmbH.
\n\n
Aus dem Gruppenraum ins Freie
Das Gebäude aus den 1960er-Jahren hat einen verglasten Vorbau mit Foyer und Mehrzweckraum im Obergeschoss erhalten. Das Fundament wurde teilweise freigelegt, um aus dem Keller ein Souterrain zu machen und die Räume besser nutzen zu können - zum Beispiel als Sport- und Mehrzweckraum. Neue oder auch vergrößerte Fenster lassen überall mehr Licht ins Gebäude. Die Gruppenräume im Erdgeschoss haben direkten Zugang zur Terrasse und über eine lange Rampe auch zum großzügigen Garten, der noch weiter ausgestaltet werden soll.
Im Foyer fällt neben großen Glasfronten und "nackten" Betonflächen eine Wand mit sechs Farbfeldern auf. Die Farben finden sich in den Gängen wieder. Dieses Konzept dient der Orientierung und lädt die Kinder gleichzeitig zur Beschäftigung mit Farben und Materialien ein.
Familienzentrum geplant
\nStadträtin Christine Keil bedankte sich bei der gemeinnützigen Tochterfirma des Kulturvereins Prenzlauer Berg (KVPB e. V.), die als Bauherrin die Sanierung und den Umbau des Gebäudes stemmte und die Kita nun betreibt. "Kein Tag vergeht hier ohne Besonderheiten," so Karin Paul, die Leiterin der Einrichtung. Auch Kinder aus der nahen Flüchtlingsunterkunft sind schon in der Kita angemeldet - ein wichtiger Schritt zur Integration von Anfang an. Die Kita möchte das Haus nach und nach zu einem Familienzentrum ausbauen. Karin Paul setzt für ihre Arbeit auch auf das starke Netzwerk des etablierten Kulturvereins mit seiner gemeinnützigen gGmbH, die noch fünf weitere Kitas betreibt.
\n\n
Text: Anka Stahl
\nFoto: Gruppenraum mit direktem Zugang zur großen Terrasse am Abend der Eröffnung - tagsüber fällt viel Licht durch die großen Fenster zum Garten. (Foto: Anka Stahl)
\n
Weitere Bilder und Informationen finden Sie hier.
\n
leben / 22.12.2015
Ameisen auf dem Kiez-Spielplatz sind nun Freunde der Kinder
Es gibt auch jetzt wieder Ameisen auf der Fläche - zum Glück sind die hölzernen Tiere zahm und lassen sich zum Klettern und Balancieren nutzen. Die jetzige Gestaltung basiert auf den Wünschen und Ideen von Kindern und Erwachsenen aus zwei Beteiligungsrunden. Viele beliebte Geräte, wie Drehscheibe, Doppelschaukel und Tischtennisplatte, blieben erhalten oder wurden ersetzt. Hinzu kam ein anspruchsvolles Klettergerät mit Rutsche für die Größeren und ein Sandspielgerät für die Kleinen sowie bunte Hüpfteller und ein Balancierbalken.
Zur feierlichen Eröffnung kam eine Kindergruppe der Kita im Grünen. Wie der Ameisenspielplatz war auch ihre Freifläche und das Gebäude aus Fördermitteln des Programms Stadtumbau Ost saniert worden. Erst kürzlich wurde in der Nähe eine weitere Kita wiedereröffnet. Von den zahlreichen Förderprojekten für die Bucher Kinder profitieren auch viele Familien aus der nahegelegenen Flüchtlingsunterkunft. Finanziert wurde das Bauvorhaben mit rund 136.000 Euro aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost.\n
Text: Anka Stahl
Foto: Das neue Maskottchen des Ameisenspielplatzes - eine Ameise! (Foto: Anka Stahl)
\n
Weitere Informationen und Bilder finden Sie hier.
\n
forschen / 21.12.2015
Den Ursachen für Herzmuskelverdickung auf der Spur
Eine krankhafte Verdickung des Herzmuskels, die Hypertrophie, entsteht in Reaktion auf eine kontinuierliche und vermehrte Belastung des Herzens, beispielsweise durch Bluthochdruck. Die Herzzellen nehmen dabei an Größe zu, sie „hypertrophieren“. Das äußert sich in einer Verdickung der Herzwände. Hinzu kommt, dass die Kammern kleiner und der Muskel steifer werden, wodurch sich die Pumpleistung des Herzens verschlechtert. Hypertrophie ist gleichzeitig ein entscheidender Risikofaktor für die Entwicklung einer Herzmuskelschwäche, einer schweren Erkrankung, die oft zu Herzversagen und zum Tod führt.
Wissenschaftler des Experimental and Clinical Research Center, einer gemeinsamen Einrichtung der Charité und des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin (MDC), konnten gemeinsam mit Forschern des Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik in Berlin und der Havard Medical School in Boston erstmals den molekularen Signalweg beschreiben, der diese Erkrankung auslöst. Eine entscheidende Rolle spielen das Protein DPF und seine Zwillingsform DPF3a. Zunächst wird DPF3a von einem speziellen Enzym, einer Kinase, durch die Übertragung eines Phosphatrestes aktiviert. In dieser aktiven Form bindet DPF3a an ein weiteres Protein, welches das Ablesen verschiedener Gene am DNA-Strang blockiert. Durch diese Verbindung wird das Protein aus seiner Blockadeposition gelöst, die freiwerdenden Gene abgelesen und in Proteine übersetzt. DPF3a startet auf diese Weise die vermehrte Bildung von Proteinen der frühen Herzentwicklung, die auch bei der pathologischen Hypertrophie charakteristisch erhöht sind. Weitergehende Analysen in Herzproben von Patienten mit pathologischer Hypertrophie bestätigten diese Ergebnisse.
Prof. Rickert-Sperling, Leiterin der Forschungsgruppe Kardiovaskuläre Genetik am ECRC, erklärt, dass ein besseres Verständnis der molekularen Grundlagen der pathologischen Hypertrophie der erste Schritt zu einer Behandlung der Herzinsuffizienz ist. „Meine Hoffnung ist, dass wir hierfür einen neuen vielversprechenden Ansatz liefern konnten“, sagt sie. Die Suche nach neuen Zielmolekülen für Arzneimittel zur Behandlung der Herzinsuffizienz ist weltweit ein sehr intensiv bearbeitetes Forschungsgebiet.
*Phosphorylation of the chromatin remodeling factor DPF3a induces cardiac hypertrophy through releasing HEY repressors from DNA, Nucleic Acids Research, doi: 10.1093/nar/gkv1244\n
forschen / 21.12.2015
Erfolg für den Technologietransfer am MDC: Neues Medikament gegen Blutgerinnungsstörungen zugelassen
VONVENDI berührt ein Stoffpatent des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin Berlin-Buch (MDC), das auf die Arbeiten von Prof. Michael Bader und Dr. Diego Walter zurückgeht. Die Wissenschaftler hatten Serotonin-modulierende Wirkstoffe untersucht, die zur Behandlung von Blutgerinnungsstörungen eingesetzt werden können, u.a. den von-Willebrandt-Faktor.
Bereits vor einigen Jahren hatte die Ascenion GmbH, Technologietransferpartner des MDC, einen Lizenzvertrag zwischen dem MDC und Baxter verhandelt, mit dem das Unternehmen die exklusiven Rechte erhielt, den Faktor zur Therapie von Blutgerinnungsstörungen zu nutzen. Im Gegenzug wurden Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren für das MDC vereinbart. Über die Lizenzierung des Stoffpatentes hinaus war das MDC nicht in die Entwicklung des Medikamentes eingebunden.
„Nach der Zulassung von Amgens Krebsmedikament Blincyto ist dies das zweite Produkt auf Basis von MDC-Patenten, das im Laufe weniger Monate den Markt erreicht“, so Dr. Christian Stein, Geschäftsführer von Ascenion. „Das ist ein großer Erfolg für Patienten weltweit – und für den Technologietransfer.“ Die Rückflüsse aus den Lizenzen könnten es dem MDC ermöglichen, weitere zukunftsweisende Forschungsprojekte auf den Weg zu bringen.
Der wissenschaftliche Direktor (komm.) des MDC, Prof. Dr. Thomas Sommer, sagt: „Der Transfer unserer Erkenntnisse aus der molekularbiologischen Grundlagenforschung in die Anwendung ist seit der Gründung Teil unserer Mission. Umso mehr freut es mich, so kurz hintereinander zwei Medikamente auf dem Markt zu sehen.“ Der Erfolg zeige einmal mehr den Wert der Grundlagenforschung.
Die von-Willebrand-Krankheit ist die häufigste erbliche Blutgerinnungsstörung. Genetische Veränderungen führen dazu, dass der für die Blutgerinnung wichtige von-Willebrand-Faktor in veränderter Form, in geringerem Maße oder gar nicht produziert wird. Die Folge ist eine erhöhte Blutungsneigung, die je nach Ausprägung bis zu massiven Blutungen reichen kann. Sie betrifft rund einen von hundert Menschen weltweit, wobei nur einer von einer Million an einer besonders schweren Form der Erkrankung leidet.\n
Foto: Max Delbrück Center for Molecular Medicine Berlin-Buch (MDC) at the Campus Berlin-Buch (Foto: Peter Himsel, BBB Management GmbH)
forschen / 19.12.2015
Dem Ribosom bei der Arbeit zuschauen
Uwe Ohler hat sich während seines Studiums mit Spracherkennungsprogrammen beschäftigt. Der Informatiker nutzte statistische Verfahren, um aus den durch Nebengeräusche „verrauschten“ Daten die für eine korrekte Erkennung von Wörtern relevanten Informationen herauszufiltern. Die hierfür genutzten mathematischen Methoden, zu denen beispielsweise die Fourier-Transformation gehört, sind aus der modernen Datenverarbeitung längst nicht mehr wegzudenken. Egal, ob Astrophysiker Spektren im Licht von fernen Sternen untersuchen oder ob es um Spracherkennung in Handys geht: immer müssen „verrauschte“ Signale möglichst korrekt interpretiert werden. Jetzt wendet Ohler diese Filtermethoden auf die Molekularbiologie an. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vom Berlin Institute für Medical Systems Biology (BIMSB) am MDC hat er „RiboTaper“ entwickelt und getestet. Das Programm filtert aus bestimmten Sequenzier-Daten die relevanten Informationen heraus, ob eine der zellulären Proteinfabriken – die Ribosomen – auf einer RNA tatsächlich aktiv ist.
„RiboTaper“ baut dabei auf ein Labor-Verfahren auf, das vor einigen Jahren in den USA entwickelt wurde. Es heißt Ribo-seq und dient der Identifizierung von Genen, die für ein Protein kodieren. Das ist insofern wichtig, als der Lehrsatz, dass die DNA Bauanleitungen für Proteine enthält, nicht ganz stimmt. Tausende von Genen, die in den letzten Jahren im Genom kartiert wurden, werden zwar in RNA transkribiert, aber es ist nicht bekannt, ob sie eventuell kleine, proteinkodierende Abschnitte enthalten. Insgesamt ist nur ein kleiner Teil des Genoms dafür zuständig, Eiweiße zu produzieren. Der weit größere Anteil der DNA hat regulatorische Funktionen. Hinzu kommt: Von Zelle zu Zelle werden unterschiedliche Gene manchmal hoch- und manchmal heruntergeregelt oder stillgelegt. Wie aber findet man nun heraus, aus welchen Gene in welcher Zelle tatsächlich Protein produziert werden sind und aus welchen gerade nicht?
Dazu muss man sich die Ribosomen anschauen und die Bauanleitungen, nach denen sie arbeiten. Hier hilft Ribo-seq, denn das Verfahren aus dem „wet lab“ friert gewissermaßen die Ribosomen dort fest, wo sie am RNA-Strang sitzen. Die RNA ist die aus den Genen übermittelte Bauanleitung. Alles außer Ribosom und der damit verbundenen RNA werden mit biochemischen Werkzeugen verdaut. Das ermöglicht den Molekularbiologen festzustellen, mit welcher Anleitung die Ribosomen gerade arbeiten. Das Problem dabei: Die Daten, die man mit Ribo-seq erhält, sind „verrauscht“. Es gibt in jeder Zelle winzige Reste von DNA, RNA und Proteinen, die natürlicherweise entstehen und abgebaut werden. Hinzu kommt, dass man nie genau weiß, ob die Ribosomen an der identifizierten Stelle auf den RNAs auch wirklich aktiv sind und Proteine produzieren oder ob sie gewissermaßen erst auf ein weiteres Signal warten. Die „dry lab“-Methode RiboTaper soll diese Informationlücke schließen helfen. Damit können die Rollen von DNA, RNA und Ribosomen viel genauer als bisher aufgeklärt werden.
Die RiboTaper-Strategie: a) Die Multitaper-Methode (Thomson, 1982) spürt in den Ribo-seq-Signalen ein 3-Nukleotid-Muster auf. Das zeigt an, dass dort eine Translation stattfindet. Die rote Linie zeigt die statistische Schwelle (p-Wert 0,5). Mit diesem Ansatz konnten bekannte und neue "Open Reading Frames" identifiziert werden (hier am Beispiel des Gens MRPS21). b) Tausende dieser Open Reading Frames wurden in kodierenden und nicht-kodierenden Gen-Regionen entdeckt. TPM steht für "transcript per million". Abb.: AG Ohler
„Wir wissen beispielsweise, dass ein bestimmtes Ribosom gewöhnlich 29 RNA-Bausteine – die Nukleotide – abdeckt“, erzählt Uwe Ohler. „Und wir wissen auch, dass das Ribosom entlang der RNA immer in Abständen von 3 Nukleotiden entlang wandert.“ So entsteht ein periodisches Muster, nach dem die Bioinformatiker in all den Daten suchen können. „Das zeigt uns dann, an welchen Stellen der RNA etwas Signifikantes passiert“, sagt Ohler. Das kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wenn man an eine Küche denkt, die ausgebrannt ist. Die Spurensicherung untersucht nun die Küche und findet Hinweise auf Mehl, Eier und Zucker sowie Rezeptseiten. Aber war der Kuchen fertig, als die Küche gebrannt hat? Oder standen nur die Zutaten für den Teig bereit? Was hatte der Koch vor zu backen? Mit Ribo-seq in Kombination mit RiboTaper kommt die molekularbiologische Spurensicherung nun dem Geheimnis der zellulären Küche ein gutes Stück näher.
Uwe Ohler erklärt: „Mit RiboTaper können wir in bislang wenig studierten Genen Jagd auf kleine Proteine machen und dazu beitragen, widersprüchliche Dateninterpretationen aufzuklären.“ Ohler sieht noch einen Vorteil: „Sequenziergeräte stehen heutzutage in vielen Labors, aber nur wenige Zentren haben auch eine gute Massenspektrometrie zur Hand. Mit RiboTaper können wir aus den Sequenzierdaten Schlüsse ziehen, was gerade translatiert wird.“ Um das neue Verfahren zu testen, hat Ohler die Probe aufs Exempel gemacht und bei seinem MDC-Kollegen Matthias Selbach die RiboTaper-Daten mittels Massenspektrometrie überprüfen lassen. Nachdem es bereits eine ganze Reihe von Gruppen am MDC gibt, die Ribo-seq nutzen, dürfte es spannend sein, wie RiboTaper ihnen bei der Interpretation zu helfen vermag.
Für die Studie kooperierte das Labor von Uwe Ohler mit Kolleginnen und Kollegen aus den BIMSB-Gruppen um Markus Landthaler, Benedikt Obermayer und Matthias Selbach.
Link zur Studie:
http://www.nature.com/nmeth/journal/vaop/ncurrent/full/nmeth.3688.html
\n
leben, erkunden / 17.12.2015
Ausstellung in der HELIOS Galerie: „Der Maler Rolf Lindemann“
Die Ausstellung ist dem künstlerischen Schaffen von Lindemann gewidmet und zeigt ausschließlich seine malerischen Werke. Die Themen sind klassisch und stellen Landschaften, Interieur, Porträts und Stillleben dar – gespeist aus dem real Erlebten. Dem Berliner Künstler geht es in seinen Bildern hauptsächlich um die Möglichkeit malerische Mittel auszuloten. Lindemanns Bilder sind keine konkreten Erinnerungen, sondern eher atmosphärisch. Der Perspektive setzt Rolf Lindemann flächige Kompositionen entgegen, in denen Figuren mit ausdrucksstarken Gesten agieren. Die lichtdurchfluteten Farbenspiele und farbigen Flächen sind komponiert wie Töne zu einer Melodie, zuweilen ebenso abstrakt wie auch die Musik. Rolf Lindemann ist 1933 in Magdeburg geboren und studierte von 1951 bis 1958 Malerei an der Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst Berlin. Der Künstler lebt und arbeitet in Berlin.
\n
Die HELIOS Galerie ist Begegnungsstätte für Bucher und Barnimer Bürger, für unsere Patienten, Besucher, Gäste und Mitarbeiter des Klinikums.
Wir laden Sie zum Besuch der Ausstellung herzlich ein.
Über die HELIOS Kliniken Gruppe
Zur HELIOS Kliniken Gruppe gehören 111 eigene Akut- und Rehabilitationskliniken inklusive sieben Maximalversorger in Berlin-Buch, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Schwerin, Wuppertal und Wiesbaden, 52 Medizinische Versorgungszentren (MVZ), fünf Rehazentren, zwölf Präventionszentren und 15 Pflegeeinrichtungen. HELIOS ist damit einer der größten Anbieter von stationärer und ambulanter Patientenversorgung in Deutschland und bietet Qualitätsmedizin innerhalb des gesamten Versorgungsspektrums. Sitz der Unternehmenszentrale ist Berlin.
HELIOS versorgt jährlich rund 4,5 Millionen Patienten, davon 1,2 Millionen stationär. Die Klinikgruppe verfügt insgesamt über mehr als 34.000 Betten und beschäftigt rund 68.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2014 erwirtschaftete HELIOS einen Umsatz von rund 5,2 Milliarden Euro. Die Klinikgruppe gehört zum Gesundheitskonzern Fresenius.
Klinikkontakt:
Klinik für Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie
Prof. Dr. med. Wolf-Dieter Ludwig
Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Tumorimmunologie und Palliativmedizin
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
Telefon: (030) 94 01-521 00
Telefax: (030) 94 01-521 09
\n
Foto: Prof. Dr. med. Wolf-Dieter Ludwig, Sybille König, Gertrud Schmidt-Petersen, Dr. Wilfried Karger (Foto: HELIOS Kliniken, Thomas Oberländer)
heilen / 17.12.2015
Bucher Chefarzt Professor Dr. Wolf-Dieter Ludwig im Amt des Vorsitzenden der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft bestätigt
Die AkdÄ bewertet als wissenschaftlicher Fachausschuss der Bundesärztekammer unter anderem neu zugelassene Arzneimittel, gibt unabhängige Empfehlungen zum rationalen Einsatz von Arzneimitteln, ist verantwortlich für die Bewertung, der ihr im Rahmen der Berufsordnung gemeldeten Arzneimittelwirkungen und koordiniert seit 2007 den vom Bundesministerium für Gesundheit finanzierten Aktionsplan zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit in Deutschland. Insbesondere die Frage nach dem Nutzen, der Sicherheit und der
Wirtschaftlichkeit von neuen Arzneimitteln soll in den nächsten drei Jahren ein Schwerpunkt der Tätigkeit der Kommission sein. „Die Einschätzung eines neuen Arzneimittels kann nur auf der Grundlage guter Evidenz aus wissenschaftlich fundierten klinischen Studien geschehen“, erklärt Professor Dr. med. Ludwig. „Um den therapeutischen Wert eines Arzneimittels bestimmen zu können, benötigen wir nach der Zulassung verstärkt unabhängige, vergleichende Studien“, so Ludwig weiter.
Prof. Dr. med. Henning T. Baberg, Ärztlicher Direktor im HELIOS Klinikum Berlin-Buch, würdigte die Arbeit des Vorstands der AkdÄ: „Die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft ist als unabhängiger wissenschaftlicher Fachausschuss der Bundesärztekammer unverzichtbar, wenn es um die weitere Beteiligung an Verfahren zur Nutzenbewertung von neu zugelassenen Arzneimitteln geht. Ich freue mich, dass unser Bucher Chefarzt Professor Ludwig hier einen so wertvollen Beitrag leistet“.
Zur HELIOS Kliniken Gruppe gehören 111 eigene Akut- und Rehabilitationskliniken inklusive sieben Maximalversorger in Berlin-Buch, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Schwerin, Wuppertal und Wiesbaden, 52 Medizinische Versorgungszentren (MVZ), fünf Rehazentren, zwölf Präventionszentren und 15 Pflegeeinrichtungen. HELIOS ist damit einer der größten Anbieter von stationärer und ambulanter Patientenversorgung in Deutschland und bietet Qualitätsmedizin innerhalb des gesamten Versorgungsspektrums. Sitz der Unternehmenszentrale ist Berlin.
HELIOS versorgt jährlich rund 4,5 Millionen Patienten, davon 1,2 Millionen stationär. Die Klinikgruppe verfügt insgesamt über mehr als 34.000 Betten und beschäftigt rund 68.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2014 erwirtschaftete HELIOS einen Umsatz von rund 5,2 Milliarden Euro. Die Klinikgruppe gehört zum Gesundheitskonzern Fresenius.
Foto: Prof. Dr. med. Wolf-Dieter Ludwig, Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Tumorimmunologie und Palliativmedizin im HELIOS Klinikum Berlin-Buch (Foto: HELIOS Kliniken, Thomas Oberländer)
leben / 15.12.2015
Diskussion zum Schlosspark als Naturschutzgebiet: So geht Bürgerbeteiligung!
\n
Noch bis zum 18. Dezember ist in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Am Köllnischen Park der Entwurf zur Verordnung über das Naturschutzgebiet „Schlosspark Buch und angrenzende Waldfläche“ öffentlich ausgelegt. Leider war beim Bürgerforumn kein Senatsvertreter da, der die Fragen der Bucher beantworten konnte. Trotz des kurzfristigen Termins konnte der Bezirksstadtrat von Pankow, Dr. Kühne an der Veranstaltung teilnehmen und stellte sich den kritischen Fragen. Für die Senatsverwaltung war der Termin zu kurzfristig, um innerhalb der Einspruchsfrist den Bedenken der Betroffenen und Anwohner in einer öffentlichen Diskussion Rede und Antwort zu stehen. So ist die Frage wohl berechtigt, warum dieser Entwurf nicht öffentlich in Buch ausgelegt wurde, sondern nur in der ca. 20 km entfernten Senatsverwaltung.
\n\n
Gartendenkmal und Erholungsfläche
\n
Bereits beim Bürgerforum im März zur weiteren Entwicklung von Buch waren viele Bucher und Bucherinnen gegen die Idee, den Schlosspark als Naturschutzgebiet auszuweisen.Bezirksstadtrat Dr. Kühne teilte den rund 100 interessierten Diskussionsteilnehmern den Standpunkt des Bezirksamtes Pankow mit. Auch ein unter Naturschutz gestellter Schlosspark Buch muss für die Öffentlichkeit frei zugänglich sein. Der Bucher Schlosspark ist ein eingetragenes Gartendenkmal und untrennbar mit der Geschichte von Buch verbunden. Bereits im 17. Jahrhundert wurde er angelegt und immer wieder verändert. Im Jahre 1907 wurde er für die Bevölkerung zugänglich gemacht. Von den Gebäuden steht heute nur noch die Schlosskirche. Das Schloss wurde 1964 abgerissen, die Orangerie bereits 1955. Es gibt schon länger die Idee, an der Stelle des Bucher Schlosses ein kleines, feines Schlosshotel zu errichten. Ob diese Pläne noch realisiert werden können, wenn große Teile des Schlossparks Naturschutzgebiet sind, ist fraglich.
\n
Pflegeeinsätze von Bürgern und Sanierung des Eingangsportals
\n
Der Bucher Bürgerverein engagiert sich seit Jahren für den Schlosspark. Vom zeitigen Frühjahr bis zum Spätherbst führte er monatliche freiwillige Arbeitseinsätze durch. Mal beteiligten sich die Mitglieder der Volkssolidarität, ein anderes Mal Schulklassen der Bucher Schulen. Zuletzt arbeiteten syrische Bewohner der Flüchtlingsunterkunft AWO Refugium Buch mit. In den letzten Jahren wurden Rosen und Frühblüher gepflanzt, Unrat und Unkraut genauso beseitigt wie viele Kubikmeter Laub. Ein Ziel ist es seit langem, für den Bucher Schlosspark ein neues Parkpflegewerk zu erstellen. Hierzu standen im Rahmen des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzepts (ISEK) Mittel aus dem Programm Stadtumbau Ost bereit. Die einhellige Meinung aller Diskussionsteilnehmer war, das der Schlosspark nicht erst unter Naturschutz gestellt wird und nachträglich ein Parkpflegewerk erarbeitet wird. Die Mittel, die dem Bezirksamt Pankow zur Pflege des Schlossparkes zur Verfügung stehen, reichen bei weitem nicht aus. Im Juni dieses Jahres wurde der Eingangsbereich des Schlossparks in Alt-Buch umfassend saniert. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 250.000 Euro. Soll jetzt der Park hier abgeschlossen werden?
\n
Widerspruch des Bucher Bürgervereins
\n
Zum Ende der lebhaften Diskussion wurde beschlossen, dass in den nächsten Tagen weitere Unterschriften gesammelt werden für den Widerspruch des Bucher Bürgervereins gegen diese Verordnung. Hierbei geht es vor allem um diese Punkte:
1. Die in § 4 benannte Pflege und Entwicklung ist gleichberechtigt von der obersten Denkmalschutzbehörde, der obersten Behörde für Naturschutz und Landschaftspflegeund dem Bezirksamt Pankow zu sichern und neben den in Absatz 1 genannten Zielen auf
\n- \n
- \n
- \n
- den Erhalt des Bucher Schlossparks als öffentlicher Park, \n
- die Wiederherstellung und den Erhalt des Bucher Schlossparks als schützenswertes Gartendenkmal \n
\n
auszurichten.
\n2. Die Verordnung ist erst nach Erstellung des in § 4, Abs. 2 benannten Pflege- und Entwicklungsplans und dessen öffentlicher Auslegung in Kraft zu setzen.
Begründung:
Für uns Bucher Bürger ist das übergeordnete Interesse die Erhaltung des Bucher Schlossparks als öffentlicher Park und als Gartendenkmal, als öffentlicher Raum für Ruhe und Erholung, für Spaziergänge und Naturerlebnis.
Die uneingeschränkte Offenhaltung des geschützten Gebietes halten wir für das Erleben der Natur und für das Verständnis und für die Vermittlung der Naturschutzziele als außerordentlich bedeutsam.
Gleichberechtigt mit den Maßnahmen des Naturschutzes entsprechend dem Entwurf der vorliegenden Verordnung sollen die denkmalgerechte Sanierung des Parks, die Nachpflanzung der ursprünglichen Alleen und Baumreihen, die Wiederherstellung der Sichtachsen, die Offenhaltung und Sanierung aller im Gartendenkmal enthaltenen Wege haben.
Die Wiederherstellung und die kommerzielle oder öffentliche Nutzung eines Gebäudes an der Stelle des ehemaligen Schlosses soll ohne Einschränkungen möglich sein.
Das Betreten der Wiesen mit Trockenrasen zwischen der Kastanienallee und dem Weg an der Friedhofsmauer/Schlosskirche sowie das Lagern und Spielen auf diesen Wiesen für Kinder und für Familien, sowie für Besucher des künftigen Gebäudes an der Stelle des ehemaligen Schlosses, soll gestattet bleiben.
Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Schlosspark Buch und angrenzende Waldfläche
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/schutzgebiete/download/aktuelle_verfahren/buch_vo_entwurf_begruendung.pdf
Entwurf der Naturschutzkarte
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/schutzgebiete/download/aktuelle_verfahren/buch_vo_entwurf_karte.pdf
Foto: Einweihung des neuen Schlosspark-Portals im Sommer 2015 (Foto: Bezirksamt Pankow)
forschen / 15.12.2015
Medikament gegen aggressive Form der Leukämie erhält europäische Zulassung
Blincyto dient der Behandlung von akuter lymphoblastischer B-Zellen-Leukämie (exakt: Philadelphia chromosome-negative precursor B-cell acute lymphoblastic leukemia oder pre B-cell ALL). In den USA gilt Blincyto als Durchbruch für diese spezielle Form der Leukämie. Die Kranken haben meist eine sehr schlechte Prognose von nur wenigen Monaten Überlebenszeit. Für sie bedeutet der Wirkstoff neue Hoffnung. Er wird in Situationen eingesetzt, in denen eine konventionelle Therapie nicht mehr zur Heilung führt.
In Menschen mit B-Zellen-ALL produziert das Knochenmark zu viele B-Zellen-Lymphoblasten, eine Art unreifer weißer Blutkörperchen. Anstatt zu funktionstüchtigen Zellen heranzureifen, vermehren sie sich rasch und verdrängen die normale Blutbildung. Der Wirkstoff Blinatumomab macht nun gewissermaßen die körpereigenen T-Zellen scharf, die die Krebszellen dann gezielt vernichten. Entscheidende Vorarbeiten dazu wurden vom seinerzeitigen MDC-Forscher Ralf Bargou in der Arbeitsgruppe von Prof. Bernd Dörken und danach in Bargous eigener Gruppe geleistet. Ralf Bargou ist heute Professor an der Uniklinik in Würzburg.
forschen / 07.12.2015
Bis aufs Atom: Bakterienskelett in der Nahaufnahme
Das erst vor fünf Jahren entdeckte Bactofilin findet man unter anderem im Bakterium Helicobacter pylori, das für einen Großteil der Magengeschwüre verantwortlich ist. Während man früher davon ausging, dass Bakterien über kein stabilisierendes Zytoskelett verfügen, weiß man heute, dass auch die Winzlinge von komplexen Architekturen durchzogen werden, ähnlich wie die größeren und evolutionär gesehen moderneren Zellen von Pflanzen und Tieren. Durch Bactofilin erhält Helicobacter pylori seine typische schraubenförmige Gestalt, dank der sich das Bakterium durch die schützende Schleimschicht der Mageninnenwand bohren kann. Die einzelnen Bactofilin-Moleküle polymerisieren im Inneren der Bakterien spontan zu feinsten Fasern und höher geordneten Strukturen. Dabei spielt ein ungewöhnliches Strukturmotiv eine Rolle, wie das Team von Adam Lange am Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) schon in einer Anfang des Jahres veröffentlichten Arbeit herausgefunden hatte. Es handelt sich um die sogenannte Beta-Helix, die man nie zuvor in einem Zytoskelett gefunden hatte. Die Bactofilin-Moleküle ähneln in ihrer Form Spiralnudeln mit sechs Windungen, bei der Polymerisation lagern sie sich weiter zu langen, extrem dünnen Fasern aneinander.
Die Untersuchung solcher Faserproteine ist eine Herausforderung für Strukturbiologen, da sie sich weder in Flüssigkeit lösen noch auskristallisieren lassen, wie es für die gängigen Untersuchungsmethoden notwendig ist. Die beiden Erstautoren der Arbeit, Chaowei Shi und Pascal Fricke, setzten daher die relativ junge Festkörper-NMR ein, und das außerdem in einer neuen, am FMP entstanden Weiterentwicklung, die eine besonders hohe Auflösung ermöglicht. NMR steht für „Nuclear magnetic resonance“, auf Deutsch Kernspinresonanz. Diese beruht auf der Eigenschaft mancher Atomkerne, in einem starken äußeren Magnetfeld selbst zu kleinen Magneten zu werden. Anhand ihrer charakteristischen Resonanz mit Radiowellen kann man durch komplizierte Rechenverfahren die Lage der Atome innerhalb von Molekülen ermitteln. Das Besondere an der Festkörper-NMR besteht darin, dass die Probe im Magnetfeld sehr schnell rotiert, um die Bewegungen gelöster Moleküle zu simulieren.
Da man nun die exakte Form der Bactofilin-Bausteine und ihre chemischen Eigenschaften kennt, kann man nach kleinen Molekülen fahnden, die die Polymerisierung der Fasern stören. Auf diese Weise könnte man Wirkstoffe entwickeln, die spezifisch bestimmte Bakterien abtöten. Die Bactofilinfasern durchziehen dabei nicht nur das Innere von Helicobacter – im harmlosen Caulobacter crescentus bilden die Fasern sogar eng verwobene Matten aus. Diese Matten sind das Fundament für einen langen Stiel, mit dem die Bakterien sich an Oberflächen anheften oder Nahrung aufnehmen können.
„Alle Vorgänge in lebenden Organismen werden letztlich von Proteinen angetrieben, und um zu verstehen, wie sie funktionieren, müssen wir ihre Strukturen kennen“, sagt Adam Lange. Der Biophysiker gehört zu einem der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der Festkörper-NMR, möchte künftig aber die Kombination verschiedener Techniken vorantreiben. „Auch auf dem Gebiet der Kryoelektronenmikroskopie gab es in den letzten Jahren beeindruckende Durchbrüche, hier wollen wir Kooperationen bilden“, sagt Lange. „Will man Proteinstrukturen in all ihren Dimensionen und Details verstehen, darf nicht jeder Experte für sich allein arbeiten, vielmehr müssen wir die modernen machtvollen Techniken in gemeinsame Projekte integrieren.“
Quelle: Chaowei Shi*, Pascal Fricke*, Lin Lin, Veniamin Chevelkov, Melanie Wegstroth, Karin Giller, Stefan Becker, Martin Thanbichler, and Adam Lange: Atomic-resolution structure of cytoskeletal bactofilin by solid-state NMR. Science Advances, 04 Dec 2015, Vol. 1, no. 11, e1501087, DOI: 10.1126/sciadv.1501087
*gleichberechtigte Erstautoren\n
Abbildung:
Mit Hilfe von Bactofilin entwickeln Helicobacter-Bakterien (in blau) ihre typische Schraubenform, die es ihnen erlaubt in die Magenschleimhaut einzudringen. Dort können sie Entzündungen und Geschwüre auslösen. Die Strukturaufklärung von Bactofilin könnte einen Ansatzpunkt für die Entwicklung dringend benötigter neuer antibakterieller Substanzen darstellen. Bild: FMP/Barth van Rossum
\n
Über das Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP)
\nDas Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) gehört zum Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB), einem Zusammenschluss von acht natur-, lebens- und umweltwissenschaftlichen Instituten in Berlin. In ihnen arbeiten mehr als 1.900 Mitarbeiter. Die vielfach ausgezeichneten Einrichtungen sind Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft. Entstanden ist der Forschungsverbund 1992 in einer einzigartigen historischen Situation aus der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR.
forschen / 07.12.2015
Plötzlicher Herztod: Studie zu besserer Risikoeinschätzung
Der plötzliche Herztod kommt schnell und meist völlig unerwartet. Ihm gehen schwere Herzrhythmusstörungen voraus, dann folgt binnen weniger Minuten der Herzstillstand. Ursache für einen plötzlichen Herztod kann prinzipiell jede Erkrankung sein, die Herzrhythmusstörungen auslöst – beispielsweise Erkrankungen der Herzkranzgefäße, von denen meist Menschen mittleren Alters betroffen sind. Ein erhöhtes Risiko haben auch Patienten mit so genannter hypertropher Kardiomyopathie (HCM), einer genetisch bedingten Verdickung der Muskulatur der linken Herzkammer. „Bei einer HCM kann der Herzmuskel um mehr als das Vier- bis Fünffache verdickt sein, und die Muskulatur durch vernarbtes – so genanntes fibrotisches Gewebe – verändert sein“, erklärt Prof. Jeanette Schulz-Menger, Leiterin der Hochschulambulanz für Kardiologie am Experimental and Clinical Research Center (ECRC) des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) und der Charité – Universitätsmedizin Berlin und Leiterin der Arbeitsgruppe Kardio-MRT in Kooperation mit dem HELIOS Klinikum Berlin-Buch. „Das kann die Entstehung von Herzrhythmusstörungen begünstigen und das Risiko für einen plötzlichen Herztod erhöhen.“
Gefährdungspotenzial ist schwer abzuschätzen
HCM ist eine der häufigsten Ursachen für den plötzlichen Herztod bei jungen Menschen. Und die Erkrankung ist gar nicht so selten: Einer von 500 Menschen besitzt Erbanlagen für HCM. Aber nur rund zwei bis drei Prozent der Patienten erleiden wirklich einen plötzlichen Herztod. Dennoch besteht ein Risiko. „Die Risikoeinschätzung ist heute aber leider noch sehr schwierig. Denn das Gefährdungspotenzial lässt sich nicht ausschließlich am Grad der Verdickung des Herzmuskels messen“, sagt Schulz-Menger. „Auch HCM-Patienten ohne sichtbare Verdickung sind gefährdet. Es spielen zum Beispiel auch die Erbanlagen und weitere bislang noch unbekannte Faktoren eine Rolle.“
"Die bislang größte und wichtigste Studie zur hypertrophen Kardiomyopathie"
Welche das sind und wie sie genau zusammenspielen, soll nun eine großangelegte internationale Studie mit 2.750 HCM-Patienten klären. Mit Hilfe genetischer Tests, Blutuntersuchungen sowie moderner bildgebender Verfahren wie der Magnetresonanztomographie (MRT) wird nach aussagekräftigen Risikofaktoren gefahndet. Insgesamt sind 42 Forschungsstandorte aus den USA, Großbritannien, Kanada und Europa an der Studie beteiligt. Schulz-Menger übernimmt mit ihrem Team die Leitung der klinischen Prüfung für die an der Studie beteiligten deutschen Forschungseinrichtungen mit MRT-Expertise. Die so genannte HCMR-Studie (HCMR – Neue Prognosemarker bei Hypertropher Kardiomyopathie) wird durch die National Institutes of Health (NIH) finanziert. „Das ist die bislang größte und wichtigste Studie zur hypertrophen Kardiomyopathie, die die Therapie und Prognose von HCM-Patienten in Zukunft deutlich verbessern wird“, sagt Schulz-Menger. „Unser Ziel ist es, mit der Kombination verschiedenster Verfahren, Patienten mit hohem Risiko für den plötzlichen Herztod zu erkennen, um diese in Zukunft besser und beraten und behandeln zu können – und so das individuelle Risiko für plötzlichen Herztod zu minimieren.“
Es werden noch Studienteilnehmer gesucht
Patientinnen und Patienten im Alter zwischen 18 und 65 Jahren mit bestätigter hypertropher Kardiomyopathie (HCM) oder Verdacht auf HCM können sich noch bis April 2016 melden und an der Studie teilnehmen. Weitere Informationen zur Studienteilnahme und Ansprechpartner unter:
www.hochschulambulanz-charite-buch.de/hochschulambulanzen/kardiologie/hypertrophe-kardiomyopathie-hcm-hocm.html
\n
Abb.: Schnittbild des Herzens: Der dunkle Ring in der Bildmitte zeigt die Herzwand. Die linke Seite ist klar als verdickt zu erkennen. (Bild: Fritschi/ECR)
\n
heilen / 04.12.2015
Berliner HELIOS Ärzte als TOP-Mediziner ausgezeichnet
Im aktuellen Magazin „Kliniken Berlin 2016“ der Tageszeitung Tagesspiegel und der Gesundheitsstadt Berlin sind drei Fachbereiche der Berliner HELIOS Kliniken in Berlin-Buch und Berlin-Zehlendorf als beste Kliniken platziert. Rund 3.000 niedergelassene Ärzte beteiligten sich in diesem Jahr berlinweit an der Umfrage. Die Ergebnisse und Rankinglisten mit Experten verschiedener medizinischer Fachbereiche sind jetzt nachlesbar.
Die Klinik und Poliklinik für Kardiologie im HELIOS Klinikum Berlin-Buch unter der Leitung von Chefarzt Prof. Dr. med. Henning T. Baberg ist das von den niedergelassenen Ärzten Berlins für die Implantation eines Herzschrittmachers am häufigsten empfohlene Krankenhaus. Der erfahrene Experte Dr. med. Michael Wiedemann als Leiter des HELIOS Herz-Rhythmus-Zentrums Berlin/Brandenburg führt diesen Fachbereich seit sechs Jahren. Klinik und Poliklinik verfügen über sämtliche Möglichkeiten zur invasiven und nicht-invasiven Untersuchung mit modernster Medizintechnik, zum Beispiel zur Diagnostik und Therapie von Herzkranzgefäßerkrankungen, Herzmuskelerkrankungen, Erkrankungen peripherer Gefäße sowie von Herzrhythmusstörungen.\n
Prof. Dr. med. Marc Bloching, Chefarzt der Klinik für Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde im Bucher Klinikum, wurde in den Bereichen Diagnostik und Therapie von Mundhöhlen- und Rachenkrebs im Ranking ebenfalls mit dem 1. Platz ausgezeichnet. Schon seit Jahren nimmt die Behandlung von Tumorpatienten am Gesundheitsstandort Berlin-Buch einen besonderen Stellenwert ein. Mit der Zertifizierung zum Onkologischen Zentrum knüpft das HELIOS Klinikum Berlin-Buch an diese langjährige Tradition an. Die HNO-Klinik ist als HELIOS Hörzentrum Berlin-Brandenburg außerdem auf die konservative und operative Behandlung hörgeschädigter Patienten aller Altersgruppen spezialisiert.
\nChefarzt Prof. Dr. med. Torsten Bauer und sein Team der Pneumologen im HELIOS Klinikum Emil von Behring in Berlin-Zehlendorf belegen Platz 1 bei der Diagnostik und Therapie der chronischen Lungenkrankheit COPD. Die Klinik für Pneumologie, Lungenklinik Heckeshorn in Berlin-Zehlendorf, zählt europaweit zu den führenden Zentren für Lungenerkrankungen und ist auch auf die Therapie von COPD spezialisiert. Für eine wirkungsvolle Therapie arbeitet die Klinik fächerübergreifend mit Kardiologen, Thoraxchirurgen, Radiologen und Intensivmedizinern zusammen und bietet ein umfassendes Präventions-, Diagnostik, und Therapiespektrum.
„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnungen an den beiden Berliner Klinikstandorten durch die Empfehlung der Ärzte in den Niederlassungen“, sagt Regionalgeschäftsführer Mitte-Nord Enrico Jensch anlässlich der aktuellen Veröffentlichung.
Klinikkontakt:
HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Klinik und Poliklinik für Kardiologie und Nephrologie
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin
Chefarzt: Prof. Dr. med. Henning T. Baberg
Telefon: (030) 94 01–529 00
E-Mail: henning.baberg@helios-klniken.de
www.helios-kliniken.de/klinik/berlin-buch
HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin
Chefarzt: Prof. Dr. med. Marc Bloching
Telefon: (030) 94 01–541 00
E-Mail: marc.bloching@helios-klniken.de
www.helios-kliniken.de/klinik/berlin-buch
HELIOS Klinikum Emil von Behring
Klinik für Pneumologie, Lungenklinik Heckeshorn
Walterhöferstr. 11, 14165 Berlin
Chefarzt: Prof. Dr. med. Torsten Bauer
Telefon: (030) 81 02–27 76
E-Mail: pneumologie-berlin@helios-kliniken.de
www.helios-kliniken.de/klinik/berlin-zehlendorf
forschen, heilen / 02.12.2015
Tausendster MRT-Studienteilnehmer an NAKO in Berlin-Buch
Berlin hat außer dem Studienzentrum Berlin-Nord auf dem Campus Berlin-Buch noch zwei weitere Studienzentren auf dem Campus Charité-Mitte und auf dem Campus Charité Benjamin Franklin in Steglitz. Sie sollen zusammen 30 000 Studienteilnehmer rekrutieren, so der Sprecher aller drei Berliner Studienzentren, der Mediziner und Epidemiologe Prof. Tobias Pischon vom MDC. Von diesen 30 000 Berliner und Brandenburger Studienteilnehmer sollen 6 000 in dem Tomographen der Berlin Ultrahigh Field Facility des Studienzentrums Berlin-Nord eine Ganzkörper-MRT-Untersuchung erhalten.
Das Studienzentrum Berlin-Nord, das im Frühjahr 2014 seine Arbeit aufgenommen hat und das Prof. Pischon leitet, soll im Rahmen dieser Studie bis etwa 2018/2019 insgesamt 10 000 Studienteilnehmer untersuchen. Vor kurzem konnte es den zweitausendsten Studienteilnehmer begrüßen. Die drei Studienzentren in Berlin werden betrieben vom MDC (Studienzentrum Berlin-Nord), der Charité – Universitätsmedizin Berlin (Studienzentrum Berlin-Mitte) sowie dem Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) (Studienzentrum Berlin-Süd/Brandenburg).
Teilnahme an der Studie
An der Studie kann nur teilnehmen, wer ein Einladungsschreiben von einem der 18 NAKO-Studienzentren erhält. Die Auswahl der Angeschriebenen erfolgt nach dem Zufallsprinzip anhand von Adressen, die die Forscher von den Einwohnermeldeämtern bekommen haben. Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Die Untersuchungen können nur mit Einwilligung der Studienteilnehmer erfolgen, die ihre Teilnahme jederzeit wieder zurückziehen können.
Finanzierung und Hintergrund
Bundesweit sollen in der NAKO-Bevölkerungsstudie insgesamt 200 000 Teilnehmer im Alter von 20 bis 69 Jahren untersucht und nach ihren Lebensgewohnheiten befragt werden. Zusätzlich werden Blut-, Urin-, Stuhl- und Speichelproben gewonnen und für spätere Forschungsprojekte getrennt von den Personendaten unter einer Kennnummer (Pseudonym) gespeichert. Die Teilnehmer werden 20 bis 30 Jahre nachbeobachtet. Dabei werden eventuell auftretende Krankheiten erfasst und mit den Jahre zuvor erhobenen Daten verglichen, um so Risikofaktoren auf die Spur zu kommen.
Die Studie wird in den ersten zehn Jahren mit 210 Millionen Euro aus Mitteln des Bundesforschungsministeriums, der Länder und der Helmholtz-Gemeinschaft finanziert. Initiiert haben die NAKO die Helmholtz-Gemeinschaft, Universitäten, die Leibniz-Gemeinschaft sowie Einrichtungen der Ressortforschung.
\n
Weitere Informationen:
http://nationale-kohorte.de/
\n
Foto: Das NAKO MRT-Team begrüßt Michael Cygan, den tausendsten Studienteilnehmer im Studienzentrum Berlin-Nord in Buch. Von links: Prof. Thoralf Niendorf, Michael Cygan, Dr. Beate Endemann, Yvonne Balke, Michael Rohloff. (oto: Sabrina Klix/MDC)
\n
produzieren / 01.12.2015
Eckert & Ziegler verkauft sein US-Seedgeschäft
EZB hat 2013 von der amerikanischen Biocompatibles Inc. die Sparte mit der Veredelung von Prostatakrebsimplantaten sowie das Geschäft mit Applikationsnadeln übernommen. Biocompatibles hatte damals freiwillig die Auslieferung von Produkten eingestellt, weil die amerikanische Arzneimittelbehörde Mängel bei der Dokumentation des Herstellungsprozesses reklamiert hatte. Trotz Behebung sämtlicher Qualitätsmängel durch EZB ist es nicht gelungen, die Mehrzahl der Kunden zurückzugewinnen und das Geschäft in die Gewinnzone zu führen. Der jetzige Verkauf durch die EZB ist Bestandteil des Sanierungskurses, dem eine detaillierte, strategische Überprüfung aller Geschäftsfelder vorausging. Zugunsten höhermargiger Bereiche soll das US-Seedgeschäft abgegeben werden.
"Wir haben die beste Lösung für unser Unternehmen, unsere Kunden und unsere Aktionäre gefunden. Wir können uns nun bei den Prostataseeds stärker auf den europäischen Markt fokussieren und unsere Ressourcen für den US-Markt ganz auf das Afterloader-Geschäft konzentrieren“, erklärte Dr. Edgar Löffler, Vorstandsmitglied der Eckert & Ziegler AG und verantwortlich für das Segment Strahlentherapie. Mit dem Verkauf beschleunigt Eckert & Ziegler BEBIG seinen Transformationsprozess hin zu einem profitablen Spezialisten für die Brachytherapie, einer schonenden Form der Krebsbehandlung. Die Zulassung für den Vertrieb der neuesten Generation der Afterloader, des SagiNova®, wurde im April dieses Jahres erteilt. Mit dem Verkauf der ersten Geräte wird noch in diesem Jahr gerechnet.
“Mit der Übernahme setzen wir unser langjähriges Bekenntnis zur Prostata-Brachytherapie, zu den in diesem Bereich tätigen Ärzten und den betroffenen Patienten fort,“ erklärte Frank J. Tarallo, Vorstandsvorsitzender der Theragenics Corporation. „Wir werden zukünftig die US-amerikanischen Seed-Kunden von BEBIG mit unseren qualitativ einzigartigen Produkten beliefern. Als einer der führenden Hersteller und Anbieter in diesem Markt sind wir überzeugt, dass wir die US-amerikanischen Seed-Kunden von BEBIG darin unterstützen können, Prostatakrebspatienten weiterhin eine hervorragende Behandlungsform anzubieten.“
Über Eckert & Ziegler.
Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN DE0005659700), gehört mit rund 700 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin.
Wir helfen zu heilen.
Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:
Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations
Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de\n
heilen / 30.11.2015
HELIOS Klinikum Berlin-Buch führt Videodolmetschen ein
Insbesondere Notfallsituationen erfordern oftmals schnelles, bis in alle Details abgestimmtes Handeln. Um besser mit nicht-deutschsprachigen Patienten zu kommunizieren und die Sicherheit für die Patienten und Mitarbeiter zu erhöhen, hat das HELIOS Klinikum Berlin-Buch als erste Klinik in Berlin-Brandenburg das „Videodolmetschen“ eingeführt. Die Videodolmetscher unterstützen Patienten, Ärzte und Pflegekräfte in mehr als 15 verschiedenen Sprachen und einer Vielzahl von besonderen Dialekten. Knapp 500 Dolmetscher mit akademischem Abschluss stehen weltweit zur Verfügung und können bei Bedarf innerhalb von 120 Sekunden online zugeschaltet werden.
Patienten haben so die Möglichkeit, ihr Anliegen und ihre Beschwerden besser zu erklären. Die Mediziner können mittels Dolmetscher Fragen stellen, über Diagnosen, Abläufe und mögliche Therapien optimal informieren.
„Die schnelle Einsatzmöglichkeit des „Video-Dolmetschens“ erlaubt uns eine unmittelbare Verständigung mit nicht-deutschsprachigen Patienten. Denn im Notfall kann jede gewonnene Sekunde wertvoll sein, um Leben zu retten“, sagt Prof. Dr. med. Christian Wrede, Chefarzt des Notfallzentrums mit Rettungsstelle im HELIOS Klinikum Berlin-Buch, und weiter: „Es ist ein wichtiges Patientenrecht, im persönlichen Arzt-Patienten-Gespräch verständliche Informationen über die Diagnose und Behandlung zu erhalten.“
Susanne Richter, Stationsleiterin im Notfallzentrum, berichtet: „Die ersten Erfahrungen im Umgang mit dem neuen Videosystem haben uns gezeigt, wie überrascht und dankbar die Patienten sind, wenn sie sich mitteilen können und von uns verstanden fühlen. Das erleichtert uns die Kommunikation sehr.“
Die Pilotphase mit den Dolmetschern per Videozuschaltung ist jetzt im Notfallzentrum gestartet und soll ab Januar 2016 auch auf anderen Stationen im Bucher Klinikum genutzt werden.\n
\n
Bildunterschrift: Prof. Dr. med. Christian Wrede, Chefarzt des Notfallzentrums im HELIOS Klinikum Berlin-Buch, und Susanne Richter, Stationsleiterin im Notfallzentrum, im Patientengespräch mittels einem Videodolmetscher (Foto: HELIOS, Thomas Oberländer)
\n
leben, heilen / 26.11.2015
Herzwochen 2015: Gefäß- und Diabetessport – Bewegung hilft gegen Durchblutungsstörungen
Hauptursache für die arterielle Verschlusskrankheit ist die Gefäßverkalkung (Arteriosklerose). Dabei kommt es zu Ablagerungen von Blutfett- und Bindegewebsbestandteilen, Kalk und Blutgerinnseln an der Gefäßwand. Das Blutgefäß verengt sich und blockiert schließlich den Blutfluss. Dadurch gelangt nicht mehr genügend nähr- und sauerstoffreiches Blut zur Muskulatur des Beckens und der Beine. Folge sind Schmerzen, die beim Auftreten und Gehen zum Stehenbleiben zwingen.
Die Arteriosklerose kann auch bei Diabetikern auftreten, denn eine Störung im Zuckerstoffwechsel ist einer der größten Risikofaktoren für die Gefäßverkalkung. Unbehandelt schreitet die Erkrankung fort und führt letztlich zu sogenannten Ruheschmerzen. Entgegen einer weit verbreiteten Annahme ändert eine Bypass- Operation den Krankheitsverlauf nicht immer.
Das Beste, was Sie neben einer gezielten medizinischen Behandlung gegen die Erkrankung unternehmen können, ist regelmäßige Bewegung. Manche Diabetiker können allein durch eine Bewegungstherapie ihre Zuckerkrankheit behandeln. Nachgewiesen ist, dass diese mindestens genauso gut wie Medikamente wirkt.
Ein gezieltes Training bewirkt, dass die Muskulatur mit weniger Blut auskommt und wieder in der Lage ist, mehr zu leisten. Ein regelmäßiges Trainingsprogramm kann dazu führen, dass Sie im Alltag weniger Beeinträchtigung verspüren. Oftmals führt eine Kombination von medikamentösen, chirurgischen oder interventionsradiologischen Maßnahmen und einem aktiven Gehtraining zu einem optimaleren Ergebnis.
Sie senken durch die regelmäßige Bewegungstherapie auch Ihr Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko und tragen so dazu bei, Ihr Gewicht zu stabilisieren.
Um Ihnen die Umsetzung dieser Empfehlungen zu erleichtern, bietet das HELIOS Klinikum Berlin-Buch gemeinsam mit einem auf Rehabilitationssport spezialisierten Sportverein eine Gefäß- und Diabetessportgruppe an. Zur aktiven Teilnahme jeden Dienstag ab 15 Uhr im Haus 206 in den Übungsräumen der Physiotherapie laden wir Sie herzlich ein. Alle Kassen zahlen anteilig bei Verordnung des Rehasports durch den Haus- oder Facharzt.
\n
Hintergrundinformation:
Das HELIOS Klinikum Berlin-Buch bietet diese Gefäß- und Diabetessportgruppe in Kooperation mit der Spok GmbH an, die in Berlin-Buch im Krankenhaus bzw. auf dem Krankenhausgelände trainiert. Die Spok GmbH ist Mitglied des Berliner Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes, dem Dachverband für Rehabilitationssport. Lizenzierte Trainer mit spezieller Ausbildung leiten Sie gezielt an.
\n
Foto: Ehepaar beim Walking, Gefäßsport (Foto: HELIOS Kliniken/Thomas Oberländer)
\n
forschen / 26.11.2015
Genetische Ursache für Gaumenspalte
Demnach spielt ein Protein namens GSKIP eine entscheidende Rolle in der Embryonalentwicklung: Nachdem die Forscherinnen und Forscher das Gen für GSKIP in Mäusen stillgelegt hatten, entwickelten alle diese „Knock-out-Mäuse“ eine Kiefer-Gaumenspalte und schwerwiegende Atemwegsprobleme. „Das ist das erste Mal, dass diesem Protein eine Funktion im lebenden Organismus zugeordnet werden konnte“, sagt Enno Klußmann vom MDC. Er leitete die Studie von Veronika Anita Deák aus seiner Arbeitsgruppe. Die Arbeit ist in der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift Journal of Biological Chemistry erschienen.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzten für ihre Studie das so genannte konditionale Knock-out-Verfahren, bei dem Gene mit einer Art biologischem Schalter (Cre/lox) versehen werden, der sie stilllegt. Nachdem sie auf diese Weise die Funktion des Proteins GSKIP bei Mäusen aufgeklärt hatten, verglichen die Forscherinnen und Forscher die dafür zuständigen Gene bei Mäusen und Menschen. Sie fanden eine hohe Übereinstimmung mit Menschen, die am Goldenhar-Syndrom leiden. Während allerdings die Knock-out-Mäuse wegen der Atemwegsprobleme alle nicht lebensfähig waren, gibt es bei Menschen, die mit Kiefer-Gaumenspalte zur Welt kommen, weniger schwere Verläufe. Die Deformation lässt sich operieren und die Atemprobleme sind beherrschbar.
Quelle: Veronika Anita Deák et al.: The A-kinase anchoring protein GSKIP regulates GSK3β activity and controls palatal shelf fusion in mice (Journal of Biological Chemistry)
Link zur Studie:
http://www.jbc.org/content/early/2015/11/18/jbc.M115.701177.full.pdf \n
forschen / 26.11.2015
Einblicke in die „dunkle Zone“: Neue Erkenntnisse zur Differenzierung und malignen Entartung von B-Lymphozyten
„Unser Hauptaugenmerk galt dem Transkriptionsfaktor FOXO1“, berichtet die Medizinerin und Wissenschaftlerin Sandrine Sander. Mit ihren Kollegen untersuchte das Team, welchen Einfluss FOXO1 auf die B-Zellen im Keimzentrum hat. „FOXO1 ist ein neues Schlüsselelement für die Ausbildung der dunklen Zone und dadurch maßgeblich an einer wirksamen Abwehr von Krankheitserregern beteiligt“, betonen Dr. Sander und Prof. Rajewsky. Die Ergebnisse werden im Dezember im Fachjournal „Immunity“ veröffentlicht und stehen bereits jetzt online zur Verfügung.
Die Vorgänge in der Keimzentrumsreaktion sind für die biomedizinische Grundlagenforschung interessant, weil sie direkten Einfluss auf unsere Immunabwehr haben und fehlerhafte Prozesse innerhalb der Keimzentrumsreaktion zu einer Entartung der B-Zellen führen können. Um ein besseres Verständnis für die krankhaften Vorgänge in der Tumorentstehung zu erhalten, haben die Berliner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem ersten Schritt die gesunde Keimzentrumsreaktion in genetisch veränderten Mausstämmen untersucht. Diese Tiere erlaubten eine gezielte Beeinflussung der FOXO1-Aktivität in Keimzentrums-B-Zellen.
Den neuen Erkenntnissen zufolge ist FOXO1 nicht nur für die Ausbildung der „dunklen Zone“ erforderlich, sondern auch zum Wiedereintritt von B-Zellen der hellen Zone in die dunkle Zone. Dieser koordinierte Wechsel von B-Zellen zwischen den Zonen ist entscheidend für eine wirksame Auslese der funktionstüchtigsten Keimzentrums-B-Zellen. In FOXO1-defizienten Tieren ist dieser Prozess gestört.
Bestätigt wurden diese Ergebnisse von einer unabhängigen Studie aus der Arbeitsgruppe von Riccardo Dalla-Favera an der Columbia University in New York, die zeitgleich in „Immunity“ erscheint.
Wie FOXO1 und dessen Aktivität mit der Krebsentstehung zusammenhängen, ist damit allerdings noch nicht geklärt. Fest steht nur, dass dieser Transkriptionsfaktor eine wichtige Rolle in der normalen Keimzentrumsreaktion spielt und sich weitere Untersuchungen lohnen, da die meisten B-Zell-Lymphome aus Keimzentrums-B-Zellen hervorgehen. In Lymphompatienten sind außerdem aktivierende Mutationen von FOXO1 nachgewiesen worden, die auf dessen klinische Relevanz hinweisen.
Quelle: Sandrine Sander, Van Trung Chu, Tomoharu Yasuda, Andrew Franklin, Robin Graf, Dinis Pedro Calado, Shuang Li, Koshi Imami, Matthias Selbach, Michela Di Virgilio, Lars Bullinger, Klaus Rajewsky: PI3 Kinase and FOXO1 Transcription Factor Activity Differentially Control B Cells in the Germinal Center Light and Dark Zones, in: Immunity 43, 1-12 (15. Dezember 2015)
doi:10.1016/j.immuni.2015.10.021
Link zur Studie: http://www.cell.com/immunity/abstract/S1074-7613(15)00446-X \n
Abb.: Normale Keimzentrumsreaktion in der Milz von Kontrolltieren (links): B-Zellen, die durch Antigen-Kontakt zu Keimzentrums- B-Zellen (rot) differenzieren, werden von naiven B-Zellen (grün) umringt. Innerhalb des Keimzentrums bildet sich eine helle Zone, die sich durch ein Netzwerk von Antigen-präsentierenden Zellen (blau) von der dunklen Zone abgrenzt. Gestörte Keimzentrumsreaktion in Abwesenheit des Transkriptionsfaktors FOXO1 (rechts): In FOXO1-defizienten Tieren ("ohne FOXO1") ist ein Verlust der dunklen Zone zu beobachten und Antigen-präsentierende Zellen (blau) verteilen sich über das gesamte Keimzentrum.
forschen / 24.11.2015
Rolf Zettl wird neues Vorstandsmitglied des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung // Administrativer Vorstand
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
Gemeinsame Presseinformation des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung|Berlin Institute of Health (BIH) und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft
Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung/Berlin Institute of Health (BIH) bekommt mit Dr. Rolf Zettl ein weiteres hauptamtliches Mitglied im Vorstand. Rolf Zettl wird am 1. März 2016 die Position des Administrativen Vorstands übernehmen. Bisher ist Zettl Geschäftsführer der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V.
Der Administrative Vorstand ist für den gesamten kaufmännischen und administrativen Geschäftsbereich des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung zuständig, ist Beauftragter für den Haushalt und trägt gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern die Verantwortung für die Leitung des Instituts. Er wurde für eine Dauer von zunächst fünf Jahren vom Aufsichtsrat des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung bestellt.
„Mit Rolf Zettl gewinnt das Berliner Institut für Gesundheitsforschung einen erfahrenen Forschungsmanager. Er ist ein Garant dafür, dass im Berliner Institut für Gesundheitsforschung eine wichtige Schnittstelle zwischen medizinischer Forschung und Entwicklung entstehen wird“, sagt Dr. Georg Schütte, Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung und Vorsitzender des Gründungsaufsichtsrats des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung. Rolf Zettl ist promovierter Biologe und war in den vergangenen 20 Jahren u. a. in leitenden Management¬funktionen für die Max-Planck-Gesellschaft, die Charité - Universitätsmedizin Berlin sowie die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. tätig. Darüber hinaus verfügt er über langjährige Erfahrungen als Biotech-Entrepreneur.
„Mit den zwei neuen Vorstandsmitgliedern Erwin Böttinger und Rolf Zettl ist das Berliner Institut für Gesundheitsforschung exzellent aufgestellt, die erfolgreiche Aufbauarbeit in einer innovativen Wissenschaftseinrichtung in Berlin fortzuführen“, sagt Sandra Scheeres, Wissenschaftssenatorin des Landes Berlin. Eine zentrale Aufgabe Rolf Zettls in den kommenden Jahren wird sein, neue Impulse für die Innovationsstärke des Berliner Instituts für Gesundheits¬forschung zu setzen, insbesondere in den Bereichen Technologietransfer und Kommerzialisierung der Forschungsergebnisse. Erwin Böttinger, Vorsitzender des Vorstands des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung, betont: „Gerade für eine Einrichtung, die sich den raschen Transfer der Forschungsergebnisse in die medizinische Anwendung zur Aufgabe gemacht hat, ist es entscheidend, eine unternehmerisch denkende und mit Wirtschaft und Venture Capital gut vernetzte Persönlichkeit für die Aufgaben des Administrativen Vorstands zu gewinnen. Der gesamte Vorstand freut sich, dass der Aufsichtsrat Dr. Rolf Zettl für das Berliner Institut für Gesundheitsforschung gewinnen konnte, und auf die gemeinsame Arbeit.“
Rolf Zettl hat sich zum Ziel gesetzt, das Berliner Institut für Gesundheitsforschung vor allem bei dem Transfer neuer Erkenntnisse in die medizinische Anwendung voranzubringen: „Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung ist eines der ambitioniertesten Projekte im Bereich der Lebenswissen¬schaften überhaupt, national wie auch international. Um nachhaltig zum Wohle der Gesellschaft beizutragen, wird es insbesondere wichtig sein, gezielt Projekte voranzutreiben, die es ermöglichen, schneller Innovationen beispielsweise von Medikamenten oder medizinischen Hilfsgeräten auf den Markt zu bringen.“
Foto: Dr. Ralf Zettl, Geschäftsführer der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V., wird zum 1. März 2016 die Position des Administrativen Vorstands des BIH übernehmen (Foto: Helmholtz/Aussenhofer)
Über das Berliner Institut für Gesundheitsforschung/Berlin Institute of Health (BIH)
Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung/Berlin Institute of Health (BIH) wurde 2013 gegründet. Es ist ein Zusammenschluss der Charité - Universitätsmedizin Berlin und des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) mit dem Ziel, translationale Medizin basierend auf einem systemmedizinischen Ansatz und durch die beschleunigte Übertragung von Forschungserkenntnissen in die Klinik sowie die Rückkoppelung klinischer Befunde in die Grundlagenforschung voranzubringen. Seit April 2015 ist das Berliner Institut für Gesundheitsforschungselbstständige Körperschaft des öffentlichen Rechts, Charité und MDC sind darin eigenständige Gliedkörperschaften. Das Institut wird mit neuen wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen in der Biomedizin neue diagnostische, therapeutische und präventive Ansätze in der Medizin und damit für die Gesundheit der Menschen schaffen.
leben / 24.11.2015
Sporthalle in Karow als neue Notunterkunft für Flüchtlinge
Die Sicherstellung der Sporthalle läuft bis zum 31. März 2016. Sie erfolgte auf der Grundlage des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG), nachdem am Dienstag, dem 17. November 2015, der Pankower Bürgermeister, Matthias Köhne (SPD), seine Zustimmung zur vom Senator für Gesundheit und Soziales vorgesehenen Nutzung der Sporthalle im Karower Bedeweg verweigert hatte.
Betreiber der Unterkunft ist Social Support Berlin, Ansprechpartner ist Herr Schmidt (Tel.: 0151 41856514, Mail: ceoway@ms.ceoway.de).
Die ersten Unterstützer/innen der einzurichtenden Notunterkunft haben sich bereits organisiert und ihre Hilfe angeboten. Das Bezirksamt dankt allen Ehrenamtlichen, die sich auch in Karow unermüdlich für die geflüchteten Menschen engagieren. Großer Dank gilt ebenso dem Sportverein Karower Dachse, der trotz des schmerzlichen Verlustes seiner Sportstätte klar Position für die Flüchtlinge bezogen hat.
Der für die Unterbringung von Flüchtlingen zuständige Senator für Gesundheit und Soziales hatte von den Bezirken letzte Woche im Rat der Bürgermeister gefordert, insgesamt 48 weitere Sporthallen als Notunterkünfte zu benennen. Im Bezirk Pankow stehen bereits fünf Sporthallen dem Schul- und Vereinssport nicht mehr zur Verfügung. „Wenn fast 80 Sporthallen bis auf Weiteres nicht mehr für den Schul- und Vereinssport genutzt werden können, gefährdet dies zunehmend den sozialen Frieden in der Stadt. Für die bevorstehende Auflösung der Flüchtlingsunterkunft in der Messehalle 26 müssen mindestens fünf Sporthallen zur Verfügung gestellt werden. Das ist der falsche Weg. Vielmehr müsse darüber nachgedacht werden, weitere Messehallen als Notunterkünfte für Flüchtlinge herzurichten“, erklärt Pankows Bezirksbürgermeister, Matthias Köhne.
leben, erkunden, bilden / 19.11.2015
Neue Plattform an der Moorlinse: Vogelkieker haben nun gute Sicht
Tolle Vögel – bisher schlechte Sicht
Die NABU Bezirksgruppe - Pankow hatte sich bereits seit längerer Zeit für die Errichtung einer Beobachtungskanzel an der Moorlinse eingesetzt. Auf Initiative des Forstamtes Pankow wurde mithilfe von Fördermitteln aus dem UEP nun eine Beobachtungsplattform aufgestellt. Der relativ geringe Höhenunterschied reicht bereits aus, um gute Einblicke sowohl in die Uferrandbereiche als auch auf die offenen Wasserflächen zu ermöglichen. Durch den Einbau von Bodenplatten ist auch das problemlose Aufstellen von Spektiven zur Naturbeobachtung möglich.
Flora und Fauna auf der Infotafel
Das Forstamt Pankow stellte der NABU Bezirksgruppe - Pankow für eine Informationstafel einen fest verankerten, witterungsbeständigen Ständer zur Verfügung. Auf der Infotafel sind unter anderem Hinweise zur Geologie, zu Maßnahmen des Wasserrückhaltes sowie Portraits einiger Amphibien- und Reptilienarten zu finden. Interessierte Naturbeobachter werden damit auch auf die versteckteren Arten und Lebensräume der Moorlinse aufmerksam gemacht. Katrin Koch, Leiterin der NABU Bezirksgruppe - Pankow betonte, dass „die früheren Rieselfelder jetzt zu einem der erfolgreichsten Naturschutzgebiete Deutschlands“ geworden sind. Gegenüber den Besuchern und dem anwesenden Umweltstaatssekretär Christian Gaebler betonte sie noch einmal, dass sich der NABU Berlin für den Erhalt dieses Lebensraumes einsetzt, für dessen unmittelbares Umfeld eine Bebauung geplant ist.
Hintergrund zur Moorlinse Buch
Die Moorlinse Buch liegt im Landschaftsschutzgebiet Buch im Norden Berlins an der Grenze zu Brandenburg. Das kleine Gewässer und die angrenzenden ehemaligen Rieselfelder beherbergen viele Brutvogelarten und sind im Herbst Lebensraum von Wildgänsen und Kranichen. Mit dem Projekt „Wiedervernässung der ehemaligen Rieselfelder um Hobrechtsfelde" wurden bereits erhebliche Anstrengungen unternommen, den Wasserhaushalt im wasserarmen Norden Berlins zu stabilisieren. Mehrere Feuchtgebiete, wie die Lietzengrabenniederung, die Bogenseekette, Bruchwaldbereiche im Bucher Forst und die Karower Teiche profitieren davon. Die Moorlinse - ein zur Pankeniederung gehörendes Niedermoor - hat sich durch hydrologische Veränderungen (Abflussverzögerungen, Einstellung der Trinkwasserförderung in Buch) zu einer offenen Wasserfläche entwickelt und besticht mit einer besonders imposanten Artenvielfalt und recht komfortablen Beobachtungsmöglichkeiten für Vogelfreunde.\n
\n
Foto (Ausschnitt): Nasse Füße oder umständliches Klettern sind nicht mehr nötig: Die neue Plattform gewährt einen guten Überblick über die Moorlinse. Ferngläser sind jedoch ratsam. (Foto: Jutta Gehring)
\n
heilen / 17.11.2015
Herzwochen 2015: Herz in Gefahr – koronare Herzkrankheit und Herzinfarkt
- \n
- HELIOS Klinikum Berlin-Buch beteiligt sich auch in diesem Jahr an bundesweiter Aktion der Deutschen Herzstiftung \n
- Herzspezialisten informieren am 24. November 2015 ab 18 Uhr zum Volksleiden koronare Herzkrankheit \n
- Vorsorge, Ursachen und modernen Therapien stehen im Mittelpunkt \n
- Deutsche Herzstiftung mit Informationsstand vor Ort \n
Anlässlich der bundesweiten Herzwochen 2015 der Deutschen Herzstiftung lädt die Klinik und Poliklinik für Kardiologie und Nephrologie im HELIOS Klinikum Berlin-Buch am Dienstag, 24. November, um 18 Uhr alle Interessierte herzlich zum Chefarztvortrag ins Foyer ein. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.
Plötzliche Schmerzen hinter dem Brustbein, Engegefühl und Atemnot – oft erste Anzeichen eines lebensbedrohlichen Herzinfarktes. Ursache ist meist ein Herzkranzgefäß, welches durch einen Blutpfropfen verengt wird, so dass der Herzmuskel nicht mehr genügend Sauerstoff erhält. Die Engstelle in den feinen Herzkranzgefäßen muss schnellstmöglich gefunden und wieder geöffnet werden.
Die koronare Herzkrankheit (KHK) ist die Vorläuferkrankheit des Herzinfarkts und die häufigste Herzerkrankung mit Millionen Betroffenen in Deutschland. Laut der deutschen Herzstiftung e.V. sterben jährlich über 128.000 Menschen an der KHK, darunter mehr als 55.000 am Herzinfarkt. „Viele der lebensbedrohlichen Verläufe ließen sich durch rechtzeitige Erkennung und Behandlung vermeiden“, erläutert Prof. Dr. med. Henning T. Baberg, Chefarzt Klinik und Poliklinik für Kardiologie und Nephrologie und Ärztlicher Direktor im HELIOS Klinikum Berlin-Buch.
Die KHK entsteht dadurch, dass sich Herzkranzgefäße durch Schädigungen an der Gefäßinnenhaut (Arteriosklerose) – z.B. durch Rauchen und Bluthochdruck – in einem langen schleichenden Prozess immer mehr verengen, so dass die Durchblutung des Herzens behindert wird. In den letzten 20 Jahren haben sich enorme medizinische und medizintechnische Fortschritte auf dem Gebiet der Behandlung von Durchblutungsstörungen ergeben. Die Lebenserwartungen und die Lebensqualität von Patienten mit solchen Erkrankungen sind sehr gestiegen.
Trotz all dieser Fortschritte bleiben offene Fragen: Bei welchen Anzeichen im Herzbereich oder Brustkorb sollte man sofort an einen Herzinfarkt denken und ohne Zeitverlust den Notarzt rufen bzw. rufen lassen? Wissen Sie, worauf man als Betroffener bei einer koronaren Herzerkrankung bzw. nach einem Herzinfarkt besonders achten soll?
„Ein erstes Warnsignal ist ein Schmerz im Brustkorb unter körperlicher Anstrengung, der schnell verschwindet, wenn die Belastung aufhört. Diesen Brustschmerz sollte man unbedingt ernst nehmen und sich umgehend einem Arzt vorstellen, denn mit einer rechtzeitigen Behandlung kann verhindert werden, dass es zu einem lebensbedrohlichen Herzinfarkt kommt“, betont der Chefarzt.
Ziel seines Vortrages ist es, darüber aufzuklären, wie die koronare Herzkrankheit entsteht und mit welchen Beschwerden und Warnzeichen sie sich bemerkbar macht. Außerdem werden neue Entwicklungen in Diagnostik und Therapie der Kardiologie aufgezeigt.
Im Anschluss an den Vortrag steht der Herzexperte für individuelle Fragen zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenfrei und eine Anmeldung nicht erforderlich.
leben, bilden / 13.11.2015
Schülerinitiative für die Integrationsklasse der Hufelandschule
Unter Anleitung von Diplombiologin Claudia Jacob lernen die Schüler, wieviel Zucker in manchen Säften, Müslis und Joghurts steckt, wieviel Kalorien durch verschiedene Sportarten verbrannt werden und was sich hinter der Ernährungspyramide verbirgt. Besonders viel Spaß haben alle beim Nachweis von Stärke mit Kaliumiodid oder Vitamin C mit Kaliumpermanganat. Ganz nebenbei lernen die Kinder viele neue deutsche Wörter und verbringen einen besonderen Tag außerhalb des Klassenzimmers.
\nDas Gläserne Labor und die Hufelandschule bedanken sich ganz herzlich bei der Delbrück’schen Familienstiftung, die die Durchführung von Schülerkursen und Ferientagen für Flüchtlingskinder und andere sozial benachteiligte Schüler großzügig fördert.
forschen / 10.11.2015
Neurodermitis-Gene beeinflussen auch andere Allergien
Für ihre Meta-Analyse untersuchten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Fälle, in denen auf frühkindliche Neurodermitis Asthma folgte. Insgesamt nahmen sie 12 Studien unter die Lupe mit 2.428 Krankheitsfällen und 17.034 gesunden Personen. Alle diese Studien waren genomweite Assoziationsstudien (GWAS) und enthielten Millionen von vererbbaren bzw. ererbten genetischen Varianten, so genannten Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs).
Es handelt sich um die erste GWAS des atopischen Marsches. Erstmals wurde gezeigt, dass es spezifische Genregionen gibt, die das Risiko für diesen ungünstigen Krankheitsverlauf beeinflussen. „Aus ärztlicher Sicht besonders interessant ist die prominente Rolle der Ekzemgene bei der späteren Asthmaentwicklung“, sagt Young-Ae Lee. Die Kinderärztin leitet am MDC eine Forschungsgruppe und ist zugleich Leiterin der Hochschulambulanz für Pädiatrische Allergologie und Neurodermitis am Campus Berlin-Buch. „Diese Entdeckung legt nahe, dass die Prävention oder die konsequente Behandlung der frühkindlichen Neurodermitis möglicherweise das Fortschreiten des atopischen Marsches hin zum Asthma unterbrechen kann“, sagt die Wissenschaftlerin.
Quelle: Ingo Marenholz et al.: “Meta-analysis identifies seven susceptibility loci involved in the atopic march“ (NATURE COMMUNICATIONS; DOI: 10.1038/ncomms9804)\n
Link zur Studie:
\n05.11.2015
Eckert & Ziegler: Erfolgreiche Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2015. Moderates drittes Quartal.
Das Segment Isotope Products profitierte am stärksten vom schwächeren Euro und verzeichnete zudem einen Akquisitionseffekt. Organisch gingen die Umsätze jedoch aufgrund schwacher Verkäufe im Energiesektor und bei Radiokarbondatierungen um 2,8 Mio. Euro zurück. Innerhalb des nach wie vor sehr erfolgreichen Segments lassen sich zwei defizitäre Bereiche identifizieren: das in 2014 akquirierte Brasilien-Geschäft und die Radiokarbondatierung. Hierdurch ging das EBIT des gesamten Segments um 2,8 Mio. Euro auf 9,6 Mio. Euro zurück.
Im Segment Strahlentherapie stiegen die Umsätze um 2,0 Mio. Euro auf 21,5 Mio. Euro. Erfreulich ist das darin enthaltene organische Umsatzwachstum im Bereich der Afterloader nach der Einführung des neuen Tumorbestrahlungsgerätes SagiNova®. Das EBIT ging um 0,5 Mio. Euro auf -2,9 Mio. Euro zurück. Darin sind jedoch bereits Rückstellungen in Höhe von 1,3 Mio. EUR für Restrukturierungsmaßnahmen und Standortzusammenlegungen enthalten.
Das Segment Radiopharma wuchs beim Umsatz über den Währungseffekt hinaus auch organisch, insbesondere in der Gerätesparte und bei den Gallium-Generatoren. Das Segment enthält den Großteil des Verkaufserlöses der OctreoPharm-Beteiligung. Hierdurch stieg das EBIT um ein Vielfaches auf 8,7 Mio. Euro.
Das Segment Sonstige steigerte den Umsatz aufgrund von Preiserhöhungen um 0,6 Mio. Euro auf 5,4 Mio. Euro. Das EBIT verbesserte sich deutlich um 1,0 Mio. Euro auf -1,6 Mio. Euro.
Aus dem Abbau des Nettoumlaufvermögens resultiert ein positiver Kapitalfluss von 2,2 Mio. Euro. Wesentlicher Effekt ist hier der Abbau der Forderungen gegenüber Kunden im Segment Strahlentherapie. Der Verkauf der OctreoPharm-Beteiligung führte zu einem Zahlungsmittelzufluss von 5,4 Mio. Euro.
Für das Jahr 2015 wird ein Umsatzanstieg auf über 133 Mio. Euro erwartet und eine Ergebnisverbesserung auf über 2,00 EUR/Aktie angestrebt. Für das Jahr 2016 wird unter der Annahme konstanter Wechselkurse ein leichter Umsatzanstieg auf einen Wert zwischen 137 und 140 Mio. Euro erwartet. Der Gewinn pro Aktie geht im Jahr 2016 voraussichtlich aufgrund wegfallender positiver Sondereffekte auf ca. 1,80 Euro/Aktie zurück.
Den vollständigen Quartalsbericht finden Sie hier:
www.ezag.com/fileadmin/ezag/user-uploads/pdf/financial-reports/deutsch/euz315d.pdf\n
Über Eckert & Ziegler.
Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN DE0005659700), gehört mit rund 700 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin.
Wir helfen zu heilen.
Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:
Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations
Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de
heilen / 05.11.2015
Einladung zum Weltdiabetestag: Aktion im HELIOS Klinikum Berlin-Buch
- \n
- Aktion „Diabetes – Stopp – jetzt“ am 10. November 2015 von 11 bis 15 Uhr im Foyer des HELIOS Klinikums Berlin-Buch \n
- Ermitteln Sie Ihr Diabetes-Risiko! \n
- Bucher Klinikum wurde 2015 von der Deutschen Diabetes Gesellschaft zertifiziert \n
Allein in Deutschland sind fast 8 Millionen Menschen vom Diabetes betroffen. Gründe dafür können eine genetische Veranlagung oder ein Gendefekt, aber auch falsche Ernährung, Übergewicht und Bewegungsmangel sein.
Diabetes beeinflusst das Leben von Betroffenen in vielen Bereichen, ob bei der Ernährung, beim Sport oder bei Reisen. Auch die Angst vor Folgeerkrankungen spielt im Alltag eine Rolle.
Fortschritte in Diagnostik und Therapie der Zuckerkrankheit (Diabetes) dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein „Diabetes-Tsunami“ auf uns zurollt. Rund zehn Prozent der Bevölkerung sind bereits betroffen, 40 bis 50 Prozent gefährdet. Am Anfang tut die Erkrankung nicht weh und ist kaum zu spüren, obwohl fast alle Organsysteme von einer Zuckerkrankheit betroffen sein können.
Anlässlich des Weltdiabetestages findet am Dienstag, den 10. November 2015 von 11 bis 15 Uhr im Foyer des HELIOS Klinikums Berlin-Buch, Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin eine Aktion zum Thema „Diabetes – Stopp – jetzt“ statt. Prof. Dr. med. Michael Ritter, Leiter des Bereiches Diabetologie und Endokrinologie, und sein Team informieren über Ursachen, Risiken, Vorbeugung und Behandlungsmöglichkeiten.
Jährlich werden bundesweit zirka zwei Millionen Diabetespatienten in Kliniken behandelt. Bei einem Klinikaufenthalt ist es von größter Bedeutung, bei jedem Patienten die Erkrankungsvorgeschichte, Grunderkrankungen und auch Allergien zu erfassen. An Diabetes erkrankte Patienten, die sich operativ behandeln lassen müssen, benötigen eine besonders auf sie abgestimmte medizinische und pflegerische Betreuung. Dazu gehört beispielsweise, dass der Blutzuckerspiegel bedarfsgerecht überwacht wird, und dass die Narkose entsprechend der Diabeteserkrankung abgestimmt ist.
Im HELIOS Klinikum Berlin-Buch wird auf allen Stationen speziell für Diabetes ausgebildetes Pflegepersonal vorgehalten, um jeden aufgenommenen Patienten auf Diabetes zu untersuchen, alle Diabetiker hinsichtlich möglicher Komplikationen zu erfassen und entsprechend betreuen zu können.
Als deutschlandweit erstes Krankenhaus der Maximalversorgung erhielt das Bucher Klinikum im Juni das Zertifikat der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG), mit dem es als „ein für Diabetiker geeignetes Krankenhaus“ ausgezeichnet wurde.
leben, heilen, bilden / 04.11.2015
Neu im Netz: Lungenblog der Evangelischen Lungenklinik Berlin
Mit dem Lungenblog bietet die Evangelische Lungenklinik Berlin eine Plattform für den fachlichen Austausch.
Kommentare, Anregungen oder Beiträge sind willkommen: http://lungenblog.pgdiakonie.de/
\n\n
Foto: Gebäude der Evangelische Lungenklinik Berlin auf dem historischen Klinik-Campus in Berlin-Buch (Foto: Christine Minkewitz, BBB Management GmbH)
heilen / 04.11.2015
Chefärztin der Klinik für Thoraxchirurgie wird Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie
Dr. Leschber war in den vergangenen zwei Jahren in der Funktion als Vizepräsidentin der DGT tätig und ist seit 2005 im Präsidium der DGT vertreten. Für die Führung der Fachgesellschaft mit gut 500 Mitgliedern ist sie unter anderem dadurch qualifiziert, dass sie bereits 2010/2011 als Präsidentin der Europäischen Gesellschaft für Thoraxchirurgie (ESTS) vorstand, der größten internationalen wissenschaftlichen Vereinigung von Thoraxchirurgen.
Ihr Engagement hat dazu geführt, dass die Zahl der Mitglieder dieser Fachgesellschaft deutlich anstieg und die Öffnung und der medizinische Austausch mit Japan und Asien erheblich vorangetrieben wurden. Durch ihre internationale Arbeit und ihre Kontakte genießt sie weltweites Ansehen. So konnte sie bei der von ihr geleiteten Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie Ende September 2015 in Berlin auch eine Vielzahl internationaler Redner für Vorträge gewinnen. Nicht zuletzt trug dies zum großen Erfolg des Kongresses bei.
Die Klinik für Thoraxchirurgie, deren Schwerpunkt auf minimalinvasiven Operationstechniken (Schlüsselloch-Chirurgie) und der Behandlung maligner Erkrankungen (Lungenkarzinom und Lungenmetastasen) liegt, erfährt dadurch eine weitere Steigerung ihres Renommees.
Dr. Gunda Leschber setzt sich darüber hinaus bereits seit vielen Jahren für die Förderung von Frauen in der Chirurgie ein. Sie war über fünf Jahre als Vertreterin der Chirurginnen im Präsidium des Berufsverbandes der Deutschen Chirurgen (BDC) tätig und wurde 2015 in den Ehrenrat des BDC gewählt
\n
Über die Evangelische Lungenklinik Berlin
\n
Die Evangelische Lungenklinik Berlin, ein Unternehmen der Paul Gerhardt Diakonie, ist seit ihrer Gründung im Jahr 1952 eine weithin anerkannte Spezialklinik für akute und chronische Erkrankungen der Lunge sowie des Brustkorbs und seiner Organe. Die Klinik auf einem der historischen Krankenhauskomplexe in Buch im Berliner Nordosten ist Mitbegründerin des Tumorzentrums Berlin-Buch (Mitglied im Tumorzentrum Berlin e.V.) und Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Unsere Pneumologen, Thoraxchirurgen, Anästhesisten, Intensivmediziner und Radiologen behandeln mehr als 7.000 stationäre Patienten jährlich.
investieren, leben / 04.11.2015
EWG Berlin-Pankow eG saniert in Berlin-Buch
Im ersten Schritt erfolgte der Anschluss der Gebäude an das Fernwärmenetz. Damit entfielen in den Wohnungen die Thermen der Gasetagenheizungen sowie die Gasaußenwandheizer. Einige Wohnungen wurden bis zum Baubeginn sogar noch mit Kachelöfen beheizt. Im Zuge der Baumaßnahme wurden diese abgerissen.
Die Fassaden dieser Häuser wurden mit einem Wärmedämmverbundsystem verkleidet und farbig gestaltet, die Treppenhäuser erfreuen mit einem frischen Anstrich und der Terrazzo-Belag wurde aufgearbeitet. Die Hauseingangstüren sind bereits zu einem früheren Zeitpunkt erneuert worden. Die Hauszugänge werden ebenfalls neu gepflastert, dazu werden die Wege erneuert, Fahrradabstellplätze errichtet und die verbleibende Freifläche auf der Balkonseite wird ebenfalls neu gestaltet.
Da nur wenige Wohnungen über einen Balkon verfügten, wurden der Abriss der Bestandsbalkone und die Errichtung einer komplett neuen Balkonanlage festgelegt. Nach Abschluss der Arbeiten wird jede Wohnung über einen Balkon verfügen.
Ein Problem, dass im Zusammenhang mit der Baugenehmigung auftrat, war die Erschließung der Wohnanlage mit Rettungswegen für die Feuerwehr. Nachbarschaftsrechtliche Vereinbarungen im Zuge neu entstandener Baulasten und Abstandsflächen waren nunmehr erforderlich, die erst nach erheblichen Verzögerungen vertraglich geregelt werden konnten. Ein brütendes Mauerseglerpärchen im Drempel des Röbellweges nahm ebenfalls keine Rücksicht auf den Bauablaufplan, auch hier konnten die Dacharbeiten leider erst viel später als angedacht, nach Ausflug der Jungen aus dem Nest, beginnen. In Summe führte dies zur verspäteten Fertigstellung der Fassade im hinteren Bereich und damit auch der Balkonmontage an beiden Häusern.
Die Arbeiten im Innenbereich liefen grundsätzlich planmäßig. Bewährt hat sich auch bei diesem Bauvorhaben, die enge Abstimmung mit den Bewohnern und die Möglichkeit für diese, auf Wunsch individuelle Vereinbarungen, z.B. über die Modernisierung von Bädern oder den Austausch von Wohnungseingangstüren, mit der Genossenschaft zu treffen.
Die frei gewordenen Wohnungen während den Bauarbeiten konnten bereits alle neu vermietet werden. Dies zeigt die Attraktivität der fertig gestellten Wohnungen und Häuser der EWG sowie des Wohngebietes in Buch.
investieren, leben / 04.11.2015
60 Jahre Erste Wohnungsgenossenschaft Berlin-Pankow eG
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
Moderne Genossenschaft seit 60 Jahren
\n\n
Die Erste Wohnungsgenossenschaft Berlin-Pankow eG (EWG) beging am 6. Oktober 2015 ihr 60. Gründungsjubiläum. Aus diesem Anlass hatte sich die Genossenschaft in diesem Jahr einiges vorgenommen. Im Mittelpunkt standen dabei ein großes Mitgliederfest, die Jubiläumsausgabe der Mitgliederzeitschrift „EWG-Journal“, eine Ausstellung zum Thema „Die EWG - ein Mitgliederunternehmen wird 60“, die in Zusammenarbeit mit dem Genossenschaftsforum erarbeitet wurde, die Errichtung von zwei Mehrgenerationen-Spielplätzen, quasi als Geschenk an die Mitglieder und Bewohner, sowie weitere Aktivitäten wie eine Pflanzaktion von 60 Bäumen zum 60. Geburtstag.
Aus einer Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft (AWG) der DDR hervorgegangen, kann die EWG auf eine wechselvolle und aus heutiger Sicht insgesamt erfolgreiche Geschichte ihrer Entwicklung zurückblicken. Seit ihrer Gründung bis in das Jahr 1981 war die Bautätigkeit zur Errichtung der Wohnhäuser zur Versorgung der Mitglieder mit Wohnungen prägend, wobei damals vor Bezugsfertigkeit der Wohnung in der Regel Eigenleistungen durch das Mitglied erbracht werden mussten.
Das Jahr 1990 mit der Wiedervereinigung Deutschlands und die ersten Jahre danach stellten die Genossenschaft vor große Herausforderungen. Dabei gelang es, die Umwandlung der AWG zur eingetragenen Genossenschaft (eG) nach bundesdeutschem Recht zu vollziehen. Mit der Neufirmierung konnte die EWG die weiteren Schritte in die Marktwirtschaft erfolgreich bewältigen und steht heute auf einem sicheren Fundament.
\n
Seit 2006 wurden 80 Millionen Euro für Modernisierung aufgewendet
\n
Mit gegenwärtig über 4.400 Mitgliedern und einem Bestand von 3.618 Wohnungen hat die EWG im Jubiläumsjahr den bisher höchsten Entwicklungsstand in ihrer Geschichte erreicht. Im Zeitraum von 2006 bis 2015 wurden rund 80 Millionen Euro in den Wohnungsbestand investiert und somit weitere 1.533 Wohnungen energetisch modernisiert. Zum Ende des Geschäftsjahres 2015 werden rund 83 % des gesamten Wohnungsbestandes komplex energetisch modernisiert sein. In 2010/2011 sind zwei Neubauprojekte mit insgesamt 44 Wohnungen errichtet worden. Diese Neubauten waren ein Novum für die EWG nach 1990. Die Vermietungsquote ist seit vielen Jahren hoch und die Mitglieder wohnen gern in ihrer Genossenschaft.
\n
Großes Fest und Ausstellung zum Jubiläum
\n
Ein besonderer Höhepunkt im Jubiläumsjahr war das Mitgliederfest am 20. September auf dem Künstlerhof in Berlin-Buch. An diesem Spätsommertag kamen über 1.200 Mitglieder mit ihren Familien sowie zahlreiche Gäste der Einladung des Vorstands nach und erlebten unterhaltsame und spannende Stunden. Zu den Gästen zählten Vorstände anderer Wohnungsgenossenschaften und Geschäftspartner. Der Vorstand, Herr Chris Zell und Herr Markus Luft, begrüßte als Ehrengäste den Bezirksbürgermeister von Pankow, Herrn Matthias Köhne, sowie das Vorstandsmitglied des Verbandes Berlin Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V., Frau Maren Kern. Herr Köhne und Frau Kern wendeten sich mit Grußworten an die Anwesenden. Vorstand und Ehrengäste eröffneten dann gemeinsam das Fest. Neben tollen Akteuren auf der Bühne, hatte die Ausstellung „Die EWG - ein Mitgliederunternehmen wird 60“ Premiere und fand großen Anklang bei allen Gästen.
Darüber hinaus wurden im Zuge des 60. Jubiläums zwei Mehrgenerationen-Spielplätze errichtet, mit dem Anliegen, die Begegnung zwischen den Generationen zu fördern. Die neuen Geräte wurden unmittelbar nach der Eröffnung durch die Bewohner intensiv in Besitz genommen.
\n\n
Weitere Investitionen geplant
\n
Auch in den kommenden Jahren plant die EWG hohe Investitionen in den Wohnungsbestand. Um der Nachfrage an familienfreundlichen sowie barrierefrei erreichbaren Wohnraum gerecht zu werden, wurde die Konzeption „EWG 4000 plus“ zur sukzessiven Erweiterung des Bestandes auf etwa 4.000 Wohnungen gemeinsam von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen. Dabei soll durch eine behutsame Nachverdichtung, vor allem auf eigenen Grundstücken, an verschiedenen Standorten Neubauten errichtet werden.
Da sich die Genossenschaft als Mitgliederunternehmen versteht, wird auch zukünftig die Förderung der Mitglieder im Mittelpunkt aller Aktivitäten stehen. Neben der Wohnraumversorgung wird das Angebot an Service- und Dienstleistungen rund um das Wohnen weiter ausgebaut, ein Konzept zur künftigen Gestaltung der Nutzungsgebühren beschlossen und in Anlehnung an alte und bewährte genossenschaftliche Traditionen die Mitwirkung der Mitglieder durch die Bildung von Wohngebietsbeiräten aktiviert werden.
Erfahren Sie mehr über die bewegte Geschichte der Genossenschaft in der Jubiläumsausgabe des EWG-Journals.
\n
Foto: Jubiläumsfest mit den Mitgliedern der EWG auf dem Stadtgut Berlin-Buch, dem früheren Künstlerhof (Foto: EWG Berlin-Pankow eG)
\n
leben / 03.11.2015
Marianne Buggenhagen mit WM-Goldmedaillen zurück im HELIOS Klinikum Berlin-Buch
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
Marianne Buggenhagen, gerade von der Leichtathletik-WM der Behindertensportler aus Katar mit zwei Goldmedaillen zurückgekehrt, wurde am Dienstag, dem 3. November 2015, herzlich im Foyer des HELIOS Klinikums Berlin-Buch begrüßt. Zu den Gratulanten gehörten die Krankenhausleitung und Mitarbeiter aus dem Klinikum sowie Schüler und Lehrer der Marianne-Buggenhagen-Körperbehindertenschule in Berlin-Buch, die sehr stolz auf die Namensgeberin ihrer Schule sind.
Dr. Sebastian Heumüller, Klinikgeschäftsführer im HELIOS Klinikum Berlin-Buch, überreichte der Athletin einen Blumengruß: „Wir beglückwünschen Sie, Frau Buggenhagen, zu Ihrer herausragenden sportlichen Leistung und freuen uns sehr, Sie nach der aufregenden Zeit wieder hier im Klinikum zu begrüßen.“
Der Chefarzt des Zentrums für Geriatrie und Physikalische Medizin, Prof. Dr. med. Michael Berliner, sagte: „Wir haben mit Spannung die Nachrichten über die Wettkämpfe in Katar verfolgt und gratulieren sehr herzlich zu den Goldmedaillen.“
\nDie neunmalige Paralympicssiegerin Marianne Buggenhagen hat in Katar Gold im Kugelstoßen und im Diskuswerfen geholt. Für Buggenhagen, mit 62 Jahren die älteste Athletin der diesjährigen Wettkämpfe, sind es Weltmeistertitel 22 und 23. Somit hat sie in ihrer Leistungssportzeit bisher 60 internationale Medaillen erkämpft.
Die Bernauerin Marianne Buggenhagen arbeitet seit 1991 als Physiotherapeutin im Bucher Klinikum mit körperlich beeinträchtigten Menschen, die nach Unfällen oder Erkrankungen wie sie selbst auf den Rollstuhl angewiesen sind. „Meine Patienten und ich sind auf Augenhöhe. Wir profitieren voneinander und das gibt mir Kraft“, erklärt die Ausnahmesportlerin, und weiter: „Nach langer WM-Vorbereitungszeit und den Wettkämpfen in Katar freue ich mich sehr auf die Arbeit mit den Patienten und meinen Kollegen.“
Hintergrundinformation:
Marianne Buggenhagen ist seit 1977 an den Rollstuhl gebunden und hat ihre Leistungssportlaufbahn erst nach der politischen Wende in der DDR mit dem ersten Weltmeisterschaftsstart 1990 im niederländischen Assen beginnen können. 1994 wurde sie bei einer ARD-Wahl vor Steffi Graf und Franziska van Almsick zur Sportlerin des Jahres gewählt.
Zur HELIOS Kliniken Gruppe gehören 111 eigene Akut- und Rehabilitationskliniken inklusive sieben Maximalversorger in Berlin-Buch, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Schwerin, Wuppertal und Wiesbaden, 52 Medizinische Versorgungszentren (MVZ), fünf Rehazentren, zwölf Präventionszentren und 15 Pflegeeinrichtungen. HELIOS ist damit einer der größten Anbieter von stationärer und ambulanter Patientenversorgung in Deutschland und bietet Qualitätsmedizin innerhalb des gesamten Versorgungsspektrums. Sitz der Unternehmenszentrale ist Berlin.
HELIOS versorgt jährlich rund 4,5 Millionen Patienten, davon 1,2 Millionen stationär. Die Klinikgruppe verfügt insgesamt über mehr als 34.000 Betten und beschäftigt rund 68.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2014 erwirtschaftete HELIOS einen Umsatz von rund 5,2 Milliarden Euro. Die Klinikgruppe gehört zum Gesundheitskonzern Fresenius.
Foto: Marianne Buggenhagen (Bildmitte) wird von Klinikgeschäftsführer Dr. Sebastian Heumüller (l.i.B.), Pflegedienstleiterin Sylvia Lehmann (2.v.l.), Schülern und Lehrern der Marianne-Buggenhagen-Körperbehindertenschule Berlin-Buch, ihren Kollegen sowie Chefarzt Prof. Dr. med. Michel Berliner, Zentrum für Geriatrie und Physikalische Medizin (r.i.B.), beglückwünscht. (Foto: HELIOS, Thomas Oberländer)
leben / 29.10.2015
Einführung des neuen Bundesmeldegesetzes am 1. November 2015
Mit Inkrafttreten des Bundesmeldegesetzes (BMG) am 1. November 2015, anstelle des bisher gültigen Meldegesetzes, besteht für den Wohnungsgeber eine Mitwirkungspflicht bei Meldevorgängen - das Ausstellen der Wohnungsgeberbestätigung - nach §19 BMG. Das bedeutet, dass der Wohnungsgeber (Vermieter) künftig bei jedem Einzug und in einigen Fällen auch beim Auszug (z. B. bei Wegzug ins Ausland oder ersatzloser Aufgabe einer Nebenwohnung) verpflichtet ist, dem Meldepflichtigen den Einzug bzw. Auszug innerhalb von zwei Wochen schriftlich zu bestätigen.
forschen, investieren / 28.10.2015
Berlins neue Biobank für zukunftsweisende biomedizinische Forschung feiert Richtfest
Um molekulare Ursachen von Krankheiten erforschen zu können, benötigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geeignete Biomaterialen wie Blut, Urin und Gewebeproben sowie Behandlungsdaten. Diese Materialen werden in Biobanken unter kontrollierten und qualitativ gesicherten Bedingungen gesammelt, gelagert und verarbeitet.
„Spitzenforschung braucht Spitzenbedingungen. Professionelle Biobanken mit einer ausgezeichneten Qualität an Proben, einem hohen Automatisierungsgrad, kontinuierlichem Temperaturmonitoring und Datensicherheit sind eine Schlüsselvoraussetzung für innovative biomedizinische Forschung. Daher hat das Berliner Institut für Gesundheitsforschung mit der neuen Biobank zukünftig noch bessere Voraussetzungen, um erfolgreiche, unabhängige und international wettbewerbsfähige Forschung zu betreiben“, betont Dr. Georg Schütte, Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung.
„Exzellente Infrastrukturen und Rahmenbedingungen sind Bedingungen dafür, dass biomedizinische Wissenschaft in Berlin attraktiv und zukunftsträchtig ist. Deshalb ist der Neubau der Biobank ein enorm wichtiger Schritt für das Institut für Gesundheitsforschung und damit für Berlin. Die Anwendung von aktuellen und zukünftigen Technologien bei Biomaterialien eröffnet neues Potenzial für die translationale Forschung. Ich bin deshalb überzeugt davon, dass sich das Engagement des BIH und der Charité lohnen wird“, so Sandra Scheeres, Berlins Senatorin für Wissenschaft. Wegweisend sind die Anwendungen der besten Technologien mit qualitativ hochwertigen Biomaterialien vor allem zur Identifizierung von Biomarkern, für neues Wissen um Entstehung und Entwicklung von Krankheiten und damit für die personalisierte Medizin.
Die Biobank des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung wird an zwei Standorten in Berlin etabliert: am Charité Campus Virchow-Klinikum – dort werden vor allem Biomaterialien aus der Krankenversorgung und klinischen Forschung gesammelt und gelagert – sowie am Charité Campus Berlin-Buch mit dem Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC). In Berlin-Buch werden schwerpunktmäßig flüssige Proben von großen Patienten-Kohorten langfristig aufbewahrt. Die Proben aus beiden Standorten stehen Forschungsprojekten des BIH zur Verfügung.
„Besonderes Kennzeichen der neuen Biobank am Charité Campus Virchow-Klinikum sind die vielfältigen Lagerungsmöglichkeiten“, erklärt Prof. Dr. Michael Hummel, Leiter der BIH-Biobank der Charité. In einem neuen automatisierten Tiefkühllager können etwa eine Million Proben bei minus 80 Grad Celsius gelagert werden. Damit gehört die neue Biobank zu den größten Biobanken in Deutschland. Zudem können mindestens eine weitere Million Proben auch in flüssigem Stickstoff (bei bis zu minus 196 Grad Celsius) oder anderen Temperaturen in der neuen BIH-Biobank aufgenommen werden. Neben den Lagern für die Proben verfügt die BIH-Biobank auch über Büros und Labore zur Verarbeitung und Analyse der Proben: „Wir verstehen uns als Dienstleister für die Forschung“, sagt Prof. Dr. Michael Hummel, „und koordinieren auch Prozesse und unterstützen die Analyse der Biomaterialien. Dabei arbeiten wir eng mit den BIH-Omics-Technologieplattformen Genomik, Proteomik und Metabolomik sowie mit der Technologieplattform Bioinformatik zusammen.“
Die neue Biobank wird Proben von Patientinnen und Patienten der Charité sowie aus klinischen Studien der BIH-Forschungsprojekte aufnehmen. Probenmaterial und Daten der Patientinnen und Patienten sind dabei bestens geschützt: Die neue Biobank arbeitet mit einem geprüften Datenschutzkonzept, das aufgrund einer doppelten Pseudonymisierung (doppelte Kodierung) der Proben und Daten eine Re-Identifizierung von Patientinnen und Patienten sowie Probandinnen und Probanden unmöglich macht. Die Verwendung von Proben und Daten für Forschungsprojekte ist nur nach vorheriger Einwilligung der Ethikkommission der Charité möglich.
Über das Berliner Institut für Gesundheitsforschung|Berlin Institute of Health (BIH)
Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung/Berlin Institute of Health (BIH) wurde 2013 gegründet. Es ist ein Zusammenschluss der Charité - Universitätsmedizin Berlin und des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) mit dem Ziel, translationale Medizin basierend auf einem systemmedizinischen Ansatz und durch die beschleunigte Übertragung von Forschungserkenntnissen in die Klinik sowie die Rückkoppelung klinischer Befunde in die Grundlagenforschung voranzubringen. Seit April 2015 ist das BIH selbstständige Körperschaft des öffentlichen Rechts, Charité und MDC sind darin eigenständige Gliedkörperschaften. Das Institut wird mit neuen wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen in der Biomedizin neue diagnostische, therapeutische und präventive Ansätze in der Medizin und damit für die Gesundheit der Menschen schaffen.
forschen / 28.10.2015
KARRIERE IM WISSENSCHAFTSMANAGEMENT – VON DER NOTLÖSUNG ZUR ATTRAKTIVEN OPTION
Die Veranstaltung verbindet einen Impulsvortrag mit Karrierebeispielen. Acht praxiserfahrene Wissenschaftsmanager berichten über ihre Entwicklung. Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick und ein grundlegendes Verständnis für das Wissenschaftsmanagement sowie Impulse für die Gestaltung eines individuellen beruflichen Übergangs und eine mögliche Karriere.
Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 35 begrenzt. Die Teilnahmegebühr beträgt 260,- € inkl. MwSt. und beinhaltet die Teilnahme, Seminarunterlagen und Verpflegung gemäß Programm.
Das Programm finden Sie unter http://www.glaesernes-labor.de/news-beruf.shtml. Für Rückfragen steht Daniela Giese (d.giese@bbb-berlin.de, Tel: 030-9489-2922) gerne zur Verfügung.\n
leben, bilden / 28.10.2015
Zivilcourage: Schutz von Kindern und Jugendlichen in der Öffentlichkeit
Ein Gesprächs- und Trainingsabend zum Schutz von Kindern und Jugendlichen unter dem Thema: "Kinder können sich nicht wehren, sie brauchen Ihre Hilfe" für interessierte Bürgerinnen und Bürger findet am Freitag, dem 6. November 2015, um 17 Uhr in der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung K vierzehn, Achillesstraße 14, 13125 Berlin, statt. Veranstalter ist das Jugendamt Pankow in Kooperation mit der Polizei Berlin. Für Kinderbetreuung und einen kleinen Imbiss ist gesorgt, Anmeldung ist nicht erforderlich.
Die Bezirksstadträtin, Frau Christine Keil (Die LINKE), erklärt dazu:
„Kinder sind durch das Grundgesetz in besonderer Weise unter den Schutz der staatlichen Gemeinschaft gestellt. Ein effektiver Kinderschutz braucht daher auch immer das Engagement couragierter Bürgerinnen und Bürger. In 2- 3 Stunden werden an diesem Abend Möglichkeiten und Methoden aufgezeigt, um Kinder im Wohnumfeld, im öffentlichen Raum und in Institutionen zu schützen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen."
leben / 27.10.2015
Bucher Bürgerforum „Wie helfen wir Flüchtlingen in Buch bei der Integration“
Auf dem Forum berichteten Bucher Bürger über ihr ehrenamtliches Engagement für die Geflüchteten. Sie vermitteln Deutschkenntnisse, erfassen und verteilen Spenden, zeigen den Ort bei Spaziergängen oder laden sie zur gemeinsamen Schlossparkpflege ein. Zwanzig Refugiumsbewohner besuchten auf Einladung den Campus Berlin-Buch zur Langen Nacht der Wissenschaften. Im Gläsernen Labor wurde bereits zum zweiten Mal ein kostenloser Ferientag für Flüchtlingskinder ausgerichtet. Für gemeinsame Veranstaltungen mit Flüchtlingen und Anwohner hat die HOWOGE ihre frühere Info-Box zur Verfügung gestellt. Auch bei der Suche nach Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsplätzen sowie Wohnungen für die Flüchtlinge engagieren sich viele Menschen aus der Region Buch/Karow. Das HELIOS Klinikum hat bereits drei syrische Ärzte eingestellt.
\n
Weitere feste Unterkunft in Buch
Seit acht Jahren steht das Gebäude des Paritätischen Seniorenwohnens in der Straße Alt Buch 48 leer. Nun sollen in den nächsten Wochen 257 Flüchtlinge dort einziehen. Der Geschäftsführer, Ralf Steuerwald, erläuterte den Stand der Vorbereitungen. Die Belegung dieses funktionsfähigen Gebäudes hilft, die Unterbringung von Flüchtlingen in Zelten und Turnhallen zu entlasten.
Lokale Job- und Wohnungsbörse geplant
In der Diskussion wurde deutlich, dass die ehrenamtliche Unterstützung nicht ausreicht, um die tatsächliche Integration der Flüchtlinge, was insbesondere Arbeitsplätze und Wohnungen betrifft, zu erreichen. Der Bucher Bürgerverein hat sich vorgenommen, gemeinsam mit der Albatros gGmbH und der Bucher Wirtschaft für die Flüchtlinge in Buch eine lokale internetgestützte Jobbörse und Wohnungsbörse einzurichten.
Vorschläge für Unterstützung durch Senat und Bezirk
Die an der Diskussion teilnehmenden Abgeordneten des Berliner Abgeordnetenhauses nahmen folgende Vorschläge der Bürger an den Senat und an das Bezirksamt Pankow mit:
- \n
- Finanzierung professioneller Deutsch-Crashkurse als Abendunterricht an einer Bucher Schule \n
- Finanzierung von außerbetrieblicher oder betrieblicher Ausbildung für die ausbildungswilligen Jugendlichen \n
- Finanzierung einer Anpassungsqualifizierung für gesuchte Berufe \n
- Wiedereinführung eines öffentlichen Beschäftigungssektors \n
- Aufstockung der Stelle der Leiterin der Koordinierung des Projekts Willkommen in Buch und Karow von einer halben auf eine ganze Stelle \n
Viele der anwesenden Bürger unterzeichneten an diesem Abend die Bucher Erklärung für Demokratie und Toleranz.
\n
Veranstaltungshinweis
\nDas nächste Bucher Bürgerforum findet am Donnerstag, 19. November statt, zum Thema „Selbstbestimmt und umsorgt alt werden in Buch. Angebote für das Wohnen und die Betreuung von Senioren“.
leben, bilden / 26.10.2015
Rundum gesund: Ein Ferientag im Gläsernen Labor für Kinder aus dem Refugium Buch
Was steckt eigentlich drin in Nüssen, Fisch oder Kartoffeln? Wie sieht ein gesundes Pausenbrot aus? Und wieviel Zucker steckt in meiner Lieblingsnascherei? Die Fragen beantwortete Kindern aus dem Refugium das Gläserne Labor am 22. Oktober bei einem abwechslungsreichen Ferientag im Labor.
\nFinanziert wurde der Kurs, der unter Leitung von Diplom-Biologin Claudia Jacob stattfand, vom Verein der Freunde und Förderer des MDC e.V. Die Gruppe aus Jungen und Mädchen von neun bis 14 Jahren erwartete ein liebevoll hergerichtetes Labor mit Lebensmittelquiz, Kalorienwaage, Stärketest und vielem mehr. Besonders beim gemeinsamen Backen hatten alle Kinder viel Spaß.
\nBei den Experimenten rund um Lebensmittel und Ernährung konnten die Kinder die Arbeit im Labor kennenlernen und ganz nebenbei ihren Wortschatz erweitern. Zum Schluss gab es eine Forschertasche und natürlich eine Kuchenkostprobe für die Eltern zum Mitnehmen.
\n\n
Text und Foto: Dr. Cornelia Stärkel
\n
leben / 22.10.2015
Leerstehendes Seniorenwohnheim in Berlin-Buch soll Flüchtlingsunterkunft werden
Die Gespräche mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales, das für die Unterbringung von Flüchtlingen zuständig ist, sind noch nicht abgeschlossen. Als Betreiber der Unterkunft ist die Paritätische Flüchtlingshilfe gGmbH, eine Tochtergesellschaft des Paritätischen Seniorenwohnens, vorgesehen. Nach jetzigem Stand können die ersten Flüchtlinge voraussichtlich in vier Wochen einziehen. Umbaumaßnahmen im Bereich Sanitär und Brandschutz finden bereits statt.
„Täglich kommen 400 - 500 Menschen, die sich auf der Flucht befinden, nach Berlin. Ihre Unterbringung und menschenwürdige Versorgung ist eine enorme Herausforderung für uns alle. Ich gehe deshalb davon aus, dass das Land Berlin auch in Buch und den anderen Ortsteilen Pankows weitere Unterkünfte für Geflüchtete einrichten wird. Das Bezirksamt wird die Bürgerinnen und Bürger weiterhin über aktuelle Entwicklungen informieren. Der Bezirk Pankow erwartet vom zuständigen Senator von Gesundheit und Soziales, dass er, besser koordiniert als bisher, alle Anstrengungen unternimmt, weitere angemessene Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge zu schaffen, damit die Nutzung von Sporthallen als Notunterkünfte schnellstmöglich beendet werden kann“, sagt Bezirksbürgermeister Matthias Köhne.
Für Fragen zur geplanten Unterkunft in Buch stehen die Flüchtlingskoordinatorin des Bezirksamtes Pankow, Birgit Gust, E-Mail: birgit.gust@ba-pankow.berlin.de, Tel.: 030 90295-2431, und der zukünftige Betreiber der Unterkunft, Herr Steuerwald, Paritätische Flüchtlingshilfe gGmbH, Tel: 030 98 31 55 54 zur Verfügung.
Wer den geflüchteten Menschen helfen möchte, kann sich unter www.pankow-hilft.de informieren.
forschen / 21.10.2015
Zehn neue genetische Risikoregionen für Neurodermitis entdeckt – Internationale Studie mit über 50.000 Neurodermitis-Patienten
Grundlage der Arbeit bildeten 26 Studien mit nahezu 21.400 Neurodermitis-Patienten. Dabei nahmen die Forscher über 15 Millionen genetische Varianten unter die Lupe und verglichen ihre Häufigkeit mit der von über 95.000 Gesunden aus Europa, Afrika, Japan und Lateinamerika. Forscher nennen solche Studien genomweite Assoziationsstudien. Weitere 260.000 Studienteilnehmer wurden untersucht, um die Ergebnisse zu bestätigen. Für Berlin koordinierte die Genetikerin und Kinderärztin Prof. Young-Ae Lee vom Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) und der Charité – Universitätsmedizin Berlin die Studie.
Neurodermitis, auch atopische Dermatitis oder atopisches Ekzem genannt, ist eine entzündliche Hauterkrankung, an der etwa 15 - 30 Prozent der Kinder und 5 - 10 Prozent der Erwachsenen in den Industrieländern erkrankt sind. Forscher vermuten, dass das Risiko an Neurodermitis zu erkranken, zu etwa Zweidrittel von erblichen Faktoren bestimmt wird. Die Hauterkrankung bricht in den meisten Fällen bereits in den ersten Lebensmonaten aus. Sie tritt über Jahre meist schubweise auf und ist mit quälendem Juckreiz verbunden, wird aber mit zunehmendem Alter oft schwächer oder verschwindet. Häufig entwickeln Kinder, die Neurodermitis hatten, in späteren Jahren andere allergische Erkrankungen wie Heuschnupfen und Asthma.
Die neuidentifizierten Genorte zeigen eine starke Übereinstimmung mit bekannten Genorten für Asthma und Allergie, aber auch mit anderen chronisch entzündlichen Erkrankungen, wie Morbus Crohn und Schuppenflechte sowie mit Autoimmunerkrankungen. Die Studie bestätigte aber auch bekannte erbliche Risikofaktoren, die die Barrierefunktion der Haut stören. Gene in diesen Genorten spielen eine wichtige Rolle bei der Erkennung und Abwehr von Mikroben und bei der Entwicklung und Aktivierung von T-Zellen. Insgesamt unterstreicht die Studie die Bedeutung des Immunsystems bei der Entstehung der Neurodermitis.
⃰Multi-ancestry genome-wide association study of 21,000 cases and 95,000 controls identifies new risk loci for atopic dermatitis
forschen / 21.10.2015
Zu viel Salz im Essen kann das Immunsystem aus dem Gleichgewicht bringen
Zu viel Salz im Essen ist ungesund. Darin sind sich Ärzte und Ernährungswissenschaftler einig und warnen vor zu hohem Salzkonsum. Als gesichert gilt, dass Kochsalz (Natriumchlorid) den Blutdruck in die Höhe treiben kann. Es wird auch als Mitverursacher von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Krankheiten, Autoimmunerkrankungen sowie Krebs diskutiert. „Doch sind die Erkenntnisse darüber zum Teil noch sehr umstritten, weil man die Mechanismen nicht kennt“, sagt Prof. Müller. „Und wir wissen auch nicht, was genau zu viel Salz ist, beziehungsweise, wie viel Salz man essen kann, um noch auf der sicheren Seite zu sein“.
Die Genetik spielt bei den aufgeführten Erkrankungen eine große Rolle, doch der starke Anstieg an Entzündungskrankheiten sowie Autoimmunerkrankungen – dabei zerstört das Immunsystem irrtümlicherweise körpereigene Strukturen – lässt vermuten, dass auch Umweltfaktoren entscheidend zu diesen Krankheiten beitragen. Dabei steht die sehr fett- und salzhaltige „westliche“ Ernährungsweise seit Kurzem unter besonderem Verdacht.
Seit wenigen Jahren ist nämlich bekannt, dass zu viel Salz in der Nahrung auch Auswirkungen auf das Immunsystem hat und zwar in unterschiedlichster Weise. In ihrer jetzt im Journal of Clinical Investigation veröffentlichten Studie erbringen Dr. Binger, Matthias Gebhardt und Prof. Müller den Nachweis, dass zu viel Salz in der Nahrung eine bestimmte Gruppe von Fresszellen (Makrophagen) des Immunsystems schwächt, deren Aufgabe es unter anderem ist, Entzündungen im Körper zu bekämpfen. Bei diesen Immunzellen handelt es sich um Makrophagen vom Typ 2, die von den Botenstoffen des Immunsystems, den Interleukinen IL-4 und IL-13 stimuliert werden. Bei Nagern, die mit stark salzhaltigem Futter ernährt wurden, war die Wundheilung verzögert; nicht zuletzt wohl auch aufgrund der salzbedingten Schwächung dieser besonderen Fresszellen, wie die Wissenschaftler vermuten.
Eine Forschergruppe um Prof. Jens Titze (Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA), entdeckte dabei kürzlich zusammen mit den Berliner Forschern einen neuen Salzspeicher im Körper: Überschüssiges Salz lagert sich in den Zwischenräumen von Haut- und Muskelzellen ab und nicht etwa im Blut, da die Nieren den Salzgehalt dort ständig regulieren. Diese neuen Erkenntnisse ermöglichten es den drei MDC-Wissenschaftlern auch den Mechanismus aufzuklären, über welchen Kochsalz die Aktivität der Makrophagen schwächt.
Erst 2013 hatte eine Gruppe von Forschern, darunter auch Prof. Müller, eine andere Wirkung von Salz auf das Immunsystem entdeckt. In einer in Nature veröffentlichten Studie hatten sie nachgewiesen, dass erhöhter Salzkonsum die Entstehung von Autoimmunerkrankungen fördert. Der Grund: Zu viel Salz führt zu einem massiven Anstieg einer Gruppe aggressiver Immunzellen (Th17-Helferzellen). Die T-Helferzellen, die den Botenstoff Interleukin 17 produzieren und deshalb als Th17-Zellen bezeichnet werden, sind mit daran schuld, dass das Immunsystem Amok läuft und den eigenen Organismus angreift und schädigt.
Erst in diesem Frühjahr erbrachten Prof. Titze, Prof. Müller, Dr. Binger und Matthias Gebhardt zusammen mit anderen Forschern bei Nagern und bei Patienten den Nachweis, dass hoher Salzkonsum das Immunsystem auf Trab bringt und bakteriellen Infektionen in der Haut rasch den Garaus macht (Cell Metabolism). Der Grund: Salz lagert sich in der Haut ein und aktiviert bei einer bakteriellen Hautinfektion Makrophagen vom Typ 1, die vermehrt bakterientötende Substanzen ausschütten. In diesem Zusammenhang warnt Prof. Müller jedoch davor, zu viel Salz zu essen: „Die Risiken überwiegen den Nutzen“. Mehr noch: „Diese vermeintlich widersprüchlichen Befunde deuten darauf hin, dass sich die Makrophagen ganz unterschiedlich an ein Milieu anpassen können, das sich durch einen erhöhten Salzpegel im Körper verändert“.
*High salt reduces the activation of IL-4+IL-13 stimulated 1 macrophages
forschen / 19.10.2015
Von Vancouver nach Berlin: W3-Professur für Bioinformatikerin Irmtraud Meyer an der FU Berlin und am Max-Delbrück-Centrum
Systembiologie und Systemmedizin verknüpfen die moderne Biologie und Medizin mit der Bioinformatik. Dahinter steht der Gedanke, dass es für viele Erkrankungen molekulare Ursachen gibt, die im Detail und dem Ursprung nach verstanden werden können. Ziel dieses neuen Forschungszweigs ist es, komplexe Vorgänge auf den verschiedensten Ebenen, auch auf molekularer Ebene, zu entschlüsseln und darauf aufbauend neue Diagnosemethoden und Therapien zu entwickeln, um Erkrankungen frühzeitig erkennen und behandeln zu können und im Idealfall sogar an den einzelnen Patienten anzupassen.
Schwerpunkt der Forschungen von Prof. Meyer ist das Transkriptom, die Gesamtheit der RNA Moleküle, die bei der Transkribierung von Genen – der Umschreibung der DNA in RNA – entstehen und aus proteinkodierenden oder nicht-kodierenden RNA-Molekülen bestehen. Protein-kodierende RNAs werden in Proteine umgesetzt, nicht-kodierende RNAs sind wichtige Regulatoren der Zellmaschinerie. Erst die zelltyp-spezifische Regulierung dieser einzelnen Moleküle führt zur korrekten Ausbildung einer gesunden Zelle beziehungsweise eines gesunden Organismus.
Die Rolle, die die sogenannte RNA-Struktur bei der Regulierung der proteinkodierenden und nichtkodierenden Gen-Transkripte einnimmt, ist dabei von besonderem Interesse für die Forscherin, weil dadurch potentiell viele Arten von Regulierungsmechanismen robust, das heißt ohne großen Einfluss von vielen externen Molekülen, gesteuert werden können. Die Forschungsgruppe von Prof. Meyer entwickelte bereits mehrere Programme zur Gen- und RNA-Strukturvorhersage und führte zahlreiche Computeranalysen zu RNA-Strukturen und ihren Funktionen durch.
Ein weiterer Schwerpunkt der Forschungen von Prof. Meyer ist die Entschlüsselung des Netzwerks von RNA-RNA-Interaktionen und anderen Transkriptom-Interaktionen. Diese Art von Interaktionen sind im Gegensatz zu Protein-Protein Netzwerken bisher weniger umfassend erforscht. Bestimmte Klassen von RNA-RNA Wechselwirkungen, wie beispielsweise die Wechselwirkungen zwischen der Boten-RNA (mRNA) mit der microRNA (miRNA), haben sich bereits als funktional überaus wichtig herausgestellt. Daher gibt es berechtigte Hoffnung, weitere neue Klassen von Interaktionen entdecken zu können.
Irmtraud Meyer wurde 1974 in Hameln im Weserbergland geboren. Von 1993 - 1998 studierte sie Physik und Mathematik an der Rheinisch-Westfälischen Hochschule (RWTH) Aachen, sowie an der Universität von Paris-Süd XI, Frankreich. Im Rahmen ihrer Diplomarbeit war sie mehrere Monate am europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf, Schweiz, tätig. Nach ihrem Physikdiplom in Aachen ging sie von 1999 - 2002 als Doktorandin an das Wellcome Trust Sanger Institute und an das Department of Genetics der Universität Cambridge, Großbritannien. Nach ihrer Promotion arbeitete sie von 2002 bis 2004 am Oxford Centre for Gene Function sowie am Department of Statistics der Universität Oxford und kehrte dann für ein Jahr nach Cambridge zurück. Dort war sie als Postdoc am European Bioinformatics Institute tätig, das Teil des European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg ist. Im März 2006 nahm sie einen Ruf an die University of British Columbia in Vancouver, Kanada, an. Dort arbeitete sie über neun Jahre am UBC Centre for High-Throughput Biology (ChiBi), dem Department of Computer Science und dem Department of Medical Genetics, zuletzt als Assistenzprofessorin.
Die junge Forscherin erhielt zahlreiche Auszeichnungen. So war sie Honorary Scholar des Cambridge European Trust (1999 - 2002), Wellcome Trust Prize Student (2000 - 2002) und zweimal Marie Curie Fellow (2007, 2009) am Rényi Institute of Mathematics der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest. Prof. Meyer ist darüber hinaus Mitglied in der International Society for Computational Biology, der RNA Society und der Mathematical Society of the University of Oxford.
Foto: Prof. Irmtraud Meyer (Foto: privat)
forschen / 19.10.2015
Unterdrückung von Tumoren: Regulationsmechanismus entdeckt
Jede Zelle in unserem Körper meistert einen fein austarierten Balanceakt: Sie muss sich auf Kommando teilen und durchs Gewebe an ihren Bestimmungsort wandern, dabei aber strenge Disziplin wahren und sowohl ihre Vermehrung als auch ihre Wanderungen eng begrenzen. Passiert bei diesem Balanceakt ein Fehler, kann es zu unkontrollierten Wucherungen und damit Krebserkrankungen kommen. Die Arbeitsgruppe von Tanja Maritzen am Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie in Berlin (FMP) hat nun einen Mechanismus entdeckt, der die Beweglichkeit von Zellen reguliert und damit vermutlich der Entstehung von Krebs entgegenwirkt. Die Wissenschaftler erzeugten einen Stamm von Mäusen, dem das Gen für das Protein Stonin1 fehlt. Die Tiere entwickelten sich zwar zunächst unauffällig, doch die Forscher fanden heraus, dass sich auf ihren Zelloberflächen der Rezeptor NG2 stark anreichert.
Dieses Oberflächenprotein, das die Beweglichkeit von Zellen beeinflusst, kannte man bereits als Tumormarker, unter anderem aus aggressiven Hirntumoren, wo es gehäuft auftritt. Bislang war allerdings unbekannt, wie NG2 reguliert wird. Durch die Arbeit der FMP-Forscher ist nun klargeworden: Die von NG2 in die Zelle geleiteten Signale werden unterbrochen, indem der Rezeptor von der Zelloberfläche entfernt wird. Dazu werden von der Außenmembran der Zelle kleine Bläschen mitsamt dem Rezeptor abgeschnürt. Die Abschnürung wird von einer molekularen Maschinerie im Inneren der Zelle bewerkstelligt – Stonin1 ist dabei der Adapter, der NG2 spezifisch daran ankoppelt. Nur durch den Abtransport von NG2 und Abbau kann verhindert werden, dass das Protein ungeregelt Signale in die Zelle schickt, was die Bildung von Tumoren begünstigen würde.
„Ein spannender Moment in unserer Arbeit war, als wir herausfanden, dass Stonin1 über NG2 die Zellbeweglichkeit beeinflusst“, erinnern sich Fabian Feutlinske und Marietta Browarski, die beiden Erstautoren der Arbeit. Bei Versuchen in der Kulturschale bewegten sich die Zellen ohne Stonin1 im Vergleich zu normalen Zellen geradliniger fort. Dies war allerdings nur der Fall, wenn die Zellen über NG2 verfügten, was belegt, dass die veränderte Zellbewegung auf die fehlerhafte Regulation von NG2 zurückgeht.
„Da erhöhte NG2-Level das Wachstum von Gehirntumoren begünstigen, erfüllt Stonin1 mit dem Abtransport von NG2 unter Umständen eine wichtige Rolle bei der Unterdrückung von Tumoren“, erklärt Gruppenleiterin Tanja Maritzen. „Dieser Frage möchten wir in Zukunft weiter nachgehen.“
Quelle: Fabian Feutlinske, Marietta Browarski, Min-Chi Ku, Philipp Trnka, Sonia Waiczies, Thoralf Niendorf, William B. Stallcup, Rainer Glass, Eberhard Krause & Tanja Maritzen: Stonin1 mediates endocytosis of the proteoglycan NG2 and regulates focal adhesion dynamics and cell motility. Nature Communications, 5. Oktober 2015
Kontakt:
Dr. Tanja Maritzen
Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP)
maritzen@fmp-berlin.de
Tel.: 0049 30 94793-214
\n
Abbildung: Zellen, die kein Stonin1 herstellen (rechts), weisen stark erhöhte Level des Tumor-fördernden Proteins NG2 auf, da sie es ohne das Adapterprotein Stonin1 nicht effizient von der Oberfläche entfernen können. Abb. Marietta Browarski, FMP
forschen, produzieren, heilen / 19.10.2015
Arzneimittelherstellung im ECRC auf dem Campus Berlin-Buch
Interview mit Dr. Joachim Kopp und Dr. Martin Vaegler über die hochspezielle Herstellung.
Das ZKP gehört zu den Core Facilities am ECRC und wird von Charité und Max-Delbrück-Center für Molekulare Medizin (MDC) gemeinsam betrieben. Welche Aufgaben hat
es?
Dr. Kopp: Wir stellen Zellular- und Gentherapeutika her, sogenannte Advanced-therapy medicinal products (ATMP) und bilden damit eine Brücke zwischen akademischer Forschung und klinischer Anwendung. Haben sich innovative Therapieansätze, die auf lebenden Zellen basieren, in der präklinischen Prüfung bewährt, produzieren wir erstmals diese Arzneimittel für eine klinische Prüfung beim Menschen. Zum Beispiel wird derzeit die Herstellung eines vielversprechenden Gentherapeutikums für die MDC/Charité-Forschergruppe von Prof. Blankenstein vorbereitet. Es soll in einer klinischen Studie eingesetzt werden, die prüft, ob sich Knochenmarkkrebs (Multiples Myelom) durch gentechnisch modifizierte T-Zellen erfolgreich behandeln lässt. Wir werden die Prüfarzneimittel für Phase I/II der klinischen Prüfung liefern. (Mehr zu den Forschungsergebnissen hier).
\n
Was unterscheidet Sie von anderen Arzneimittelherstellern?
Dr. Kopp: Ein Großteil der Betriebskosten und die Personalkosten werden vom ECRC getragen. Wir können dadurch unsere Dienstleistung für Forschungsgruppen von MDC und Charité zu sehr viel geringeren Kosten als kommerzielle Einrichtungen anbieten. Bei anderen Herstellern muss die Infrastruktur mitbezahlt werden.
Obwohl wir eine sehr kleine Einheit mit gegenwärtig nur sechs Mitarbeitern sind, gewährleisten wir eine behördlich geprüfte, sterile Produktion der Arzneimittel. Die Anforderungen sind sehr hoch, da man Arzneimittel, die auf lebenden Zellen basieren, nicht nachträglich sterilisieren kann.
Ein Vorteil ist auch die räumliche Nähe auf dem Campus, die seit jeher Kooperation und unkomplizierten Austausch fördert. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die planen, ein Therapeutikum bei uns herstellen zu lassen, können sich frühzeitig an uns wenden. Mit unserer Erfahrung, ATMP entsprechend der gesetzlichen Regularien herzustellen, können wir kalkulieren, wieviel Zeit für die Vorbereitung benötigt wird. Zellen herzustellen, die im Menschen verwendet werden, setzt validierte, reproduzierbare Verfahren voraus – sowohl in der Herstellung als auch in der Qualitätskontrolle. Vom Aufbau der Methodik über Probeläufe bis zur Genehmigung können ein bis zwei Jahre vergehen. Dies wird häufig unterschätzt. Wir können auch beurteilen, ob sich ein im Forschungslabor entwickeltes Herstellungsverfahren überhaupt für eine aseptische Arzneimittelherstellung eignet. Je eher wir in die Planung eines solchen Arzneimittels einbezogen werden, desto effektiver kann das Projekt umgesetzt werden.
Dr. Vaegler: Allerdings haben wir im Unterschied zu vielen anderen Arzneimittelherstellern nur eine relativ geringe Kapazität und können daher nur Prüfarzneimittel für die Phasen I und II produzieren.
Wie ist das ZKP aufgebaut und welche Anforderungen muss es erfüllen?
Dr. Kopp: Unsere Einheit besteht aus einem Herstellungsbereich mit zwei Reinräumen
der Reinheitsklasse A in B, die eine aseptische Arzneimittelfertigung nach den Regeln der Good Manufacturing Practice (GMP) erlauben. Weiterhin verfügen wir über einen Bereich Qualitätskontrolle und ein mikrobiologisches Labor. Die Arzneimittel entstehen in absolut steriler und praktisch partikelfreier Umgebung. Wir müssen einerseits sicherstellen, dass keine Mikroorganismen oder Viren in die Prüfpräparate gelangen und andererseits verhindern, dass Viren aus der Herstellung von Gentherapeutika in die Umgebung oder in andere Produkte gelangen. Das hat mit Luftströmung zu tun, mit Schutzkleidung der Mitarbeiter, mit Wegen von Material, Abfall und Personen, die sich nicht überschneiden dürfen. Insbesondere erfordert diese Arbeit eine hohe Qualifikation.
Dr. Vaegler: In den Räumen des ZKP überwachen und dokumentieren kalibrierte Mess-Systeme permanent 75 Kontrollparameter. Jede unzulässige Abweichung löst außerhalb der Dienstzeiten eine SMS an alle Mitarbeiter aus. Bei Gefahr für die Produkte müssen wir ins Labor fahren, auch nachts.
Wie wird das Arzneimittel für die Gentherapie aus dem Projekt von Prof. Blankenstein entstehen?
Dr. Kopp: Für die Studie werden 20 Patienten nach ärztlichem Befund sowie Studienparametern ausgewählt und virologisch geprüft. Die Abteilung Stammzelltransplantation des Virchowklinikums gewinnt dann Lymphozyten aus dem Blut der Patienten und reichert daraus eine spezielle Zellpopulation für uns an – die Basis für das individuelle Therapeutikum. Wir bereiten diese Zellen für die Kryokonservierung vor und frieren sie ein. Die Qualitätskontrolle prüft, ob die eingelagerten Zellen steril sind, welche Zelltypen in welchem Anteil vorhanden sind und wie sie sich bei der Herstellung verhalten werden. Für die eigentliche Herstellung pro Patient benötigen wir 10 – 12 Tage.
Dr. Vaegler: Wir erzeugen in den kultivierten Zellen spezifische T-Zellrezeptoren, mit deren Hilfe das Immunsystem Krebszellen des Multiplen Myeloms erkennt und angreift. Dafür statten wir die gewöhnlichen T-Zellen des Patienten mit einem zusätzlichen Gen aus. Die Erbinformation wird durch Retroviren eingeschleust, die das Gen stabil in das menschliche Genom integrieren. Man bezeichnet diesen Prozess als Transduktion. Anschließend vermehren wir die Zellen mit Hilfe von stimulierenden Reagenzien im WAVE-Bioreaktor, bis zu 10 Liter pro Patient. Daraus gewinnen wir eine ausreichende Menge der genetisch veränderten T-Zellen für die klinische Prüfung – etwa 100 ml Infusion, die einmalig gegeben werden.
\nDr. Kopp: Nach der Herstellung wird im ZKP geprüft, ob das Produkt steril ist und welche Oberflächenmarker vorhanden sind. Außerdem belegt die Qualitätskontrolle mittels Durchflusszytometrie, wie hoch die Anzahl der Zellen ist, die den transduzierten T-Zell-Rezeptor tragen. Externe Labore kontrollieren, ob das Arzneimittel frei von Mykoplasmen und Endotoxinen ist. Erst dann können wir es für die Anwendung im Patienten freigeben.
Wie lange wird es dauern, bis alle Prüfarzneimittel dafür hergestellt sind?
Dr. Kopp: Von der Etablierung der Methoden über die Genehmigung bis zur Herstellung für alle Patienten der Studie benötigen wir etwa drei Jahre.
Wem steht die Fachkompetenz des ZKP noch zur Verfügung?
Dr. Kopp: Als Einrichtung mit Herstellungserlaubnis nach § 13 des Arzneimittelgesetzes (AMG) stellen wir auch Dienstleistungen zur Verfügung. Wir prüfen zum Beispiel, ob Arzneimittel steril sind oder werten das mikrobiologische Monitoring für Firmen auf dem Campus Buch aus.
\n
Interview: Christine Minkewitz
\n
Foto: Team mit hoher Verantwortung: (v.l.n.r.) Antje Huth, Carola Vogler, Joachim Kopp, Carina Engel, Martin Vaegler, Constanze Schwarz (Foto: David Ausserhofer)
forschen, investieren, produzieren, leben, heilen, bilden / 19.10.2015
Neue Kita der KVPB Kindertagesstätten gGmbH im Stadtteil Buch
\n
\n
\n
\n
\n
\n
In Berlin-Buch gibt es eine neue Kindertagesstätte: die Kita Buch in der Karower Chaussee 169B. Für die Familien im Quartier werden sukzessive 70 Kita-Plätze geschaffen. Mit Mitteln aus dem Förderbereich „Stadtumbau Ost“, vielen Eigenmitteln und einem engagierten Architektenteam sanierte die KVPB Kindertagesstätten gGmbH das Gebäude. Die Gestaltung des großen Gartengrundstücks ist noch nicht abgeschlossen.
\nKonzeptionell arbeitet der U3-Bereich (Kinder unter drei Jahren) nach Emmi Pikler, für den Ü3-Bereich (Kinder über drei Jahren) wird offen in altersgemischten Gruppen gearbeitet. Frühstück und Vesper wird frisch in der Kita zubereitet, mittags beliefert ein DGE-zertifizierten Essensanbiete.
\nBei Interesse an einem Kitaplatz in der Kita Buch schreiben Sie bitte eine Mail an kitabuch@kvpb.de oder wenden Sie sich an unser Sekretariat (030-446 777 30).
Mehr zu neuen Kita, deren Konzept und Sanierung erfahren Sie hier:
\n\n\n
Foto: Kurz vor Abschluss der Sanierung (Foto: Stadtumbau Ost)
\n
investieren, leben / 15.10.2015
HOWOGE feiert Richtfest für weitere 77 Wohnungen in Berlin-Pankow
Auf dem mehr als 2.800 Quadratmeter großen Areal in der Treskowstraße 23-28 werden derzeit 1,5 bis 5 Zimmerwohnungen in sechs Vollgeschossen sowie einem Staffelgeschoss errichtet. Die Wohnungen sind zwischen 29 und 115 Quadratmeter groß und für breite Schichten der Bevölkerung ausgelegt. „Pankow ist wie Lichtenberg ein familienfreundlicher Bezirk. Der HOWOGE war es daher wichtig, auch hier bezahlbaren Wohnraum zu errichten. Wir haben uns dazu entschlossen, hier erstmals mit vorgefertigten Bauteilen zu arbeiten, um Bauzeiten zu verkürzen“, erklärt Stefanie Frensch, Geschäftsführerin der HOWOGE. Das kommunale Wohnungsunternehmen verwendet im Rahmen ihrer Neubauoffensive bei diesem Bauprojekt zum ersten Mal vorgefertigte Außenwände, tragende Innenwände und Geschossdecken.
Zusätzlich zu den 77 Wohnungen entstehen 21 Tiefgaragenplätze sowie Aussenstellplätze für die neuen Anwohner an der Treskowstraße. Alle Mieteinheiten werden barrierefrei erreichbar sein. Der Baubeginn erfolgte im November 2014. Die Fertigstellung und somit die Übergabe an die HOWOGE ist nach jetzigem Planungsstand für Mitte 2016 geplant. Die HOWOGE vermietet und bewirtschaftet die Immobilie. „Durch die Vielfalt an Wohnungsgrößen und die barrierefreie Erreichbarkeit entsteht hier ein Wohnquartier für alle Generationen. Dank der guten infrastrukturellen Anbindung ist man innerhalb kürzester Zeit im Stadtzentrum und lebt doch mitten im Grünen“, sagt Gerd Mielke, Geschäftsführer von Quattrohaus.
Über die HOWOGE
Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH ist das leistungsstärkste kommunale Wohnungsunternehmen des Landes Berlin. Mit einem eigenen Wohnungsbestand von rund 57.000 Wohnungen gehört das Unternehmen zu den zehn größten Vermietern deutschlandweit. Derzeit hat die HOWOGE rund 1.500 Wohnungen in Bau bzw. Planung.
Über Quattrohaus GmbH & Co. KG
Die Quattrohaus-Gruppe ist ein auf den Wohnungsneubau spezialisierter Projektentwickler und Bauträger. In den letzten 11 Jahren realisierte die Quattrohaus 33 Wohnanlagen in den Städten Berlin, Cottbus und Dresden. Für die kommenden Jahre plant die Unternehmensgruppe die jährliche Errichtung von drei bis fünf Wohnanlagen in Berlin sowie den Ausbau der Generalunternehmertätigkeit.\n
forschen, investieren, produzieren / 13.10.2015
Eckert & Ziegler verleiht Reisepreis an nuklearmedizinische Nachwuchsforscher
Der von der Eckert & Ziegler AG in Zusammenarbeit mit der European Association for Nuclear Medicine (EANM) durchgeführte und mit Preisgeldern in Höhe von je 1.000 EUR dotierte Wettbewerb fand damit bereits zum achten Mal statt. Aus den insgesamt 617 Einsendungen wählte die siebenköpfige Jury der EANM die folgenden fünf Laureaten aus:\n
Erik Aarntzen, Niederlande: Tc-99m-CXCL8 SPECT to image disease activity in inflammatory bowel disease
Ana Denis-Bacelar, Großbritannien: Metastatic control probability in patients with prostate cancer metastatic to bone treated 186Re-HEDP
\nMatthias Eder, Deutschland: A phage display derived stabilised bicyclic peptide targeting MMP-14 shows high imaging contrast in small animal PET imaging
\nElsmarieke van de Giessen, Niederlande: Blunted striatal dopamine release in cannabis dependence
\nReinier Hernandez, USA: Synergistically Enhanced Tumor Uptake via Dual-Targeting of CD105 and EGFR Using a “Click” Heterodimer
\n
„Mit dem Eckert & Ziegler Reisepreis möchte Eckert & Ziegler junge Forscher unterstützen, ihre Forschungsergebnisse in der medizinischen Bildgebung einem breiten Publikum zugänglich zu machen und bald in erfolgreiche Diagnose- und Therapieverfahren umzuwandeln“, erklärte
Dr. André Heß, Mitglied des Vorstands der Eckert & Ziegler AG und verantwortlich für das Segment Radiopharmazie.
Weitere Informationen zum Eckert & Ziegler Reisepreis:
www.ezag.com/de/startseite/ueber-uns/gesellschaftliches-engagement/reisepreis.html
Über Eckert & Ziegler
Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN DE0005659700), gehört mit rund 700 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin.
Wir helfen zu heilen.
forschen / 13.10.2015
Kürbisförmiges Molekül für 100mal besseren Bildkontrast - Kontrastmittel spürt krankhafte Zellen auf
Molekulare Käfige zum temporären Einfangen von Xenon-Atomen weisen sehr unterschiedliche Austauschraten für das hyperpolarisierte Edelgas auf. Wie im Artikel von Martin Kunth et al. gezeigt, ermöglicht das kürbisförmige Cucurbit[6]uril (rechts) eine wesentlich bessere NMR-Signalverstärkung durch schnelleren Austausch als das bisher verwendete Cryptophan-A (links) (Graphik: Barth van Rossum, FMP)
Personalisierte Medizin statt eine Behandlung für alle – dieser Ansatz hat insbesondere in der Krebsmedizin zu einem Paradigmenwechsel geführt. Die Molekulare Diagnostik ist jener Schlüssel, um Patienten den Zugang zu einer maßgeschneiderten Therapie zu öffnen. Wenn jedoch Tumore in schwer zugänglichen Körperbereichen liegen oder bereits mehrere Tumorherde vorhanden sind, scheitert es oft an ausreichender Empfindlichkeit der diagnostischen Bildgebung. Die aber wird benötigt, um die verschiedenen Zelltypen bestimmen zu können, die sich selbst innerhalb eines Tumors erheblich unterscheiden. Mit dem PET-CT können heute zwar schon kleinste Tumorherde und andere krankhafte Veränderungen aufgespürt werden, eine Differenzierung nach Zelltyp ist jedoch für gewöhnlich nicht möglich.
Wissenschaftler vom FMP setzen deshalb auf die Xenon-Magnetresonanztomographie: Die Weiterentwicklung der herkömmlichen Kernspintomographie macht sich die „Leuchtkraft“ des Edelgases Xenon zu Nutze, das in der MRT ein 10.000-fach verstärktes Signal liefern kann. Dazu muss es im erkrankten Gewebe von sogenannten „Käfig-Molekülen“ vorübergehend eingefangen werden. Mit bisher verwendeten Molekülen gelingt das mehr oder weniger gut, von einer medizinischen Anwendung ist der experimentelle Ansatz jedoch noch weit entfernt.
Cucurbituril liefert verblüffende Bildkontraste
Die Arbeitsgruppe von Dr. Leif Schröder am Forscher am Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) hat nun ein Molekül entdeckt, das alle bisher verwendeten Moleküle in den Schatten stellt. Cucurbituril tauscht etwa 100mal mehr Xenon pro Zeiteinheit aus als seine Mitstreiter, was zu einem wesentlich besseren Bildkontrast führt. „Es war schnell klar, dass sich Cucurbituril als Kontrastmittel eignen könnte“, berichtet Leif Schröder. „Überraschend war jedoch, dass damit markierte Bereiche in den Bildern mit viel besserem Kontrast dargestellt werden als bisher.“ Die Erklärung liegt in der Geschwindigkeit. Cucurbituril reagiert sozusagen bei der Belichtung schneller als alle bisher verwendeten Moleküle, da es das Xenon nur sehr kurz bindet und somit die Radiowellen zum Nachweis des Edelgases innerhalb einem Bruchteil von Sekunden auf sehr viele Xenon-Atome überträgt. Dadurch wird das Edelgas sehr viel effizienter durch das Molekül geschleust.
In der Studie, die im Fachmagazin „Chemical Science“* erschienen ist, sind weltweit zum ersten Mal MRT-Aufnahmen mit Cucurbituril gelungen. Mit Hilfe eines starken Lasers und eines verdampften Alkalimetalls haben die Forscher die magnetischen Eigenschaften von gewöhnlichem Xenon zunächst enorm verstärkt. Das hyperpolarisierte Gas wurde dann in eine Testlösung mit den Käfig-Molekülen eingeleitet. Eine anschließende MRT-Aufnahme zeigte die Verteilung des Xenons im Objekt. In einer zweiten Aufnahme zerstörte das Curcurbituril zusammen mit Radiowellen die Magnetisierung des Xenons vorab, wodurch dunkle Flecken auf den Bildern entstanden. „Der Vergleich beider Aufnahmen belegt, dass nur das Xenon in den Käfigen die richtige Resonanzfrequenz hat, um einen dunklen Bereich zu erzeugen“, erklärt Schröder. „Diese Schwärzung ist mit Cucurbituril viel besser möglich als mit bisherigen Käfig-Molekülen, denn es arbeitet wie ein sehr lichtempfindliches Fotopapier. Der Kontrast ist etwa 100mal stärker.“
Für jeden Zelltyp ein hoch spezifisches Kontrastmittel
Gerade wurden auch in einer weiteren Publikation erste Tests mit Zellmaterial veröffentlicht, bei denen Cucurbituril zudem in der Lage ist, ein bestimmtes Enzym zu detektieren, das in Krebszellen gehäuft vorkommt. Anhand der Enzymreaktion lässt sich auf die Bösartigkeit der Zellen schließen. Das Besondere daran: Schon relativ wenig Zellmaterial reicht dann aus, um die Tumorzellen im MRT darzustellen. Den Forschern zufolge könnten zukünftig also schon sehr kleine Tumorherde mit der neuen Methode aufgespürt werden. Doch davon ist man noch weit entfernt. Zunächst muss in Tierstudien bewiesen werden, ob sich die bisherigen Testergebnisse überhaupt auf den lebenden Organismus übertragen lassen. Wenn ja, könnten hoch sensitive Kontrastmittel daraus entwickelt werden, die weitere Enzyme und damit ganz unterschiedliche Zelltypen markieren können.
Für die Krebsdiagnostik wäre das ein Meilenstein. Bei einer MRT-Untersuchung könnten Ärzte durch die Gabe mehrerer Kontrastmittel die Krebszellen gleich molekular klassifizieren und die Therapie entsprechend individualisieren. Ganz ohne belastende Biopsien, wie Leif Schröder betont. Sein Kooperationspartner von der Jacobs University Bremen, Dr. Andreas Hennig, nennt noch einen weiteren Pluspunkt: „Die Xenon-MR-Tomographie hat den großen Vorteil, dass es im Gegensatz zu klassischen radioaktiven Kontrastmitteln keine nennenswerte Strahlenbelastung für den Patienten gibt. Außerdem haben sich Cucurbiturile in Toxizitätstests mit Mäusen als unbedenklich erwiesen“, so der Chemiker.
Abgesehen von dem ehrgeizigen Ziel, die Xenon-MRT als eine Art Biopsieersatz am Menschen einzusetzen, kann die Arbeit schon bald einen Beitrag zur Arzneimittelforschung leisten. Die Wirkung von neuen Substanzen auf den Krankheitsverlauf kann nämlich in den Tierstudien, die ohnehin durchlaufen werden müssen, getestet werden.
Erstautor Martin Kunth sieht in der Entdeckung von Cucurbituril aber erst den Anfang einer erfolgsversprechenden Entwicklung. Denn die Studie liefert auch eine ganz generelle Erklärung, welche Eigenschaften ein Xe-MRT-Kontrastmittel haben muss, um noch sensitiver detektiert zu werden. „Dieses Wissen haben wir gezielt mit dem Cucurbituril ausgenutzt, es lässt sich aber auch auf noch weitere Moleküle übertragen“, sagt Physiker Kunth. „Auf jeden Fall können wir mit dem Ansatz jetzt viel sensitivere Kontrastmittel entwickeln und genau das war der Knackpunkt bei dem innovativen Bildgebungsverfahren.“
Literatur
Identification, classification, and signal amplification capabilities of high-turnover gas binding hosts in ultra-sensitive NMR
Chemical Science, 2015, 6, 6069 – 6075 (http://dx.doi.org/10.1039/C5SC01400J)
Supramolecular Assays for Mapping Enzyme Activity by Displacement-Triggered Change in Hyperpolarized 129Xe Magnetization Transfer NMR.
Angew. Chem. Int. Ed., in press, (2015) http://dx.doi.org/10.1002/anie.201507002
Kontakt:
Dr. Leif Schröder
Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP)
lschroeder@fmp-berlin.de
Tel.: 0049 30 94793-121\n
\n
Abb.: Molekulare Käfige zum temporären Einfangen von Xenon-Atomen weisen sehr unterschiedliche Austauschraten für das hyperpolarisierte Edelgas auf. Wie im Artikel von Martin Kunth et al. gezeigt, ermöglicht das kürbisförmige Cucurbit[6]uril (rechts) eine wesentlich bessere NMR-Signalverstärkung durch schnelleren Austausch als das bisher verwendete Cryptophan-A (links) (Graphik: Barth van Rossum, FMP)
\n
leben / 13.10.2015
Präventions- und Fitnesszentrum CampusVital eröffnet
Das Präventions- und Fitnesszentrum CampusVital auf dem Forschungscampus Berlin-Buch wurde am 13. Oktober 2015 eröffnet. Neben Sport- und Präventionskursen und einem Massagebereich ist das neue Fitnesscenter von Montag bis Freitag ab 7.00 Uhr geöffnet. Sowohl die Kurse, zu denen auch orthopädischer Rehasport gehört, als auch das Fitnesscenter stehen auch Bucher Bürgern offen.
\nNähere Informationen unter www.campusvital.de und Telefon: 030 - 9489 3345.
Foto: Feierliche Eröffnung des neuen Präventions- und Fitnesszentrums CampusVital. V.l.n.r.: Dr. Ulrich Scheller, Geschäftsführer der BBB Management GmbH Campus Berlin-Buch, Gesundheitsmanagerin Eileen Bauer, CampusVital und Christian Lombardt, Geschäftsführer des neuen Betreibers von CampusVital "Die Wohlfühler" (Foto: BBB Management GmbH)
\nforschen / 12.10.2015
Grüne Welle im Gehirn: Theta-Wellen koordinieren Orientierung und Bewegung
Thetawellen wurden vor fast 80 Jahren in Berlin-Buch entdeckt und geben doch bis heute Rätsel auf: Warum feuern Nervenzellen in den Gehirnen von Mensch und Tier mitunter synchron, in einem schnellen Rhythmus von 5-10 Schwingungen pro Sekunde? Thetawellen treten zum Beispiel im Navigationssystem des Gehirns, dem Hippocampus, auf. Bewegen sich Tiere oder Menschen fort, werden hier sogenannte “Ortszellen” aktiviert: Jede Position im Raum wird durch einige spezifische Ortszellen exakt kodiert. Ob die Thetawellen sich dabei auf Verhalten der Tiere während der Navigation auswirken, war bislang unbekannt.
Einem Forschungsteam am Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) und NeuroCure-Exzellenzcluster in Berlin, geleitet von Tatiana Korotkova und Alexey Ponomarenko, gelang es nun, den Theta-Rhythmus im Hippocampus von Mäusen mit Hilfe optogenetischer Methoden zu steuern. Dabei wurden die neuronalen Verbindungen, die vom Theta-Schrittmacher des Gehirns zum Hippocampus führen, mit lichtempfindlichen Proteinen ausgestattet und dann über eine optische Faser angeregt. “Es war faszinierend zu beobachten, wie dieser prominente Gehirnmechanismus seinen Rhythmus den blauen Laserstrahlen anpasste”, erinnern sich die Doktorandinnen Franziska Bender und Maria Gorbati.
Durch Steuerung mittels Licht wurden die Thetawellen gleichförmiger und stabiler, da sie weniger von anderen Reizen beeinflusst wurden. Erstmals konnte man so die Bedeutung von Thetawellen für das Verhalten der Tiere erforschen. Die erste Überraschung: Während der Lichtstimulation liefen die Mäuse bei der Erkundung eines Areals langsamer und gleichmäßiger „Man kann sich die Gehirnrhythmen als Ampeln vorstellen, die den Zellen mitteilen, wann sie an der Reihe sind, fasst Alexey Ponomarenko die Ergebnisse zusammen. „Konstantere Oszillationen wirken wie präzise wiederkehrende Grünphasen auf die Zellen.” Die zweite Überraschung: Nicht nur Areale der Großhirnrinde, sondern auch entwicklungsgeschichtlich weit ältere Hirnzentren reagierten auf die Grün- und Rotphasen der Hippocampusregion, und auch das wirkte sich auf das Verhalten der Mäuse aus. Die Thetawellen im Hippocampus werden über das Laterale Septum an den Hypothalamus weitergeleitet – eine grundlegende Schaltzentrale des Gehirns, die viele unbewusste Signale verarbeitet, was zu Empfindungen wie Hunger oder Bewegungsdrang führt. “Über viele Jahre wurde die Bedeutung der Thetawellen für die Kodierung von Raum und Zeit studiert, um unser Verständnis davon zu erweitern, wie das Gehirn unsere täglichen Erfahrungen abspeichert”, erzählt Tatiana Korotkova. “Jetzt verstehen wir, dass das Bild unserer Umgebung, welches vom Hippocampus generiert wird, von anderen Gehirnregionen abgelesen wird, die direkten Einfluss auf die Bewegungsgeschwindigkeit während der Erkundung einer Umgebung nehmen können”.
Das Gehirn setzt sich aus Netzwerken zusammen, denen höchst unterschiedliche Organisationsmechanismen zugrunde liegen, und die womöglich unterschiedliche Sprachen sprechen, aber trotzdem zusammen funktionieren, um das Überleben des Organismus zu sichern. „Es war schon bekannt, dass Netzwerke im Gehirn mittels Synchronisation miteinander kommunizieren. Wir verfügten also über eine Art rudimentäres Wörterbuch, dass allerdings noch nie getestet worden war. Mit Optogenetik ist es nun möglich, an dieser Kommunikation teilzunehmen, die genaue Bedeutung des Synchronizations-Vokabulars zu bestimmen und das Wörterbuch erweitern“, erklärt Alexey Ponomarenko. Die Wissenschaftler sind überzeugt, dass die Manipulation mit optogenetischen Methoden dabei helfen kann, Ursache und Wirkung von Gehirndynamiken und Verhalten zu entschlüsseln und unser mechanistisches Verständnis psychischer Störungen zu vertiefen.
Quelle: Franziska Bender, Maria Gorbati, Marta C. Cadavieco, Natalia Denisova, Xiaojie Gao,
Constance Holman, Tatiana Korotkova & Alexey Ponomarenko: “Theta oscillations regulate the speed of locomotion via a hippocampus to lateral septum pathway.” Nature Communications, 6:8521, DOI: 10.1038/ncomms9521, 2015
Kontakt:
Dr. Tatiana Korotkova, Dr. Alexey Ponomarenko
AG Behavioural Neurodynamics
Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP)/
NeuroCure Exzellenzcluster
Charité Campus Mitte
Dorotheenstrasse 94
10117 Berlin
Tel. +49 (0) 30 450539764
Fax. +49 (0) 30 450539964\n
Abbildung: Thetawellen im Hippocampus von Mäusen. Links das spontane Auftreten, auf der rechten Seite durch Licht gesteuerte Thetawellen, die dadurch gleichmäßiger und stabiler werden. Autor: modifiziert Bender et al, 2015.
\n
forschen / 12.10.2015
Kleine Hitzeschock-Proteine als Vorbild für Medikamente gegen Alzheimer
Kleine Hitzeschockproteine sind die „Katastrophenhelfer“ der Zelle. Bei starker Hitze oder Schädigung durch Strahlung verlieren lebenswichtige Proteine der Zelle ihre Struktur und verkleben zu einem großen Knäuel. Hat sich ein solcher Haufen einmal gebildet gibt es kein Zurück mehr – die Proteine werden unbrauchbar und die Zelle droht zu sterben. Kleine Hitzeschockproteine jedoch binden an die aus der Form geratenen Proteine bevor diese verklumpen können und halten sie in einem löslichen Zustand – solange, bis deren korrekte Form wieder hergestellt werden kann.
Vielversprechende Kandidaten für neue Therapeutika
Die Helferproteine sind bei ihrer Arbeit wahre Vielseitigkeitskünstler. Sie sind in der Lage, eine große Zahl ganz unterschiedlicher fehlgefalteter Proteine zu binden und vor dem Verklumpen zu bewahren. Hierzu gehören unter anderem auch jene potentiell krank machenden Eiweiße, die sich bei neurodegenerativen Krankheiten in der Zelle ansammeln – etwa die beta-Amyloide, die sich in den Nervenzellen von Alzheimerkranken zu langen Fibrillen zusammen lagern. Auch mit anderen Erkrankungen des Nervensystems wie der Parkinson Krankheit oder Multiple Sklerose werden kleine Hitzeschockproteine in Verbindung gebracht.
Zwar ist noch unklar, welche Rolle die Katastrophenhelfer in den einzelnen Krankheitsbildern genau spielen. Bereits jetzt werden sie jedoch als Vorbild für Wirkstoffe neuer Medikamente diskutiert. Wäre der genaue Mechanismus, mit dem die kleinen Hitzeschockproteine an ihre krank machenden Partner binden bekannt, könnten Wissenschaftler dieses Wissen dazu nutzen um Wirkstoffe zu entwickeln, die diesen Mechanismus verwenden, um die Krankheiten zu bekämpfen.
Zwei Wege gegen das Chaos
Nun ist es Forschern um Bernd Reif, Professor an der Fakultät für Chemie der Technischen Universität München (TUM) und Gruppenleiter am Helmholtz-Zentrum München, gelungen, genau diesen Mechanismus aufzuklären. Mit Hilfe einer verfeinerten Technik der Festkörper-Kernspinresonanzspektroskopie (Festkörper-NMR) konnten sie im kleinen Hitzeschockprotein alpha B-Crystallin erstmals jene Stellen identifizieren, mit denen das Protein an das beta-Amyloid bindet.
Es ist die erste direkte Strukturanalyse eines vollständigen kleinen Hitzeschockproteins in Interaktion mit einem Bindungspartner, denn die Katastrophenhelfer machen es ihren Beobachtern nicht leicht. „Alpha B-Crystallin liegt in mehreren Formen gleichzeitig vor, die aus 24, 28, oder 32 Untereinheiten bestehen und in denen fortlaufend Einheiten ausgetauscht werden“, erklärt Reif. „Außerdem hat es ein großes Molekulargewicht. All diese Faktoren machen eine Strukturanalyse sehr schwierig.“
In enger Zusammenarbeit mit den TUM-Kollegen Johannes Buchner, Professor für Biotechnologie und Sevil Weinkauf, Professorin für Elektronenmikroskopie fand Reif heraus, dass das kleine Hitzeschockprotein für Wechselwirkungen mit dem beta-Amyloid eine bestimmte unpolare beta-Faltblatt Struktur in seiner Mitte benutzt und auf diese Weise an gleich zwei Stellen in dessen Aggregationsprozess eingreifen kann: Zum einen bindet es an einzelne gelöste beta-Amyloide und verhindert, dass sich diese zu Fibrillen zusammen lagern. Zum anderen „versiegelt“ es bereits bestehende Fibrillen, so dass sich hier keine weiteren Amyloide mehr anlagern können.
Vorlage zum Bau künstlicher Proteine
Das Wissen über den genauen Bindemechanismus des alpha B-Crystallins an das Alzheimer- Protein ist besonders für jene Forscher interessant, die es sich zum Ziel gesetzt haben mit Hilfe sogenannter „Protein Engineering“ Methoden neue Wirkstoffe zu entwickeln, die spezifisch an das beta-Amyloid und ähnliche Proteine binden. Würde man das neu gefundene beta-Faltblatt Motiv als Baustein in solche künstlich entworfenen Proteine einbauen, könnte deren Bindefähigkeit an die krank machenden Fibrillen verbessert werden – ein erster Schritt zu neuen Wirkstoffen gegen Alzheimer und andere neurodegenerative Krankheiten.
In zukünftigen Arbeiten wollen sich die Wissenschaftler um Reif die N-terminale Region des αB-Crystallins näher ansehen. Sie bindet - das haben Reif und seine Kollegen herausgefunden - jene Proteintypen, die sich anders als das beta-Amyloid ungeordnet zusammen lagern. Helfen wird den Forschern dabei ein neues NMR Zentrum, das derzeit am Campus Garching der Technischen Universität München entsteht und 2017 eingeweiht werden wird. Ein weiteres 5 Millionen Euro teures Gerät, das speziell auf Festkörper-NMR Methoden ausgerichtet ist, wird derzeit am Helmholtz-Zentrum in Neuherberg eingerichtet.
Publikation:
Andi Mainz, Jirka Peschek, Maria Stavropoulou, Katrin C. Back, Benjamin Bardiaux, Sam Asami, Elke Prade, Carsten Peters, Sevil Weinkauf, Johannes Buchner, Bernd Reif: The Chaperone alpha B-Crystallin Deploys Different Interfaces to Capture an Amorphous and an Amyloid Client,
Nature Structural Molecular Biology.
Kontakt:
Prof. Dr. Bernd Reif
Technische Universität München
Fachgebiet Festkörper-NMR-Spektroskopie
Lichtenbergstr 4, 85747 Garching, Germany
Tel.: +49 89 289 13667 – E-Mail: bernd.reif@helmholtz-muenchen.de
Web: http://www.ocb.ch.tum.de
\n
Abbildung: Räumliche Struktur des alphaB-Crystallins, eine hexamere Untereinheit ist farblich heraus gehoben (Bild: Andi Mainz / TUM)
\n
forschen / 09.10.2015
„Unermüdliches Hören“ – eine molekulare Reinigungsmaschine regeneriert die Synapsen für die kontinuierliche Freisetzung von Botenstoff
Hörforscher entdecken Flaschenhals der Informationsübertragung beim Hören und bahnen Weg zur Gentherapie der Schwerhörigkeit. Publikation in der Fachzeitschrift „EMBO Journal“.
\n
Etwa 360 Millionen Menschen – 5 Prozent der Weltbevölkerung – leiden nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an einer maßgeblichen Schwerhörigkeit. Noch ist wenig über die Funktion des Innenohrs bekannt, es gibt noch keinen ursächlichen Therapieansatz für die Innenohrschwerhörigkeit. Göttinger und Berliner Wissenschaftler sind nun dem Verständnis von Hören wie der Behandlung der Schwerhörigkeit einen großen Schritt nähergekommen. Sie zeigen, dass die Interaktion zwischen einem für die Wiederverwertung von Eiweißen und Lipidmembranen verantwortlichen Adapterprotein und dem bei einigen Formen der Taubheit gestörten Freisetzungsfaktor Otoferlin einen Prozess beschleunigt, der kritisch für die unentwegte synaptische Übertragung von Hörinformation ist. Fehlt der Adapter, kommt es an den Freisetzungsstellen offenbar zum „Stau“, die Übertragung wird verlangsamt und eine Schwerhörigkeit entsteht. Mittels viraler Genfähren gelang es den Forschern, das normale Hören im Mausmodell wiederherzustellen. Sie haben dadurch die Grundzüge für eine Gentherapie der Schwerhörigkeit im Tiermodell aufgezeigt.
Die Forschungserkenntnisse sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit im Sonderforschungsbereich (SFB) 889 „Zelluläre Mechanismen der Sensorischen Verarbeitung“ von Arbeitsgruppen der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) mit Gruppen der Universität Göttingen, der Max-Planck-Institute für Dynamik und Selbstorganisation und für Experimentelle Medizin in Göttingen sowie des Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie in Berlin. Publiziert wurden die Forschungsergebnisse in der renommierten Fachzeitschrift EMBO Journal.
Die Umwandlung von akustischer Information in ein Nervensignal erfolgt an speziellen Kontaktstellen, den so genannten Bändersynapsen, zwischen Haarsinneszellen und Hörnervenzellen im Innenohr. Die beachtliche Übertragungsrate dieser Synapse liegt bei hunderten Signalen pro Sekunde. Dies erfordert die hoch-koordinierte Bereitstellung, Fusion und „Entsorgung“ von Botenstoffbläschen an der aktiven Zone der Botenstofffreisetzung. Für diese bemerkenswerte Spitzenleistung wird das „Hörgen“ Otoferlin benötigt, aber die zugrundeliegenden Interaktio-nen von Otoferlin mit anderen Bestandteilen der Synapse sind noch nicht verstanden.
Schneller Nachschub erfordert effiziente Entsorgung
Was begrenzt die Rate der Übertragung an der Haarzellsynapse und wie fördert Otoferlin die unermüdliche Botenstofffreisetzung? An jeder der nur etwa einen halben millionstel Meter großen aktiven Zonen können während der Stimulation vermutlich zirka 1.000 Bläschen pro Sekunde ihre Botenstoffe freisetzen. Das machen sie, indem sie mit der aktiven Zone verschmelzen. Dieses hohe „Verkehrsaufkommen“ bedingt, dass sehr viel Eiweiß und Lipidmembran aus den Bläschen in die Zellmembran der aktiven Zone gelangen. Die gestrandeten Eiweiß- und Lipidmoleküle müssen rasch abtransportiert werden, damit neue Bläschen an die Freisetzungsstellen der aktiven Zone andocken können (Abb. 1). Wie genau diese „Reinigung“ der Freisetzungsstellen geschieht, war bisher jedoch unklar.
Mit Hilfe genetisch veränderter Mäuse, denen das Adapter-Eiweiß AP-2µ fehlt, haben die Göttinger und Berliner Forscher nun herausgefunden, dass genau dieses Eiweiß bei der „Reinigung“ der Freisetzungsstellen eine wichtige Rolle spielt. Fehlt den Haarsinneszellen das Adapter-Eiweiß AP-2µ, sind die Tiere hochgradig schwerhörig. Diese Schwerhörigkeit ergibt sich aus einem mangelnden Nachschub an freisetzungsbereiten Botenstoffbläschen wie mit mehreren experimentellen und mathematischen Methoden nachgewiesen wurde. Dr. Carolin Wichmann, Gruppenleiterin am Institut für Auditorische Neurowissenschaften an der UMG und eine der Erstautoren, sagt: „Überrascht waren wir davon, dass die Verminderung der Freisetzung bereits 20 tausendstel Sekunden nach Beginn der Stimulation sichtbar war. Bislang dachte man, dass AP-2 nur eine Rolle bei der deutlich langsameren Wiederherstellung von Botenstoffbläschen spielt.“ Um den zugrundeliegenden Mechanismus und die Rolle von AP-2 für die Funktion der Haarzellsynapse zu ergründen, untersuchten die Wissenschaftler die Interaktion von AP-2 mit synaptischen Proteinen und fanden eine Bindung an Otoferlin, dem selbst eine Rolle beim Nachschub von freisetzungsbereiten Botenstoffbläschen zugeschrieben wird. Dr. Tanja Maritzen, Gruppenleiterin am Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie und eine der Erstautoren, sagt: „Wir fanden heraus, dass AP-2 und Otoferlin über mindestens zwei Kontaktstellen aneinander binden und dass AP-2 für die Verfügbarkeit von Otoferlin von großer Bedeutung ist.“
Aber wie kann die Interaktion dieser beiden Eiweiße den Nachschub von freiset-zungsbereiten Botenstoffbläschen fördern? Dr. Andreas Neef, Gruppenleiter am Göttinger Bernstein Zentrum für Theoretische Neurowissenschaften und am Max-Planck-Institut (MPI) für Dynamik und Selbstorganisation, sagt als einer der korrespondierenden Autoren: „Mit der Kombination systemphysiologischer Messungen der synaptischen Freisetzung an einzelnen aktiven Zonen und mathematischer Modellbildung konnten wir nahelegen, dass AP-2 durch seine Bindung an Otoferlin die „Reinigung“ der Freisetzungsstellen beschleunigt.“ Nach Ansicht der Wissenschaftler wird auf diese Weise das freigesetzte Material schneller von der aktiven Zone entfernt, so dass dort neue Botenstoffbläschen für die nächste Runde der Freisetzung andocken können (Abb. 1). Fehlt AP-2 oder Otoferlin, kommt es quasi zum „Stau“ und das Hören ist gestört.
Die Studie ist zudem eine der weltweit ersten, die im Tiermodell demonstriert, dass defekte Gene prinzipiell mit Hilfe unschädlicher Viren ersetzt werden können. Dr. SangYong Jung, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Auditorische Neurowissenschaften an der UMG und Erstautor, sagt: „Wenn wir Viren, die die Erbinformation für AP-2µ enthielten, in die Hörschnecke der tauben Mäuse einbrachten, konnten wir die Funktion der Haarzellsynapsen und das Hören nahezu vollständig wiederherstellen.“ Die Leiter der Studie, Prof. Volker Haucke (Direktor des Leibniz-Instituts für Molekulare Pharmakologie und Professor an der Freien Universität Berlin) und Prof. Tobias Moser (Direktor des Instituts für Auditorische Neurowissenschaften der UMG und Max-Planck-Fellow an den MPIs für Biophysikalische Chemie und Experimentelle Medizin), sind sich einig, dass diese Studie ein wichtiger Durchbruch im Verständnis der Funktion von AP-2 und der synaptischen Übertragung ist und zugleich den Weg bahnt für die zukünftige Gentherapie am Menschen.
Prof. Haucke: „Das Hochleistungssystem der Haarzellsynapse hat uns ermöglicht, die Rolle von AP-2 an der aktiven Zone besser zu verstehen. AP-2 und Otoferlin arbeiten quasi als „Reinigungs-Team“, um die für das Hören erforderlichen spektakulären Übertragungsraten zu realisieren.“ Prof. Moser ergänzt: „Auch wenn bislang keine humane Schwerhörigkeit bekannt ist, die aus Defekten des AP-2 Gens resultiert, macht diese Studie Hoffnung, dass die viral-vermittelte Gentherapie in absehbarer Zeit möglich werden kann. So sind das fast normale Hören des behandelten Ohres und das Ausbleiben einer Virus-Ausbreitung (etwa in das andere Ohr) starke Indizien dafür, dass eine frühzeitige Behandlung eine Auswahl genetischer Schwerhörigkeiten effizient bekämpfen kann. Die Studie zeigt auch, wie die interdisziplinäre Zusammenarbeit etwa im Göttinger Sonderforschungsbereich 889 „Zelluläre Mechanismen sensorischer Verarbeitung“ der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und darüberhinaus wichtige Durchbrüche erreichen kann“.
\n
Abb.: „Reinigung“ der Freisetzungsstellen für synaptische Bläschen an der Bänder-Synapse. Nach dem Verschmelzen synaptischer Bläschen (rosa) mit der Zellmembran wird durch Interaktion von AP-2 (grün) mit Otoferlin (rot) ein schnellerer Abtransport von Eiweiß und Lipidmembran von der Freisetzungsstelle an der aktiven Zone ermöglicht. (Abb.: Jung et al., EMBO J 2015)
forschen, leben, bilden / 09.10.2015
Experimente, Austausch und ausgezeichnete Preise
Berlin, 9. Oktober – Auf dem Campus Berlin-Buch treffen sich heute 250 Lehrkräfte aus dem Bereich Naturwissenschaften, um neue Impulse für einen attraktiven Schulunterricht zu erhalten. Die NORDOSTCHEMIE bietet über 30 Workshops, Führungen und Vorträge an. Die Teilnehmer erwarten in den Laboren der Wissenschaftler die unterschiedlichsten Themen von der Energiewende, Seltenen Erden, Fluoreszenzfarbstoffen bis hin zum chemischen Sinnesrausch der Schokolade. Ermöglicht wird dies auch durch die Kooperationspartner des Kongresses: der Campus Berlin-Buch, das Gläserne Labor zusammen mit weiteren Schülerlaboren aus dem Netzwerk GenaU, das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft und das Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie sowie 20 weiteren Akteuren.
Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung ist die symbolische Urkundenübergabe an die elf Berliner Projekte, welche die Bayer Science & Education Foundation in diesem Jahr mit einem Gesamtfördervolumen von rund 56.000 Euro in ihr Schulförderprogramm aufgenommen hat. Folgende Initiativen wird Thimo V. Schmitt-Lord, Vorstand der Bayer-Stiftungen, auszeichnen:
• Grundschule im Eliashof, Projekt „Es wa(h)r einmal… Naturwissenschaften im Märchen“, 5.543 Euro
• Merian-Schule, Projekt „Experimentieren für Grundschüler“, 2.412 Euro
• Grundschule am Schäfersee, Projekt „Praxisorientiertes Lernen in der Grundschule: Spiel, Lernspaß, Technik“, 5.641 Euro
• Carl-Kraemer-Oberschule, Projekt „Mikroskopieren - die Welt des Kleinen für unsere Kleinen“, 1.500 Euro
• Hermann-Hesse-Schule, Projekt „Chemische Show- und Schulversuche im Film“, 1.348 Euro
• Schülerlabor-Netzwerk GenaU, Projekt „Experimente mit Herz - Körperbiologie und Gesundheit im MINT-Unterricht“, 12.000 Euro
• Gottfried-Keller-Gymnasium, Projekt „Luft in unseren Klassenräumen - Mehr Sauerstoff für's Denken“, 7.613 Euro
• Albert-Einstein-Oberschule, Projekt „Gewässeruntersuchungen in Berlin - Integration durch gemeinsame Experimente“ (in italienischer Sprache), 1.000 Euro
• Das Schiff e.V., Projekt „Gefährdungspotenziale für das Oberflächenwasser - Gefahr für Mensch und Natur am Beispiel Tegeler See“, 5.837 Euro
• Schulfarm Insel Scharfenberg, Projekt „Lernende entdecken die Insel im Unterricht“, 3.595 Euro
• Kinderforschungszentrum HELLEUM, Projekt „Verbesserung der didaktischen Rahmenbedingungen für ein innovatives MINT Bildungsangebot“, 9.316 Euro
„Mit ihren außergewöhnlichen naturwissenschaftlichen Unterrichtsangeboten fördern die ausgewählten Projekte kleine Entdecker und Erfinder“, sagt Thimo V. Schmitt-Lord. „Damit legen engagierte Lehrkräfte gezielt den Grundstein für eine erfolgreiche Schul- und Berufslaufbahn von Kindern und Jugendlichen. Diese Form von innovativem Unterricht unterstützt die Bayer-Stiftung - denn die Bildung junger Menschen gehört zu den wichtigsten Aufgaben, um die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zu sichern.“
Für den Hauptgeschäftsführer der NORDOSTCHEMIE, Dr. Paul Kriegelsteiner, ist der Kongress einer der Höhepunkte des Jahres. Daher lässt er es sich auch nicht nehmen, die Lehrkräfte an diesem Tag persönlich zu begrüßen. „Engagierte Lehrerinnen und Lehrer verdienen es, dass ihr Einsatz weiter gefördert wird. Wir wollen sie wertschätzen und durch gute Fortbildungen in ihrer täglichen Arbeit unterstützen“, sagt Kriegelsteiner. Er freut sich auch über die große Zahl an mitwirkenden Partnern: „Ein solches Aufgebot ist sicherlich einzigartig. Wir haben hier die geballte Kompetenz aus dem Bereich MINT versammelt. Und das an einem Standort, der weltweit für seine Forschung bekannt ist.“
Die Teilnehmer sind nicht nur Berliner, auch aus allen fünf ostdeutschen Ländern sind Lehrkräfte aller Schulformen in die Hauptstadt gereist. Sie nutzen die Gelegenheit, neue Erkenntnisse zu sammeln und sich unter anderem über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in der Chemie zu informieren.
Informationen über NORDOSTCHEMIE\n
Die Chemie- und Pharmabranche in Ostdeutschland hat über 58.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die NORDOSTCHEMIE ist die wirtschafts- und sozialpolitische Interessenvertretung der über 300 Mitgliedsunternehmen. Zur NORDOSTCHEMIE gehören der Arbeitgeberverband Nordostchemie e.V. (AGV Nordostchemie), der Verband der Chemischen Industrie e.V. – Landesverband Nordost – (VCI LV Nordost) und seine Fachverbände. Hauptsitz ist Berlin, weitere Geschäftsstellen sind in Dresden und Halle.
Die Schulförderung bei Bayer
Die Förderung der Schulbildung in Deutschland ruht bei Bayer auf drei Säulen: Das Schulförderprogramm der Bayer-Stiftung unterstützt gezielt Schulen im Umfeld der deutschen Konzern-Standorte. Um Bildungschancen für Jugendliche zu verbessern, vergibt sie darin jedes Jahr projektbezogene Fördermittel für einen attraktiven naturwissenschaftlichen Unterricht in Höhe von insgesamt bis zu 500.000 Euro. Nächster Bewerbungsschluss für das Programm ist der 5. Februar 2016. Eine Bewerbung ist online möglich unter: https://secure.bayer.com/foundations/BewerbungSchulfoerderung.aspx
In eigenen Schülerlaboren – den so genannten "BayLabs" – ermöglicht das Unternehmen Schülern, eigenständig unter professioneller Anleitung spannende Experimente zu den Themen Gesundheit, Pflanzen und Materialien auszuführen und dadurch die praktische Wissenschaft hautnah kennen zu lernen.
Kooperationspartner von A – Z
Bayer Pharma AG
Bayer Stiftungen – Bayer Science & Education Foundation
Biologie trifft Technik – Technische Hochschule Wildau
Campus Berlin-Buch – BBB Management GmbH
dEIn Labor – Technische Universität Berlin
DLR_School_Lab Berlin – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.
Extavium – Das wissenschaftliche Mitmachmuseum
Gläsernes Labor – Campus Berlin-Buch
Humboldt-Bayer-Mobil
iMINT-Akademie – Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft
Kinderforschungszentrum HELLEUM
Lehrerfortbildungszentrum Chemie – Universität Rostock
Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie im Forschungsverbund Berlin e.V.
Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft
MicroLAB – Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik
Museum für Naturkunde Berlin
NatLab – Freie Universität Berlin
Netzwerk GenaU – Schülerlabore in Berlin und Brandenburg
PhysLab – Freie Universität Berlin
Schülerforschungszentrum Berlin – Lise-Meitner-Schule Berlin
Science on Stage Deutschland
Science on Tour – Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
UniLab Adlershof – Humboldt-Universität zu Berlin
Verband der Chemischen Industrie e.V., Landesverband Nordost – NORDOSTCHEMIE
\n
Quelle: Verband der Chemischen Industrie e.V., Landesverband Nordost
heilen / 08.10.2015
Mehr Sicherheit für Mutter und Kind – HELIOS Klinikum Berlin-Buch als erste Klinik in Berlin-Brandenburg im Bereich der Frühgeborenenversorgung erfolgreich zertifiziert
Vor allem Risikoschwangere und kleinste Frühgeborene werden hier auf höchstem medizinischem Niveau versorgt, 2014 kamen in der Klinik 67 Frühgeborene unter 1500 Gramm zur Welt, 2015 bislang 55.
In einem Perinatalzentrum Level 1, der höchsten Versorgungsstufe, werden neben normal verlaufenden Schwangerschaften insbesondere Frauen mit Risikoschwangerschaften und Frühgeborene versorgt. Die so genannten "Level-1-Zentren" dürfen Frühgeborene unter einem Schwangerschaftsalter von 29 Wochen entbinden. Etwa zehn Prozent der Neugeborenen kommen zu früh, oft bereits in der 23. Schwangerschaftswoche, zur Welt oder bedürfen nach einer schwierigen Schwangerschaft und Geburt in den ersten Stunden und Wochen intensiver ärztlicher und pflegerischer Betreuung.
Das Perinatalzentrum des HELIOS Klinikums Berlin-Buch wurde nun am 1. Oktober 2015 als erste Klinik in Berlin und Brandenburg als Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe (Level 1) erfolgreich zertifiziert.
„Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir mit der Zertifizierung den hohen Standard unseres Perinatalzentrums bestätigen konnten“, sagt Professor Dr. med. Lothar Schweigerer, Chefarzt der Klinik für Kinder-und Jugendmedizin und Leiter des Perinatalzentrums. „Das ist eine wichtige Anerkennung unserer Arbeit und Aufgabe, die Versorgung von Risikoschwangeren und Frühgeborenen aus Berlin und Brandenburg in unserem Klinikum umfassend und bestmöglich sicher zu stellen.“
In einer mehrtägigen Begutachtung durch externe Experten mussten die umfangreichen Anforderungen von der unabhängigen Firma periZert an Anzahl und Qualifikation der ärztlichen Mitarbeiter, das Pflegefachpersonal und die Hebammen genauso nachgewiesen werden wie optimale räumliche und medizintechnische Voraussetzungen.
Unter anderem wurden ein zentraler Maßnahmenplan mit Verantwortlichkeiten und Abläufen eingeführt sowie ein gemeinsames Dokumentenmanagementsystem, auf das Geburtshilfe und Neonatologie rund um die Uhr Zugriff haben. Neben der Kontrolle von Qualitätsstandards ist die Zertifizierung ein Weg, um Problem- und möglicherweise Gefahrensituationen rechtzeitig zu erkennen und entsprechend optimal zu handeln.
„Der Erfolg unseres Perinatalzentrums basiert im Wesentlichen auf drei Faktoren: Der ausgezeichneten Ausbildung unserer Ärzte, Hebammen und Schwestern mit ausgezeichneter Kommunikation an den Schnittstellen Geburtshilfe, Kinderheilkunde und Anästhesie, sowie den niedergelassenen Frauenärzte, der hochmodernen apparativen Ausstattung und letztendlich der Empathie für die Betreuung schwangerer Frauen, insbesondere auch von Risikoschwangeren und deren Kindern.“, erklärt Prof. med. Michael Untch, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe.
Hintergrundinformation zum Perinatalzentrum Level 1:
Um als Perinatalzentrum Level 1 anerkannt zu werden, muss in einer Klinik neben einem hochmodernen Kreißsaal und einer Station für Risikoschwangere, eine eigenständige neonatologische Abteilung und eine kinderchirurgische Abteilung vorhanden sein. Die Ärzte und das Pflegepersonal haben entsprechende Zusatzqualifikationen in den Bereichen „Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin“, „Neonatologie“ und „Pädiatrische Intensivpflege“ erworben. Des Weiteren müssen sich der Entbindungsbereich, der Kreißsaal- OP, die neonatologische Intensivstation und die Kinderchirurgie in unmittelbarer räumlicher Nähe befinden. Darüber hinaus sind mindestens sechs neonatologische Intensivtherapieplätze Pflicht, sowie eine 24-Stunden Präsenz von Geburtshelfern, Neonatologen und pflegerischem Fachpersonal.
Foto: Das Team des Perinatalzentrums um Klinikgeschäftsführer Dr. Sebastian Heumüller; Prof. Dr. med. Michael Untch, Leiter interdisziplinäres Brustzentrum und Prof. Dr. med. Lothar Schweigerer, Chefarzt Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (Foto: HELIOS Kliniken/ Thomas Oberländer)
investieren, produzieren / 08.10.2015
Merck Millipore geht Kollaboration mit celares GmbH ein und ergänzt mit Protein-PEGylierung sein Serviceportfolio für die biopharmazeutische Industrie
- \n
- Der Service beinhaltet Durchführbarkeitsstudien, Entwicklung von PEGylierungsprozessen und analytischer Methoden sowie Scale-up \n
- Das Angebot umfasst den Bereich von Milligramm bis zum transferbereiten Prozess an Lohnhersteller für kommerzielle Mengen \n
- PEGylierung hilft pharmakologische und physikochemische Herausforderungen zu meistern und beschleunigt die Markteinführung von therapeutischen Proteine \n
\n
Millipore, eine Sparte der Merck KGaA, kündigte im Juli 2015 die Zusammenarbeit mit der celares GmbH an, um Produkte und Dienstleistungen in der PEGylierung für therapeutische Proteine und Biosimilars anzubieten. Die Zusammenarbeit erweitert das Serviceangebot von Merck Millipore, das Durchführbarkeitsstudien, Prozess- und analytische Entwicklung sowie Scale-up für frühe Entwicklungsprojekte bis hin zu anschließender kommerzieller Nutzung umfasst.
\n
PEGylierung ist die chemische Konjugation von Polyethylenglykol-Polymeren an ein Wirkstoffmolekül und kann so die pharmakologischen und physikochemischen Eigenschaften von therapeutischen Peptiden und Proteinen drastisch verbessern und Nebeneffekte verringern. Dieses etablierte Konzept kann die Stabilität, Bioverfügbarkeit und Löslichkeit des Wirkstoffmoleküls verbessern und damit häufig auftretende Herausforderungen in der biopharmazeutischen Entwicklung lösen.
"Obwohl PEGylierung eine etablierte Methode ist, um gezielte Wirkstofffreisetzung zu erreichen, ist deren Erfolg stark beeinflusst von der angewandten Synthese-Strategie. Diese erfordert viel Erfahrung und detailliertes Fachwissen", sagt Andrew Bulpin, Executive Vice President von Process Solutions, Merck Millipore. „celares ist ein anerkannter und führender Spezialist auf diesem Gebiet. Durch unsere Zusammenarbeit können wir nun unseren biopharmazeutischen und Biosimilar-Kunden auch Konjugation anbieten. Damit unterstützen wir sie bei der Optimierung ihrer therapeutischen Proteine und einer schnelleren Markteinführung."
Das neue Angebot erweitert Merck Millipore's breites Spektrum an funktionalisierten PEGs, sowie Puffern, Lösungsmitteln und anderen Hilfsstoffen. Außerdem werden Prozessstufen für den Einsatz während des PEGylierungsprozesses und anschließender Reinigungsschritte inklusive Tangential- und Normal Flow-Filtration sowie Chromatographie angeboten.
"Eine optimierte Formulierung hilft, dass ein vielversprechendes therapeutisches Protein das klinische Stadium und den Patienten erreicht", sagt Dr. Frank Leenders, Managing Director Operations, celares GmbH. „Die Verbindung unseres Fachwissens mit den integrierten Produkten und der Expertise von Merck Millipore bietet kundenspezifische Lösungen für die biopharmazeutische Industrie, um die Weiterentwicklung vielversprechender Arzneimittelkandidaten zu ermöglichen."
Weitere Informationen finden sie unter: http://www.merckmillipore.com/DE/en/small-molecule-pharmaceuticals/drug-delivery/activated-pegs/OVab.qB.KKsAAAFDc1JZXuRT,nav.
Merck Millipore
Merck Millipore ist der Life-Science-Geschäftszweig von Merck, Darmstadt, Deutschland. Als Teil des globalen Life-Science-Geschäfts von Merck bietet Merck Millipore eine breite Palette an innovativen Leistungsprodukten und Dienstleistungen an, die den Kunden in der Biotech- und Pharmaindustrie bei der Forschung, Entwicklung und Produktion zum Erfolg verhelfen. Durch engagierte Mitwirkung an neuen wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen und als einer der drei führenden F&E-Investoren für Produkte in der Life-Science-Industrie ist das Life-Science-Geschäft von Merck ein strategischer Partner, der den Fortschritt im zukunftsträchtigen Life-Science-Bereich fördert. Das globale Geschäft hat seinen Hauptsitz in Billerica im US-Bundesstaat Massachusetts, beschäftigt etwa 10.000 Mitarbeiter in 66 Ländern und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 ein Umsatzvolumen von 2,7 Milliarden Euro. Merck Millipore ist in den USA und in Kanada unter der Dachmarke EMD Millipore tätig.
Weitere Informationen finden Sie hier: www.merckmillipore.com
\n
Merck
Merck ist ein führendes Unternehmen für innovative und hochwertige Hightech-Produkte in den Bereichen Pharma und Chemie. Mit seinen vier Sparten Merck Serono, Consumer Health, Performance Materials und Merck Millipore erwirtschaftete Merck im Jahr 2013 Gesamterlöse von rund 11,1 Mrd €. Rund 39.000 Mitarbeiter arbeiten für Merck in 66 Ländern daran, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, den Erfolg seiner Kunden zu steigern und einen Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen zu leisten. Merck ist das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt – seit 1668 steht das Unternehmen für Innovation, wirtschaftlichen Erfolg und unternehmerische Verantwortung. Die Gründerfamilie ist bis heute zu rund 70 Prozent Mehrheitseigentümerin des Unternehmens. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Ausnahmen sind Kanada und die USA, wo das Unternehmen unter der Marke EMD bekannt ist.
Weitere Informationen finden Sie hier: www.merckgroup.com
celares, Berlin, Germany
celares, GmbH, Berlin, Deutschland, ist ein international anerkanntes, inhabergeführtes Unternehmen im Bereich der PEGylierung und der chemischen Modifikation von Biopharmazeutika. Die angebotenen Dienstleistungen zeichnen sich durch ihre hohe Qualität aus und werden kundenspezifisch konzipiert. Das Dienstleistungsspektrum umfasst Machbarkeitsstudien, Prozessentwicklung, Skalierung sowie die Entwicklung und Validierung der benötigten analytischen Methoden. Zusätzlich bietet celares ihre Kunden die Herstellung von Pilotchargen für die präklinische Entwicklung an und führt Stabilitätsstudien gemäß ICH Richtlinien durch. Langjährige Erfahrungen und die wissenschaftliche Exzellenz der celares im Bereich der PEGylierung tragen dazu bei, die Entwicklungszeiten der Kundenprojekte signifikant zu verkürzen.
SOURCE Merck Millipore
RELATED LINKS
http://www.merckmillipore.com
Quelle: www.prnewswire.com
investieren, produzieren / 08.10.2015
Schweizer Blutplasmaspezialist OCTAPHARMA investiert 80 Millionen Euro in ELSA Portfoliounternehmen Glycotope
Die Transaktion zeigt, dass in der Umsetzung von Erkenntnissen der modernen Biotechnologie enorme Wertschöpfungspotenziale stecken. Glycotope hat in letzten Jahren schon über 100 Millionen Euro vorwiegend von den Münchener Investoren Gebrüder Strüngmann für die Entwicklung neuer Krebsmedikamente akquirieren können und gehört damit zu den größten unabhängigen europäischen
Medikamentenentwicklern.
ELSA, eine Tochter der Eckert Wagniskapital und Frühphasen- finanzierung GmbH, sieht ihr Geschäftsmodell durch den Einstieg von Octapharma erneut bestätigt. Der Ansatz, mit engagierten Wissenschaftlern kleine Firmen zu gründen und anzufinanzieren, steht dabei weder von den Renditen noch vom Transaktionsvolumina oder der volkswirtschaftlichen Bedeutung her hinter etwa den boomenden Digitalgründungen zurück.
\nZur Pressemeldung der Glycotope zu der Transaktion mit weiterem Hintergrundmaterial geht es hier.
\n
Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:
ELSA Eckert Life Science Accelerator GmbH, Karolin Riehle, Öffentlichkeitsarbeit
Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@dont-want-spam.ezag.de,
forschen / 08.10.2015
Helmholtz International Fellow Award für britische Zellbiologin Prof. Amanda Fisher – Preisverleihung im Max-Delbrück-Centrum
Im Mittelpunkt der Forschungen von Prof. Fisher steht die Genregulation, ein fundamentaler Lebensprozess, der jede biologische Funktion einschließlich der Zellteilung, Zelldifferenzierung und Regeneration steuert. Prof. Fisher, die seit den 1980er Jahren in der Forschung tätig ist, hat sich auf diesem Gebiet international einen Namen gemacht. Dazu gehören ihre grundlegenden Erkenntnisse über den Krankheitsmechanismus des AIDS-Virus HIV und über die Regulation einiger HIV-Gene. Prof. Fisher gilt auch als Expertin für die epigenetische Genregulation, bei der molekularbiologische Informationen, die nicht in der DNA enthalten sind, bestimmen, welche Gene angeschaltet werden und welche stumm bleiben. Sie arbeitet auch über die Entwicklung der T-Zellen des Immunsystems und über embryonale Stammzellen.
Prof. Fisher ist eine von zwei Leitern der Forschungsgruppe „Lymphozytenentwicklung“ am MRC (Medical Research Council) Clinical Sciences Centre (CSC), das Teil des Institute for Clinical Sciences (ICS) am Imperial College London ist, dessen Direktorin sie ist. Darüber hinaus ist sie Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung/Berlin Institute of Health (BIH), welches das MDC und die Charité – Universitätsmedizin Berlin 2013 gegründet haben. Diese Einrichtungen wollen innovative biomedizinische Forschung in die klinische Forschung übertragen und verfolgen auch einen ganzheitlichen, systemmedizinischen Forschungsansatz.
Für ihre außerordentlichen Verdienste in der biomedizinischen Forschung wurde Prof. Fisher 2014 zum Mitglied der Royal Society gewählt. 2010 erhielt sie den „Women of Outstanding Achievement in SET (Science, Engineering & Technology) Award“, 2003 wurde sie zum Mitglied der Akademie der Medizinischen Wissenschaften von Großbritannien gewählt und 2002 erhielt sie die Goldmedaille der Europäischen Molekularbiologischen Organisation (EMBO).
Zusammen mit den Preisträgern dieser Auswahlrunde haben seit 2012 inzwischen 43 Fellows den Helmholtz International Fellow Award erhalten.\n
Foto: Helmholtz International Fellow Award für die britische Zellbiologin Prof. Amanda Gay Fisher vom Imperial College (ICL) London, mit Prof. Thomas Sommer, Vorstand (komm.) des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) nach der Preisverleihung am 6. Oktober 2015. (Foto: Steffen Weigelt/ Copyright: MDC)
forschen, produzieren, leben, heilen / 08.10.2015
CampusVital startet mit neuem Betreiber und größerem Angebot
\n
Beispielgebender Weg für gemeinsames Gesundheitsmanagement
\nDas GesundheitsTicket wird bereits vom Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin, dem Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie, der Charité sowie sechs Firmen erfolgreich genutzt. Die Techniker Krankenkasse, die bereits das Pilotprojekt unterstützt hat, wird den Campus auch in der neuen Phase fördern. "Ein Betriebliches Gesundheitsmanagement mit gemeinsamen Leitlinien und Angeboten aufzubauen, die von allen Einrichtungen und Unternehmen genutzt werden können, ist ein ganz neuer, beispielgebender Weg", erklärt Christian Lombardt, Geschäftsführer des Unternehmens Die Wohlfühler.
Die Leitung von CampusVital hat Diplom-Sportlehrerin Eileen Bauer übernommen. Sie koordiniert das Angebot und unterstützt die Forschungsinstitute und Firmen dabei, ein das gemeinsames Betriebliches Gesundheitsmanagement zu entwickeln. "Wir werden unser Angebot noch ausbauen. Geplant sind Kurse für Stressmanagement, Schulungen für Führungskräfte und Ernährungsworkshops", so Eileen Bauer. Zum Auftakt veranstaltet CampusVital in Zusammenarbeit mit der AOK am 29. Oktober 2015 einen "Tag der gesunden Ernährung".
\n\n
Die Eröffnung des Fitness- und Präventionszentrums Campus Vital findet am 13. Oktober 2015 statt.
\n\n
Foto: Gesundheitsmanagerin Eileen Bauer (Foto: Christine Minkewitz/BBB Management GmbH)
\n
forschen / 02.10.2015
Große Augen – MDC-Forscher klären Ursache genetischer bedingter Kurzsichtigkeit auf
Die Augen von Babys sind schon fast so groß wie die eines Erwachsenen, denn das menschliche Auge wächst nach der Geburt nur noch wenig. Das ist bei Reptilien und Fischen anders. Deren Augen wachsen stetig, obwohl sie den gleichen Aufbau haben, wie die Augen der Säugetiere, also auch die des Menschen. Was das Wachstum des Säugerauges hemmt, war bisher noch unverstanden. Bekannt war jedoch, dass ein zu starkes Wachstum des menschlichen Auges zu Kurzsichtigkeit führt, da der Augapfel zu lang wird und das ins Auge einfallende Licht nicht gezielt auf die Netzhaut treffen kann.
Dr. Christ, die als unabhängige Helmholtz-Stipendiatin (Helmholtz-Fellow) am MDC arbeitet, und Prof. Thomas Willnow haben jetzt einen Mechanismus aufgeklärt, welcher das Wachstum des menschlichen Auges kontrolliert und damit Kurzsichtigkeit verhindert. Ausgangspunkt ihrer Studien war eine seltene Form starker Kurzsichtigkeit, welche bei Patienten mit einem Gendefekt in einem Rezeptor auftritt, der als LRP2-Rezeptor bezeichnet wird. Stark vergrößerte Augen konnten die Wissenschaftler ebenfalls in Mäusen beobachteten, denen LRP2 im Auge fehlt.
Gemeinsam mit Augenspezialisten des Toronto Western Research Institutes in Kanada, und der Freien Universität Berlin gingen Dr. Christ, Prof. Willnow und ihre Kollegen am MDC der Frage nach, warum ein Defekt von LRP2 zu unkontrolliertem Wachstum des Säugerauges führt. In einer Studie, die jetzt die renommierte Fachzeitschrift Developmental Cell veröffentlicht hat, konnten sie zeigen, dass LPR2 in der Stammzellnische der Netzhaut sitzt. Dort sorgt LRP2 dafür, dass die Stammzellnische der Netzhaut im Säugerorganismus nicht überaktiv ist. Gegenspieler von LRP2 ist ein Signalmolekül, kurz SHH genannt (die Abk. steht für Sonic hedgehog), welches das Wachstum von Stammzellen anregt.
Seit langem ist bekannt, dass SHH die Embryonalentwicklung der Augen und die Ausbildung der Netzhaut mit ihren Stäbchen und Zäpfchen steuert. Dazu stimuliert es die Stammzellnische der Netzhaut. Im Säugerauge wird LRP2 am äußeren Rand der Netzhaut ausgebildet und fängt den Wachstumsfaktor SHH ab, bevor er die Spitze dieser Stammzellnische erreichen kann. So werden die Stammzellen am Rande der menschlichen Netzhaut nicht zum Wachstum angeregt und das Augenwachstum kontrolliert. Bei Patienten mit schwerer, genetisch bedingter Kurzsichtigkeit ist LPR2 mutiert und kann das zur Stammzellnische wandernde SHH-Signalmolekül nicht mehr abfangen. SHH aktiviert dann die Zellen der Stammzellnische – der Augapfel vergrößert sich stark.
*LRP2 acts as SHH clearance receptor to protect the retinal margin from mitogenic stimuli
\n
Foto: Bei Verlust des Rezeptors LRP2 verlängert sich der Augapfel (links) im Vergleich zu einem Auge mit intaktem LRP2-Rezeptor (rechts), histologische Präparate von Mäusen. (Photo/Copyright: MDC)
\n
leben, bilden / 30.09.2015
Experimente mit Herz: Ein einzigartiges Projekt bietet Schülern intensive Einblicke rund um das Thema Herz
forschen, produzieren, leben / 30.09.2015
2.000ster Studienteilnehmer an Nationaler Kohorte in Berlin-Buch
Der Leiter des Studienzentrums, der Mediziner und Epidemiologe Prof. Tobias Pischon vom MDC, weist darauf hin, dass die Teilnehmer der NAKO-Studie dazu beitragen, die Ursachen und Risikofaktoren der häufigsten chronischen Krankheiten zu erforschen. Das Studienzentrum Berlin-Nord, das im Frühjahr 2014 seine Arbeit aufgenommen hat, soll im Rahmen dieser Studie bis etwa 2018/2019 insgesamt 10.000 Studienteilnehmer untersuchen.
Berlin hat außer dem Studienzentrum Berlin-Nord auf dem Campus Berlin-Buch noch zwei weitere Studienzentren auf dem Campus Charité-Mitte und auf dem Campus Charité Benjamin Franklin in Steglitz. Sie sollen zusammen 30 000 Studienteilnehmer rekrutieren, erläutert Prof. Pischon, der auch Sprecher aller drei Berliner Studienzentren ist. Sie werden betrieben vom MDC (Studienzentrum Berlin-Nord), der Charité – Universitätsmedizin Berlin (Studienzentrum Berlin-Mitte) sowie dem Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) (Studienzentrum Berlin-Süd/Brandenburg).
Das Studienzentrum Berlin-Nord auf dem Campus Berlin-Buch ist außerdem eines von insgesamt fünf Studienzentren der NAKO, die mit einem Magnetresonanz-Tomographen (MRT) ausgerüstet sind. Der Tomograph befindet sich in der Berlin Ultrahigh Field Facility am MDC in Berlin-Buch, die von Prof. Thoralf Niendorf geleitet wird. Dort sollen 6.000 der 30.000 Berliner und Brandenburger Studienteilnehmer eine Ganzkörper-MRT-Untersuchung erhalten. Bisher haben in der MRT-Anlage in Berlin-Buch 830 Studienteilnehmer die einstündige Untersuchung absolviert.
Bundesweit sollen in der NAKO-Bevölkerungsstudie insgesamt 200.000 Teilnehmer im Alter von 20 bis 69 Jahren untersucht und nach ihren Lebensgewohnheiten befragt werden. Zusätzlich werden Blut-, Urin-, Stuhl- und Speichelproben gewonnen und für spätere Forschungsprojekte getrennt von den Personendaten unter einer Kennnummer (Pseudonym) gespeichert. Die Teilnehmer werden 20 bis 30 Jahre nachbeobachtet. Dabei werden eventuell auftretende Krankheiten erfasst und mit den Jahre zuvor erhobenen Daten verglichen, um so Risikofaktoren auf die Spur zu kommen.
An der Studie kann nur teilnehmen, wer ein Einladungsschreiben von einem der 18 NAKO-Studienzentren erhält. Die Auswahl der Angeschriebenen erfolgt nach dem Zufallsprinzip anhand von Adressen, die die Forscher von den Einwohnermeldeämtern bekommen haben. Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Die Untersuchungen können nur mit Einwilligung der Studienteilnehmer erfolgen, die ihre Teilnahme jederzeit wieder zurückziehen können.
Die Studie wird in den ersten zehn Jahren mit 210 Millionen Euro aus Mitteln des Bundesforschungsministeriums, der Länder und der Helmholtz-Gemeinschaft finanziert. Initiiert haben die NAKO die Helmholtz-Gemeinschaft, Universitäten, die Leibniz-Gemeinschaft sowie Einrichtungen der Ressortforschung.
\n
Foto: Studienärztin Sabine Mall vom Studienzentrum der Nationalen Kohorte (NAKO) Berlin-Nord (3. v. l.) überreichte dem 2.000sten Studienteilnehmer, Thomas Heise aus Zepernick, im Kreis der NAKO-Mitarbeiter einen Blumenstrauß. (Foto: Manuela Stendal, AG Prof. Pischon/ Copyright: MDC)
\n
forschen / 30.09.2015
W3-Professur für Dr. Wei Chen vom MDC an der Charité
Die medizinische Systembiologie verbindet modernste Sequenzier- und andere Hochdurchsatz-Technologien, Mathematik, Bioinformatik, Molekularbiologie, Biochemie und Physik mit dem Ziel, komplexe Vorgänge des Lebens quantitativ zu erfassen. Sie erforscht dabei die molekularen Netzwerke der Gene und Proteine, ihre Regulation und ihr Zusammenspiel sowie ihre Bedeutung bei der Entstehung von Krankheiten. Am BIMSB hat Prof. Chen dazu mit den von ihm eingesetzten hochmodernen, neuartigen Sequenziertechnologien verschiedene Ansätze für die Erforschung der Funktion von Genen und ihrer Regulation entwickelt.
Prof. Chen wurde 1972 in China geboren und machte an der Xiamen Universität in Xiamen 1993 seinen Bachelor in Biochemie. Es folgten 2000 der Master of Business Administration (MBA) an der Southwest Jiontong Universität und 2002 der Master of Science (Msc) in medizinischer Genetik am West China Hospital der Sichuan Universität. Mit einem Doktorandenstipendium der Max-Planck-Gesellschaft war er 2002 als Doktorand nach Deutschland an das Max-Planck-Institut (MPI) für Molekulare Genetik nach Berlin gekommen und hatte 2006 promoviert. Bevor er 2009 an das BIMSB des MDC wechselte, leitete er am MPI für Molekulare Genetik die Forschungsgruppe Angewandte Bioinformatik.
Das BIMSB steht für das Forschungsprogramm der Systembiologie am MDC. Es verbindet modernste Hochdurchsatztechnologien mit experimenteller und theoretischer Wissenschaft, um genregulatorische Prozesse aufzuklären. Es nahm 2008 auf dem Campus Berlin-Buch seine Arbeit auf und wird von Prof. Nikolaus Rajewsky (MDC) geleitet. Das BIMSB arbeitet eng mit Forschungseinrichtungen und Netzwerken in Berlin und darüber hinaus zusammen und ist Teil Integrative Research Institute Life Sciences (IRI LS) an der Humboldt-Universität, zu dessen Mitbegründern MDC und Charité gehören. Außerdem fördert das BIMBS die Zusammenarbeit mit der New York University, USA, dem Medical Research Council Clinical Science Center (MRC CSC) in London, der Universität La Sapienza in Rom und der Hebrew University Jerusalem. 2018 wird das BIMSB nach Berlin-Mitte auf den Campus der Humboldt Universität ziehen, wo derzeit der Neubau dafür entsteht.
\n
Foto: Prof. Wei Chen (Foto: David Ausserhofer/ Copyright: MDC)
forschen, produzieren, leben / 25.09.2015
Buch hilft: Ein enges Hilfsnetzwerk unterstützt die Flüchtlinge im Bucher Refugium
Seit Mai dieses Jahres leben 480 Menschen in Berlin-Buch, die aus ihrer Heimat geflohen sind und in Deutschland Asyl beantragt haben. Sie stammen aus 25 Ländern, hauptsächlich aus Syrien, Afghanistan, Eritrea, Serbien und Kosovo. Unter ihnen sind 150 Kinder. Das neue Refugium der Arbeiterwohlfahrt, eine Anlage mit Containergebäuden und Gartenbereich, bietet ihnen ein Zuhause auf Zeit. Längst sind Willkommensklassen eingerichtet, in denen die größeren Kinder unterrichtet werden. Ab September werden Kindergartenplätze für die Kleinen gesucht. Und die Unterstützung aus der Bevölkerung ist groß.
Nachdem der Senat im November 2014 bekannt gegeben hatte, dass in Buch eine Wohnstätte für Geflüchtete entstehen würde, rollte eine Welle des Protests an. Doch gleichzeitig bildeten diejenigen, die den Flüchtlingen das Ankommen erleichtern wollten, einen Unterstützerkreis. Koordiniert vom gemeinnützigen Verein Albatros, engagieren sich seitdem ca. 200 ehrenamtliche Helfer aus Buch und Umgebung für die neuen Bewohner. Darunter sind Ältere mit medizinischen Berufen, pensionierte Lehrerinnen, Berufstätige und Studierende. Sie unterrichten Deutsch, begleiten auf Ämter und zu Ärzten, zeigen den Ort, betreuen Kinder oder reparieren gespendete Fahrräder.
Helfende vom Campus
Hilfe kommt auch vom international geprägten Campus Buch. Am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) und am Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) arbeiten Menschen aus 60 Nationen.
Adeeb Eldahshan hat viele Jahre am FMP und MDC gearbeitet. Als er vom Refugium hörte, entschied er sich sofort zu helfen. Er kam vor 17 Jahren aus dem Gazastreifen zum Studium nach Tübingen und erhielt damals selbst viel Unterstützung. Eldahshan übersetzt ins Arabische und unterrichtet einmal pro Woche Deutsch für Erwachsene. „Ich erlebe, wie zielorientiert die Leute Tag für Tag mehr deutsch lernen, um sich integrieren und eine Arbeit aufnehmen zu können.“ Zweite Dozentin im Deutschkurs von Adeeb Eldahshan ist Cornelia Stärkel, Mitarbeiterin im Gläsernen Labor. Für sie war ausschlaggebend, etwas gegen die anfänglich negative Stimmung im Ort zu unternehmen: „Ich möchte den Flüchtlingen ein Gefühl des Willkommens vermitteln.“\n
Sobald Flüchtlinge eine Aufenthaltsgestattung haben, können sie aus dem Refugium ausziehen. Doch eine Wohnung zu finden, ist nicht leicht. „Der Wohnungsmarkt ist kompliziert, und viele sprechen kaum Deutsch. Wir helfen ihnen bei der Suche nach preiswerten Wohnungen“, erklärt Emanuel Wyler vom MDC. Mit einer weiteren Kollegin beteiligt er sich an der AG „Wohnungssuche“.
Raed Al-Yamori, Softwareentwickler am FMP, engagiert sich ebenfalls für die Refugiumsbewohner; als Dolmetscher, Sprachvermittler und Ratgeber. „Als ich 1996 aus Bagdad zum Studium nach Berlin kam, musste ich mich völlig neu orientieren“, beschreibt er. „Sich hier ein Leben aufzubauen, ist kein leichtes Unterfangen, aber es kann gelingen.“
Einmal pro Woche spielt Thilo Volbracht, Mitarbeiter der Eckert & Ziegler AG, mit Mädchen und Jungen vom Refugium Fußball oder Volleyball. Häufig besucht er mit ihnen auch die Bienenvölker auf dem Campus, die er als Imker betreut. Er hat Syrien, das Herkunftsland vieler Kinder, kennengelernt, als dort ethnische und religiöse Minderheiten noch gut zusammenlebten. „Mir ist wichtig, Basisdemokratie und Toleranz zu vermitteln“, erklärt Volbracht, der auch bei den Spendenaktionen fürs Refugium mithilft.
Die Refugiumsbewohner waren zur Langen Nacht der Wissenschaften auf den Campus eingeladen und sind gern gekommen. Den Kindern und Jugendlichen wurde ein kostenloser Ferienkurstag im Gläsernen Labor geboten. Für jede Hilfe, jedes Angebot ist die Dankbarkeit groß, so die einhellige Erfahrung aller Unterstützer. „Das Strahlen in den Augen der Kinder ist die schönste Belohnung“, so Thilo Volbracht.
Neuer Treffpunkt in Buch
In der ehemaligen Info-Box der HOWOGE wird es ab September gemeinsame Veranstaltungen für Refugiumsbewohner und Anwohner geben. Grundlage ist ein Kooperationsvertrag mit Albatros. „Wir stellen diese Plattform zur Verfügung, um das gegenseitige Kennenlernen und die Integration zu fördern“, so Karen Schulz, Leiterin des Servicebüros in Buch. „Die Flüchtlinge sollen in normalen Verhältnissen ankommen und zur Ruhe kommen können.“
Text: Christine Minkewitz
Foto: Familien aus dem Refugium kamen zur Langen Nacht der Wissenschaften auf dem Campus Berlin-Buch (Peter Himsel/Campus Berlin-Buch)
leben / 23.09.2015
Albert Schweitzer Stiftung – Wohnen & Betreuen mit MDK-Bestnote
Die MDK-Prüfung findet ohne vorherige Ankündigung statt. Auch deshalb sieht die Fachbereichsleiterin Ilona Kolbe in der Bestnote eine Bestätigung für die konstante Realisierung der hohen Qualitätsansprüche in der täglichen Pflege. „Wir setzen unsere Vorgaben eins zu eins um. Zudem sind unsere Pflegekräfte immer mit dem Herzen dabei, haben ein großes Wissen über die Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Biografien.“ Besonders stolz sei sie darüber, dass drei junge Pflegefachkräfte, die gerade ihre Ausbildung in der Stiftung beendet hatten, den Prüfern auf so souveräne Weise zur Seite standen.
leben / 23.09.2015
Keine Sprechzeiten der Elterngeldstelle vom 29. September bis 16. Oktober 2015
Die Maßnahme soll sicherstellen, dass auch weiterhin Elterngeldanträge zeitnah bearbeitet werden können. Anträge auf Elterngeld können postalisch zugesendet werden an das Bezirksamt Pankow von Berlin, Postfach 73 01 13, 13062 Berlin bzw. an der Information oder in der Abteilung Kindschaftsrecht in Zimmer 238 des Jugendamtes, Berliner Allee 252-260, 13088 Berlin, abgegeben werden.
\nFür dringende Fragen stehen die Mitarbeiterinnen der Elterngeldstelle montags und mittwochs von 10 – 12 Uhr telefonisch zur Verfügung. Die Kontaktdaten gibt es auf der Seite des Jugendamtes.
leben / 23.09.2015
Netzwerk Neuzuwanderung gegründet
Arbeitsgrundlage für das Netzwerk Neuzuwanderung ist die vom Bezirksamt in Auftrag gegebene Studie „Vielfalt in Pankow“. Diese setzt sich mit der Zuwanderung im Bezirk Pankow auseinander und zeigt unter anderem, dass besonders gut ausgebildete Europäer nach Pankow kommen. Deren Integration gelänge aber aufgrund befristeter Arbeitsverträge oder Sprachbarrieren nur selten auf Anhieb.
Die Treffen des Netzwerks finden vorerst vier Mal im Jahr statt. Teilnehmende sind unter anderem Vertreter/innen des Bundsamtes für Migration, des Jobcenters, der Wohlfahrtsverbände, des Jugendamtes, des Wirtschaftskreises Pankow sowie der Migrantenselbstorganisationen.
Für Rückfragen steht die Integrationsbeauftragte, Katarina Niewiedzial (Tel.: 030 902952524), zur Verfügung.
leben, heilen / 22.09.2015
Hurra Maxim ist da!
„Die Entbindung verlief völlig problemlos. Mama und Kind sind wohlauf“, sagt Ärztin Frau Dr. med. Maria Wink. Hebamme Birgit Wittig ist schon seit 30 Jahren Hebamme im HELIOS Klinikum Berlin-Buch und betreute die Familie aus Lichtenberg vor und nach der Entbindung und freut sich mit den Eltern über die unkomplizierte Geburt.
Maxim ist für die zahnmedizinische Fachangestellte und ihren Ehemann das zweite Kind. „Wir sind von der Atmosphäre hier begeistert und haben uns rundum wohl und gut betreut gefühlt“, sagt die frisch gebackene Mama. Schnell war deshalb klar, dass auch Maxim im HELIOS Klinikum Berlin-Buch das Licht der Welt erblicken soll.
„Wir freuen uns sehr, dass sich unsere Geburtshilfe und unser Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe in Berlin und im angrenzenden Brandenburg so großer Beliebtheit erfreuen. Seit vielen Jahren können wir eine deutliche Steigerung unserer Geburten verzeichnen und das trotz sinkender Geburtenzahlen deutschlandweit“, sagt Professor Dr. med. Michael Untch, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im HELIOS Klinikum Berlin-Buch.
„Sicher und individuell“ ist das Motto der geburtshilflichen Abteilung im HELIOS Klinikum Berlin-Buch. Neben einer modernen Geburtshilfe bietet das Klinikum auch eine umfassende Versorgung von Risikoschwangerschaften, Mehrlingsgeburten und Frühgeborenen. So arbeiten im Bucher Perinatalzentrum mit der höchsten Versorgungsstufe für Frühgeborene
(Level 1), die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und die Klinik für Kinderchirurgie eng mit der Geburtshilfe zusammen. Diese intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit garantiert eine optimale Versorgung von Mutter und Kind vor, während und nach der Geburt rund um die Uhr.
Klinikkontakt:
HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin, mit Schwangerenberatung, Risikosprechstunde und Geburtsanmeldung unter (030) 9401-53345.
Jeden 1., 2. und 3. Dienstag im Monat findet um 17.30 Uhr ein Informationsabend statt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Unter www.helios-kliniken.de/berlin finden Sie weitere Informationen zur Geburtshilfe sowie zur HELIOS Elternschule „Haus Kugelrund“.\n
\n
Foto: Freude über die 2.000 Geburt in der Geburtsklinik (Foto: Thomas Oberländer/HELIOS)
\n
forschen / 17.09.2015
Prof. Thomas Willnow: Immer mehr Erkenntnisse über die Entstehung der Alzheimer-Krankheit – Verschiedene Forschungsansätze am MDC
Weltweit sind etwa 35 Millionen Menschen an Alzheimer erkrankt, in Deutschland wird die Zahl auf eine Million Betroffene geschätzt. Mit steigender Lebenserwartung der Menschen befürchten Wissenschaftler, dass sich die Zahl der Demenz- und Alzheimer-Patienten in den kommenden 25 Jahren verdoppelt, wenn es nicht gelingt, die Erkrankung zu behandeln, oder ihre Entstehung zu verhindern. „Wir verstehen mehr und mehr, wie die Alzheimer-Krankheit entsteht“, erklärt Prof. Thomas Willnow vom Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) anlässlich des Welt-Alzheimertages. Er verbindet damit die Hoffnung, dass es künftig gelingt, Therapien gegen Alzheimer zu entwickeln.
Die Alzheimer-Forschung am MDC verfolgt verschiedene Ansätze, um die Krankheit besser diagnostizieren und in Zukunft besser behandeln zu können. Prof. Willnow sucht nach den genetischen Ursachen der Erkrankung. Der Proteinforscher Prof. Erich Wanker sucht nach neuen Wegen, die Krankheit zu diagnostizieren und nach Wirkstoffen, die ihren Ausbruch verhindern. Dipl.-Ing. Marion Bimmler (MDC; Biotechfirma E.R.D.E-AAK-Diagnostik GmbH, Campus Berlin-Buch) nimmt bestimmte Autoantikörper unter die Lupe, die die Blutgefäße im Gehirn schädigen und dadurch zur Demenz und Alzheimer-Erkrankung beitragen.
Basis der Forschung von Prof. Willnow sind sogenannte genomweite Assoziationsstudien. Dabei vergleichen Forscher die Genome von rund 50 000 Gesunden mit den Genomen von etwa 10 000 Menschen, die an der sporadischen (zufälligen) Form von Alzheimer erkrankt sind. Die sporadische Form macht etwa 95 Prozent der Alzheimer-Patienten aus und ist eine Erkrankung des Alters. Ihre Auslöser sind meist noch unbekannt, weshalb Forscher nach genetischen Faktoren und Umwelteinflüssen für diese Form von Alzheimer fahnden.
Bei dem Vergleich der Genome von Gesunden und Kranken können Genetiker erkennen, welche Gene bei den Erkrankten verändert sind. Das heißt, meist wird dann zu viel oder zu wenig von dem jeweiligen Genprodukt (Protein) gebildet oder das Protein arbeitet nicht richtig. „Die Funktion solcher Gene erforschen wir an Mäusen. Derzeit untersuchen wir vier bis fünf verschiedene Gene“, sagt Prof. Willnow. „Auch Zwillingstudien“, so der Zellbiologe weiter, „weisen darauf hin, dass die sporadische Form von Alzheimer eine starke genetische Komponente haben muss.“
Bei der familiären Form von Alzheimer, die nur etwa fünf Prozent der Alzheimer-Erkrankungen ausmacht und bereits in jungen Jahren ausbricht, haben Forscher in den vergangenen Jahren verschiedene Mutationen in drei Genen identifiziert. Eine Mutation in einem der drei Gene reicht bereits völlig aus, dass diese frühe Form von Alzheimer zum Ausbruch kommt. Diese familiäre Form von Alzheimer ist im Gegensatz zur sporadischen Form sehr aggressiv.
Nervenzellen selbst produzieren Schutzfaktor
Vor wenigen Jahren hatte Prof. Willnows Forschungsgruppe im Zuge der vergleichenden Genomforschung entdeckt, dass gesunde Nervenzellen einen Schutzfaktor, das Transportprotein SORLA (engl. für: sorting protein-related receptor) bilden, der die Produktion des Hauptbeschuldigten für Alzheimer, des A-beta Peptids, vermindert. A-beta ist ein kleines Eiweißbruchstück, das aus einem größeren Vorläuferprotein, dem APP, entsteht. Zwei verschiedene molekulare Scheren (Sekretasen) zerstückeln APP zu A-beta. Dieser Vorgang läuft bei jedem gesunden Menschen im Gehirn ab und sorgt dafür, dass die Nervenzellen miteinander kommunizieren können.
Gefährlich wird es erst dann, wenn zu viel A-beta gebildet wird, das der Körper nicht mehr entsorgen kann. Dann sterben die Nervenzellen ab und die Kommunikation untereinander ist gestört. Kognitive Defekte sind die Folge. Zuviel A-beta führt außerdem zur Entstehung der gefürchteten Eiweißablagerungen (Plaques) im Gehirn, welche die Nervenzellen zusätzlich schädigen. „Da mit zunehmendem Lebensalter die Menge an A-beta im Gehirn immer weiter ansteigt, nimmt das Risiko, im Alter an Alzheimer zu erkranken, dramatisch zu“, erläutert Prof. Willnow. Er konnte zeigen, dass ein Verlust des Schutzfaktors SORLA bei Mäusen zu vermehrter A-beta Bildung führt. Das gleiche Phänomen konnte er auch im Gehirn von Alzheimer-Kranken sehen. Einige Patienten bilden weniger SORLA, sodass vermehrt giftiges A-beta entsteht und sich im Gehirn ablagert. In Mäusen erbrachte er den Nachweis, dass die erhöhte Produktion des Schutzfaktors SORLA die Menge an A-beta im Gehirn drastisch reduziert.
Prof. Wanker: Entwicklung neuer Werkzeuge für Diagnose und Therapie
Im Fokus der Forschungen von Prof. Wanker stehen die Proteine, die für Alzheimer und andere neurodegenerative Erkrankungen wie Chorea Huntington und Parkinson identifiziert worden sind. Den Biochemiker interessiert vor allem, weshalb das gesunde Peptid A-beta sich in krankmachendes Peptid umwandelt. „Vor wenigen Jahren haben Forscher gezeigt, dass krankmachendes A-beta im Gehirn sich selbst vermehrt und im Gehirn ausbreitet. Die Forschung spricht in diesem Zusammenhang davon, dass A-beta im Gehirn regelrechte „seeds“, also Keime, bildet“ erläutert er. Prof. Wanker untersucht diese Keime, die unter anderem von an Alzheimer Verstorbenen stammen, im Labor in der Petrischale. „Wir haben eine neue Methode entwickelt, mit der wir die Ausbreitung dieser Keime quantifizieren, also messen können. Unser Ziel ist es darüber hinaus Wirkstoffe zu finden, die diese Keime daran hindern, sich auszubreiten, um damit den Ausbruch der Krankheit zu hemmen“, sagt Prof. Wanker.
Dipl.-Ing. Bimmler: Autoantikörper im Gehirn schädigen Blutgefäße
Blutgefäßschädigungen im Gehirn sind eine weitere Komponente der komplexen Alzheimer-Krankheit sowie von Demenzen. Dipl.-Ing. Marion Bimmler (MDC), Dr. Peter Karczewski und Petra Hempel (E.R.D.E.-AAK-Diagnostik GmbH) erbrachten vor wenigen Jahren in Untersuchungen an Nagern den Nachweis, dass eine Gruppe von Antikörpern des Immunsystems Blutgefäße im Gehirn schädigen kann. Sind diese Antikörper fehlreguliert, greifen sie den eigenen Körper an, weshalb sie als Autoantikörper bezeichnet werden.
Die sogenannten agonistisch wirkenden Autoantikörper (kurz AAK) binden an bestimmte Oberflächenproteine (Rezeptoren; alpha1 adrenerge Rezeptoren) von Blutgefäßzellen und lösen dort eine Dauerstimulation des Rezeptors aus. Dadurch erhöht sich die Konzentration von Kalziumionen in der Zelle. Die AAK aktivieren das Wachstum glatter Gefäßmuskelzellen und bewirken damit, dass sich die Gefäßwände verdicken, wodurch die Durchblutung des Gehirns gestört ist. In Untersuchungen an Nagern konnten die Biotechnologen mit Hilfe der Magnetresonanz-Tomographie (MRT) diese Verringerung des Blutflusses zeigen.
Außerdem konnten sie mit Hilfe der Immunfluoreszenzmikroskopie eine signifikante Abnahme der Gefäßdichte in Schnitten der Großhirnrinde (Kortex) nachweisen. Zudem waren die sogenannten Virchow-Robinschen Räume der Tiere – sie umschließen die Blutgefäße im Gehirn – stark aufgeweitet. Eine übermäßige Aufweitung (Dilatation) dieser Räume gilt als Zeichen für das Vorhandensein von Schädigungen kleinster Blutgefäße (Mikroangiopathien). Die Forscher hatten damit den Nachweis erbracht, dass Antikörper gegen den alpha -1- adrenergen Rezeptor Schäden an größeren als auch kleineren Blutgefäßen im Gehirn von Nagern verursachen.
In vorausgegangenen Arbeiten hatten Marion Bimmler und ihre Mitarbeiter das Blut von Patienten mit Alzheimer / vaskulärer Demenz untersucht und es zeigte sich, dass die Hälfte von ihnen derartige Autoantikörper haben. In Zusammenarbeit mit der Charité – Universitätsmedizin Berlin und der Universitätsklinik Jena sind darauf hin bei einer kleinen Zahl von Patienten mit Alzheimer / vaskulärer Demenz diese Autoantikörper aus dem Blut entfernt worden. „Die mit der Blutwäsche behandelten Patienten profitierten von der Behandlung. Sowohl ihre Gedächtnisleistungen als auch ihre Fähigkeiten, ihren Alltag zu bewältigen, verbesserten sich oder blieben konstant, verschlechterten sich also nicht, innerhalb eines Beobachtungszeitraums von 12 - 24 Monaten. „Damit haben wir eine therapeutische Option aufgezeigt (proof of concept)“, betont Marion Bimmler. „Denn im Gegensatz zu den behandelten Patienten hatte sich der Zustand der nicht behandelten Patienten, die weiterhin Autoantikörper im Blut hatten, im gleichen Zeitraum verschlechtert.“ Eine weitere Studie wird gegenwärtig geplant.
Hauptrisikofaktoren für Alzheimer
Stoffwechselkrankheiten wie Typ-2 Diabetes, erhöhte Cholesterinwerte und Fettleibigkeit (Adipositas) zählen zu den Hauptrisikofaktoren für Alzheimer. Der größte genetische Risikofaktor ist dabei nach Aussage von Prof. Willnow das Apolipoprotein E, ein Regulator des Cholesterinspiegels. Träger einer bestimmten Variante dieses Gens haben ein viermal höheres Risiko an Alzheimer zu erkranken als andere Genträger. Wie es durch Fehlregulationen im Zucker- und Fettstoffwechselhaushalt zu Schäden im Gehirn kommt, ist allerdings noch unklar. Seit einiger Zeit erforscht Prof. Willnow die molekularen Mechanismen, die dieser Wechselwirkung zugrunde liegen. Schwerpunkt dabei ist eine neue Klasse von Signalrezeptoren.
Auch bei Diabetikern Typ 2 konnten Marion Bimmler und ihre Mitarbeiter agonistisch wirkende Autoantikörper nachweisen. „Möglicherweise“, so die Forscherin, „sind sie eine der Ursachen, warum Diabetiker häufiger an Demenz und Alzheimer erkranken als Nichtdiabetiker.“
Hinauszögern
Vor diesem Hintergrund sind die Forscher davon überzeugt, dass es möglich ist, das Auftreten von Alzheimer hinauszuzögern. Dazu gehöre, auf die Gesundheit zu achten, Sport zu treiben und sich vernünftig zu ernähren.
forschen / 17.09.2015
Projekt von Prof. Nikolaus Rajewsky gewinnt Ideenwettbewerb "Diagnostische Innovationen für die personalisierte Medizin"
\n
Über den Sieg freuen dürfen sich deshalb Prof. Frank F. Bier vom Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie und Prof. Nikolaus Rajewsky vom Max-Delbrück-Zentrum für Molekulare Medizin, Dr. Holger Eickhoff von der Scienion AG und Dr. Arif Malik von der MicroDiscovery GmbH, Dr. Juliane Hoffmann und Prof. Berend Isermann vom Institut für Klinische Chemie und Pathobiochemie der Universität Magdeburg sowie Dr. Uwe Schedler von der PolyAn GmbH. Ihnen bietet sich nun die Chance, eine mit 100.000 Euro geförderte Machbarkeitsstudie im Rahmen des BMBF-geförderten Zwanzig20-Forums durchzuführen. Zudem präsentieren sie ihre Ideen auf einer Veranstaltung der PARMENIDes-Initiative am 7.10.2015 auf dem „Marktplatz Personalisierte Medizin-Technologien“ der BIOTECHNICA in Hannover. Hier beleuchten Experten aus verschiedenen Blickwinkeln die Anforderungen der personalisierten Medizin und diskutieren das Thema „Innovationsführerschaft als strategische Option für die pharmazeutische Industrie: Perspektiven, Grenzen und die Rolle der Diagnostik“.
\n\n
Um das Innovationspotenzial der personalisierten Medizin noch besser auszuschöpfen, startete PARMENIDes Anfang Juni dieses Jahres einen Aufruf. Neben den vielversprechenden Möglichkeiten birgt die personalisierte Medizin wissenschaftliche, ethische, rechtliche und gesundheitsökonomische Herausforderungen. Hier setzte der Ideenwettbewerb der Initiative an: Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen wurden aufgefordert, Ideen zu neuen Ansätzen der In-vitro-Diagnostik zu formulieren, die dazu beitragen, die Herausforderungen ganzheitlich zu lösen. Der Wettbewerb zielte vor allem darauf, die Entwicklung von innovativen Ideen aus der interdisziplinären Zusammenarbeit anzustoßen.
\n\n
Machbarkeitsprüfung eines microarraybasierten Systems, um zirkuläre RNA zu detektieren
In welcher Art und Weise und wie vielfältig dies geschehen kann, zeigen die Gewinnerprojekte. So werden Prof. Bier und Prof. Rajewsky eine Machbarkeitsprüfung für ein microarraybasiertes System durchführen, um zirkuläre RNA zu detektieren – einer neuen und wertvollen Klasse von Biomarkern, etwa für die Diagnostik neurodegenerativer Erkrankungen. Das Projekt von Dr. Eickhoff und Dr. Malik fokussiert auf den Machbarkeitsnachweis eines glykanbasierten kombinierten Schnelltests. Glykane sind Kohlenhydrate, die alle Zellen des menschlichen Körpers bedecken und daher interessant sind für die molekulare Erkennung von Zelloberflächen. Die Partner erarbeiten wesentliche Entwicklungsparameter für eine innovative Diagnostikplattform, die auf die Glycan-Array-Technologie zurückgreift. Der Test soll zunächst in der Autoimmundiagnostik Einsatz finden, später auch in der Infektiologie und Onkologie. Dr. Hoffmann und Prof. Isermann widmen sich einem anderen spannenden Verfahren, mit dem sich aggressive Prostatakarzinome anhand von Blutproben identifizieren lassen. Hierfür sind Vorarbeiten geplant, um eine neuartige nukleinsäurebasierte Screening-Technologie zu entwickeln, die es erlaubt, Patienten mit Prostatakarzinom einer richtigen und nebenwirkungsarmen Therapie zuzuführen. Schließlich fokussiert Dr. Uwe Schedler auf die Diagnostik pathogener Erkrankungen der Mundhöhle. Zusammen mit dem Lehrstuhl für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie der Universität Würzburg wird er eine Proof-of-Principle-Studie durchführen, um anschließend einen Kaugummi-Selbsttest zu entwickeln, mit dem sich etwa Karies frühzeitig erkennen lässt.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Website des DiagnostikNet-BB.
leben / 16.09.2015
Einladung zum Herbstputz rund um das Ludwig Hoffmann Quartier
Gereinigt werden sollen die Wiltbergstraße, das Gelände um den S-Bahnhof Buch, der Pölnitzweg sowie der Röbellweg. Eigenes Werkzeug und Gerätschaften können sehr gerne mitgebracht werden. Für eine Stärkung und Erfrischung nach getaner Arbeit ist gesorgt.
\nTreffpunkt ist der Parkplatz vor Haus 2, direkt am Eingang des Ludwig Hoffmann Quartiers an der Wiltbergstraße/Ecke Röbellweg.
\nBitte melden Sie sich zu besseren Planung bis 2. Oktober bei Anne Kretschmar an:
\n
Mail: anne.kretschmar@l-h-q.de
Fax: 030 - 40 50 59 59
Telefon: 0171 - 22 3000 5
\n
Foto: Breite Alleen und großzügige Grünanlagen prägen das Ludwig Hoffmann Quartier (Foto: Ludwig Hoffmann Quartier)
\n
forschen / 15.09.2015
Prof. Thomas Jentsch eröffnete vor 25 Jahren ein neues Forschungsfeld – Britische Fachzeitschrift widmet Entdeckung Sondertei
Schwerpunkte der Forschungen von Prof. Jentsch sind die Prozesse des so genannten Ionen-Transports. Sie sind für die Funktion der Zelle und den gesamten Organismus von entscheidender Bedeutung. Sind sie gestört, können schwere Krankheiten entstehen.
Zitterrochen und der Torpedo Chloridkanal
In dem elektrischen Organ des Zitterrochens identifizierten und isolierten Thomas Jentsch und seine Mitarbeiter nach mehr als vierjähriger Arbeit 1990 das Gen für einen spannungsabhängigen Chloridkanal. Ein von diesem Gen kodiertes Protein – der sogenannte Torpedo-Chloridkanal – schleust das negativ geladene Chlorid-Ion in Abhängigkeit von der elektrischen Spannung durch die Zellmembran. Damit hatten die Forscher den ersten spannungsabhängigen Chloridkanal molekular identifiziert und ein neues Forschungsfeld eröffnet.
Die elektrische Aktivität dieses Chloridkanals hatte Prof. Miller zehn Jahre zuvor zufällig im elektrischen Organ des Zitterrochens Torpedo entdeckt und anschließend biophysikalisch charakterisiert. Das zugrundeliegende Protein blieb bis zur Klonierung des entsprechenden Gens durch Thomas Jentsch jedoch unbekannt. Die Klonierung des Kanals aus dem exotischen elektrischen Rochen war der Durchbruch, der es Thomas Jentsch und Mitarbeitern ermöglichte, innerhalb weniger Jahre verwandte Chloridkanäle des Menschen zu identifizieren und zu charakterisieren. Die Wissenschaftler entdeckten, dass mehrere Erbleiden des Menschen auf Mutationen in diesen Kanälen zurückzuführen sind, die Thomas Jentsch „CLC“ taufte. (Cl ist die chemische Kurzformel für Chlorid und C steht für das englische Wort Channel).
„Inzwischen“, so Prof. Jentsch, „sind mehr als 2 000 wissenschaftliche Veröffentlichungen über die Eigenschaften und außerordentlich unterschiedlichen physiologischen Funktionen dieser Familie von Chloridkanälen im Organismus und bei der Entstehung von Krankheiten erschienen“. „Vor 25 Jahren jedoch hatten sich nur wenige physiologische Studien mit Chloridkanälen befasst“, schildert Prof. Jentsch in der Zeitschrift die Lage in den 1980er Jahren. Der Grund: „Fast alle Elektrophysiologen untersuchten Kanäle für Natrium und Kalium und unterdrückten Ströme von Chloridkanälen, die sie bei ihren Studien nur störten.“
Doch war damals schon bekannt, dass die Fehlfunktion von Chloridkanälen – also der Ausfall des von ihnen ausgelösten elektrischen Stroms – , wahrscheinlich mit zwei genetischen Erkrankungen zusammenhängt: der Mukoviszidose (Zystische Fibrose), einer schweren Erkrankung, bei der die Drüsen einen zähen Schleim bilden und unter anderem zur Störung der Lungenfunktion führen, und der Muskelsteifheit (Myotonia congenita). „Dieses unbearbeitete Feld schien viele neue biologische Erkenntnisse und Überraschungen zu versprechen“, war Thomas Jentsch überzeugt. Heute weiß man, dass der Mensch neun verschiedene CLC Chloridkanäle und -transporter besitzt, die sowohl Funktionen in der äußeren Zellmembran als auch in intrazellulären Vesikeln wahrnehmen.
Thomas Jentsch und seine Mitarbeiter konnten auch zwei andere, kleinere Proteine identifizieren, die an bestimmte CLC Kanäle fest binden und für deren Funktion notwendig sind. Der Verlust dieser Proteine verursacht die gleichen Erkrankungen wie der Verlust des eigentlichen Kanals (Salzverlust und eine Form von Taubheit, beziehungsweise Osteopetrose – stark verkalkte Knochen-, und Neurodegeneration).
Wie Prof. Jentsch in Zusammenarbeit mit Humangenetikern in weniger als zwei Jahren nach Klonierung des Zitterrochenkanals zeigen konnte, ist eine Mutation in solch einem Chloridkanal die Ursache für mehrere erbliche Formen der Muskelsteifheit. Weiterhin zeigte seine Gruppe, dass Mutationen in einem weiteren Chloridkanal zu Blindheit und Störungen der weißen Gehirnsubstanz (Leukodystrophie) führen. Seine Forschungsgruppe entschlüsselte auch die Funktionen dreier Chloridkanäle in der Niere. Wenn defekt, führen sie zu verschiedenen Nierenerkrankungen, wie massivem Salzverlust, Nierensteinen und Nierenverkalkung, und zusätzlich zu Taubheit bei völligem Verlust zweier dieser Kanäle.
Weiter entdeckte er, dass Mutationen in einem anderen Chloridtransporter zu schwerer Knochenkrankheit und Neurodegeneration führen. Mit Mausmodellen konnte sein Team zeigen, dass diese Erkrankungen auf der Störung von sogenannten Lysosomen, zellulären, membranumschlossenen „Mülleimern“ der Zelle, beruhen. Zusammen mit Dr. Stefanie Weinert und Dr. Gaia Novarino in seiner Forschungsgruppe konnte er nachweisen, dass dabei der Proteinabbau in den winzigen Zellorganellen entgegen gängiger Lehrmeinung nicht allein vom pH-Wert abhängt, sondern auch von der Anreicherung von Chloridionen in ihrem Innern.
Neben seinen Arbeiten zu CLC Chloridtransportern beschäftigen sich Thomas Jentsch und seine Mitarbeiter unter anderem auch mit bestimmten Kaliumkanälen. Auch hier konnten sie die Ursache für einige Erbleiden aufklären. Sie zeigten, dass Mutationen in einem KCNQ2 genannten Kaliumkanal zu einer Form der vererbten Epilepsie des Menschen führen. Medikamente, die diese Kanäle öffnen, werden schon klinisch angewendet. Sie entdeckten ebenfalls, dass Mutationen im KCNQ4 Kanal eine Form der Taubheit beim Menschen verursachen. Vor wenigen Jahren erbrachte Prof. Jentsch zusammen mit Prof. Gary Lewin vom MDC und Klinikern in Spanien und den Niederlanden außerdem den Nachweis, dass Menschen mit dieser bestimmten Form der erblichen Schwerhörigkeit in ihren Fingern eine erhöhte Sensibilität für die Wahrnehmung von Vibrationen haben.
Einen in seiner Bedeutung möglicherweise ähnlichen Durchbruch erzielte sein Team erneut im vergangenen Jahr. Thomas Jentsch, Felizia Voss und Tobias Stauber gelang es, einen anderen Chloridkanal zu identifizieren, der seit über 20 Jahren biophysikalisch bekannt war, aber dessen molekulare Identität trotz Anstrengungen vieler Gruppen erfolglos gesucht wurde. Dieser Anionen-Kanal VRAC ist eine Art „Druckventil“ in der Zellhülle. Damit regulieren Zellen ihr Volumen, um zu verhindern, dass sie, wenn sie zu stark anschwellen, platzen. Im Gegensatz zu den CLCs ist dieser Kanal auch durchlässig für kleine organische Substanzen, die unter anderem auch Botenstofffunktionen ausführen. Dieser Befund wird ebenfalls ein neues wichtiges Forschungsfeld begründen, ist Prof. Jentsch überzeugt.
Studium der Physik und Medizin
Thomas Jentsch wurde 1953 in Berlin geboren und studierte dort an der Freien Universität (FU) Physik und Medizin. 1982 promovierte er an der FU Berlin und am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Physik, 1984 in Medizin. Danach arbeitete er am Institut für Klinische Physiologie der FU und ging von 1986 – 1988 an das Whitehead Institute des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, USA.
1988 wurde er Forschungsgruppenleiter am Zentrum für Molekulare Neurobiologie Hamburg (ZMNH) und war dort von 1993 - 2006 Direktor des Instituts für Molekulare Neuropathobiologie. 1998 bekam er einen Ruf an die ETH Zürich und 2000 einen Ruf als Direktor an das Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin in Göttingen. 2006 beriefen ihn das Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) und das Max-Delbrück-Centrum gemeinsam nach Berlin-Buch.
Für seine Forschungen erhielt Prof. Jentsch zahlreiche Auszeichnungen im In- und Ausland, darunter den höchstdotierten deutschen Förderpreis, den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (1995), den Franz-Volhard-Preis für Nephrologie (1998), den Zülch-Preis für Neurologie der Gertrud-Reemtsma-Stiftung (1999), den Prix Louis-Jeantet de Médecine (2000), den Ernst Jung-Preis für Medizin (2001) sowie den Adolf Fick-Preis für Physiologie und den Homer W. Smith Award für Nephrologie (beide 2004).
Prof. Jentsch ist gewähltes Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, der Academia Europaea, sowie der Hamburger Akademie der Wissenschaften. Er gehört zu den deutschen Wissenschaftlern, die weltweit am häufigsten zitiert werden.
*The Journal of Physiology
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/tjp.2015.593.issue-18/issuetoc \n
Foto: Prof. Thomas Jentsch (Photo: David Ausserhofer/ Copyright: MDC)
leben / 15.09.2015
21. Wirtschaftstag des Bezirkes Pankow: "Die wachsende Stadt - Flächen, Förderung, Fachkräfte"
„Pankow ist seit Jahren der Wachstumsmotor der Hauptstadt. Diese erfreuliche Tatsache stellt Politik und Wirtschaft aber auch vor große Herausforderungen. Die Konkurrenz um freie, bebaubare Flächen steigt und die Werbung um Fördergelder und Fachkräfte nimmt zu. Der Wirtschaftstag bietet Gelegenheit sowohl die öffentlichen als auch privatwirtschaftlichen Interessen zu benennen und nach gegenseitigen Unterstützungsmöglichkeiten zu suchen“, so Bezirksbürgermeister und Einladender Matthias Köhne (SPD).
\nAls Gäste sind Melanie Bähr (Stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der IHK), Christian Krüger (Investitionsbank Berlin), Theo Winters (Geschäftsführer der S.T.E.R.N. GmbH), Roland Eggert (INKON GmbH/Flächenentwickler) und Reinhard Garske (Unternehmer / Autoteile Berlin) geladen. Moderiert wird der Abend von Daniel Gäsche, Journalist des RBB-Fernsehens.
\nInteressierte sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten bis 30. September 2015 unter Fax: 030 9120 6773 oder E-Mail: info@tic-berlin.de.
Uhrzeit: 06.10.2015, Beginn 18.00 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr)
Ort: Prenzlauer Karree, Prenzlauer Promenade 28
13088 Berlin
(Tram M2, Bus 255, Parkplätze begrenzt vorhanden)
leben, erkunden, bilden / 09.09.2015
Ferienprogramm im Gläsernen Labor
Kinder ab sechs Jahren können hier an allen Ferientagen unter dem Motto „Bunt ist der Herbst“ experimentieren. So können die Jungforscher an einem Ferientag Experimente mit Eis und Feuer durchführen. In einem Ganztagsprogramm wird den Anfängen der Fotografie auf den Grund gegangen, dabei wird nicht nur fotografiert sondern der Film auch selbst entwickelt. Wem das zu technisch ist, kann an einem anderen Tag erfahren, wie aus der bitteren Kakaobohne eine zartschmelzende süße Schokolade wird. Wer lieber etwas zum Thema Biologie erfahren möchte, kann lernen, wie das Ohr aufgebaut ist und wie es funktioniert. Am letzten Ferientag darf natürlich eine schaurig schöne Halloweenparty mit spannenden Experimenten nicht fehlen.
Die Kurse starten um 9 Uhr und enden bei den Ganztagskursen maximal um 17 Uhr. Wem das zu lang ist, kann sich an einigen Tagen ein Vormittagsangebot von 9 bis 13 Uhr oder ein Nachmittagstermin von 14.30 bis 17 Uhr aussuchen.
Alle weiteren Informationen sowie die Anmeldungsformulare finden Sie unter:
www.forscherferien-berlin.de
leben, heilen / 08.09.2015
Prüfen – Rufen – Drücken: HELIOS Klinikum Berlin-Buch macht alle Mitarbeiter zu Ersthelfern
Es kann überall und jederzeit passieren, auch im Krankenhaus: Ein Mensch sackt in sich zusammen und bleibt regungslos am Boden liegen. Tägliche Routine in den lebensrettenden Erstmaßnahmen haben vor allem die Mitarbeiter der Notfallbereiche, der Anästhesie und Intensivstationen sowie der klinikeigenen Notfall-Teams. Die meisten Menschen hatten dagegen ihren letzten Erste-Hilfe-Kurs im Vorfeld der Führerscheinprüfung. Die Unsicherheit ist daher groß, im Notfall etwas falsch zu machen. „Für Betroffene aber entscheiden die ersten Minuten oft über mögliche Folgeschäden oder im schlimmsten Fall über Leben und Tod.“, sagt Prof. Dr. med. Henning Baberg, Chefarzt Klinik und Poliklinik für Kardiologie und Nephrologie.
Im HELIOS Klinikum Berlin-Buch werden daher 2015 in regelmäßigen Abständen Erste-Hilfe-Kurse für alle Mitarbeiter verpflichtend angeboten. Der 45-minütige Basiskurs „Basic Life Support“ ist für alle medizinischen und pflegerischen Mitarbeiter – aber auch für Mitarbeiter aus den Bereichen Service und Verwaltung. Egal ob Sekretärin, IT-Mitarbeiter oder Servicekraft – alle frischen nach dem Prüfen-Rufen-Drücken-Prinzip auf, was im Notfall zu tun ist: Prüfen, ob die Person ansprechbar ist und atmet. Wenn nicht, Notruf wählen und anschließend direkt mit der lebensrettenden Herzdruckmassage beginnen. Geübt wird an speziellen Erste-Hilfe-Puppen.
Für Mitarbeiter in Risikobereichen, wie Mitarbeiter der Intensivstationen, der kardiologischen Funktionsbereiche und der Notfallzentralen, gibt es darüber hinaus sogenannte „Advanced Life Support“ – Kurse, die den sicheren Umgang mit Defibrillatoren, die Intubation und die medikamentöse Reanimation sichern.
Die Aktion wird deutschlandweit an allen 111 HELIOS Standorten durchgeführt.
Die letzte „Basic Life Support“-Schulung in Berlin-Buch fand am 1. September 2015 statt und wurde von den Mitarbeitern des HELIOS Klinikums Berlin-Buch durchweg positiv gesehen. „Gerade die Mitarbeiter aus den
nichtmedizinischen Bereichen sehen die Schulung nicht nur als Plicht, sondern als willkommene Gelegenheit, ihre Kenntnisse noch einmal aufzufrischen“, sagt Prof. Dr. med. Henning Baberg, Chefarzt der Klinik und Poliklinik für Kardiologie und Nephrologie und Ärztlicher Direktor.
Das Reanimationstraining nach Mindeststandard ist verbindlicher
Bestandteil der jährlichen Fortbildung aller knapp 2.500 Beschäftigten im HELIOS Klinikum Berlin-Buch und gewährleistet auch die medizinische Sicherheit der Patienten und Besucher im Krankenhaus.
Für den HELIOS Standort Berlin-Buch bedeutet dies, dass allein im Jahr 2015 100 „Basic Life Support“-Schulungen und über 50 „Advanced Life Support“ -Kurse stattfinden.
Hintergrundinfo
Das Schlimmste, was man in einer Nothilfesituation machen kann, ist nichts zu tun. Als erstes muss geprüft werden, ob die Person in Not ansprechbar ist und atmet. Ist dies nicht der Fall, heißt es für den Helfer „Notruf wählen“ oder jemanden damit beauftragen. Nach einer Atemkontrolle sollte sofort mit der Herzdruckmassage begonnen werden. Sie ist und bleibt das wirksamste Instrument bei einem Herzstillstand. Dazu drückt man schnell und fest etwa 100 bis 120 Mal pro Minute auf das untere Drittel des Brustbeins, so lange bis professionelle Hilfe eintrifft. Wer sich unsicher mit der Schnelligkeit ist, kann auch das Lied „Staying alive“ von den Bee Gees mitsummen, es hat den optimalen Rhythmus für eine Wiederbelebung. Optimal ist es, wenn ergänzend auch eine Beatmung (Mund-zu-Mund oder mit Beatmungsbeutel) durchgeführt wird: 30 Mal das Herz drücken und dann zwei Atemspenden geben.\n
\n
Über die HELIOS Kliniken Gruppe
\nZur HELIOS Kliniken Gruppe gehören 111 eigene Akut- und Rehabilitationskliniken inklusive sieben Maximalversorger in Berlin-Buch, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Schwerin, Wuppertal und Wiesbaden, 50 Medizinische Versorgungszentren (MVZ), fünf Rehazentren, zwölf Präventionszentren und 15 Pflegeeinrichtungen. HELIOS ist damit einer der größten Anbieter von stationärer und ambulanter Patientenversorgung in Deutschland und bietet Qualitätsmedizin innerhalb des gesamten Versorgungsspektrums. Sitz der Unternehmenszentrale ist Berlin.
HELIOS versorgt jährlich rund 4,5 Millionen Patienten, davon 1,2 Millionen stationär. Die Klinikgruppe verfügt insgesamt über mehr als 34.000 Betten und beschäftigt rund 68.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2014 erwirtschaftete HELIOS einen Umsatz von rund 5,2 Milliarden Euro. Die Klinikgruppe gehört zum Gesundheitskonzern Fresenius.
Foto: HELIOS Klinikum Berlin-Buch. Mitarbeiter aus alle Bereichen: Ein Leben retten (Foto: HELIOS Kliniken, Jürgen Dachner)
produzieren / 03.09.2015
Dr. Harald Hasselmann wird neuer Geschäftsführer der Eckert & Ziegler BEBIG
Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen beim Medizintechnikunternehmen Eckert & Ziegler BEBIG (Euronext: EZBG; Reuters: EZBG.BR; Bloomberg: EZBG:BB) hat der Verwaltungsrat den Betriebswirt Dr. Harald Hasselmann (48) zum neuen kaufmännischen Geschäftsführer für die Bereiche Vertrieb und Finanzen berufen. Mit Wirkung zum 01.10.2015 ergänzt er die Geschäftsführung und wird gemeinsam mit dem Medizinphysiker Dr. Edgar Löffler, der für die technischen Bereiche des Bestrahlungsgeräteherstellers verantwortlich zeichnet, das Unternehmen führen. Abel Luzuriaga, der seit 2012 als Geschäftsführer die Bereiche Vertrieb und Marketing der Eckert & Ziegler BEBIG leitete, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen.
Der gebürtige Hamburger Hasselmann verfügt über langjährige Erfahrung in internationalen Pharmaunternehmen. Unter anderem leitete er bei Bayer Pharma das Controlling für die Region Europa, für Schering die ungarische Tochtergesellschaft und die Berliner Biotechnologiefirma metaGen. Er blickt auf Stationen in großen und mittelständischen Gesundheitsunternehmen zurück und besitzt eine ausgewiesene Expertise im Vertrieb, Controlling und der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen.
„Mit Herrn Dr. Hasselmann haben wir einen idealen Branchenexperten gewinnen können, der die Schlagkraft und Kompetenz im Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung unserer Sanierungsstrategie erheblich erweitert“, erklärt Dr. Edgar Löffler, Geschäftsführender Direktor der Eckert & Ziegler BEBIG SA. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei Eckert & Ziegler BEBIG. Dabei stehen die Profitabilität und das Wachstum des Unternehmenssegments auf internationaler Ebene im Vordergrund“, ergänzt Dr. Harald Hasselmann.
Der Verwaltungsrat dankt Herrn Luzuriaga für die geleistete Arbeit, insbesondere für seine Verdienste um den Ausbau des Marktes für Tumorbestrahlungsgeräte.
Über Eckert & Ziegler BEBIG
Eckert & Ziegler BEBIG ist einer der weltweit führenden Anbieter für Brachytherapieprodukte. Brachytherapie ist eine Form der Strahlentherapie, die Tumore aus einer sehr kurzen Entfernung bestrahlt. Zu den Produkten gehören radioaktive Kleinimplantate zur Behandlung von Prostatakrebs (Seeds) sowie Tumorbestrahlungsgerate (Afterloader). Eckert & Ziegler BEBIG beschäftigt weltweit rund 180 Mitarbeiter und ist seit 1997 an der Euronext gelistet.
Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:
Eckert & Ziegler BEBIG SA
Investor Relations & Communications
Tel: +32 64 520 808
Fax: +32 64 520 801
E-Mail: ir@bebig.com
Eckert & Ziegler AG
Investor Relations & PR
Karolin Riehle
Tel: +49 30 94 10 84-138
Fax: +49 30 94 10 84-112
E-Mail: karolin.riehle@ezag.de
forschen, investieren, produzieren / 01.09.2015
Geschäftsführerwechsel bei der Campusbetreibergesellschaft – Doppelspitze bleibt erhalten
Dr. Christina Quensel, geboren 1969 in Berlin, studierte von 1988 bis 1993 zuerst an der Humboldt Universität zu Berlin und später an der Technischen Universität Berlin (TU Berlin) „Biotechnologie“. Nach ihrer Doktorarbeit am Institut für Zell- und Molekularbiologie der Schering AG Berlin und Promotion an der TU Berlin 1997 arbeitete sie zunächst als Wissenschaftlerin am Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin (MDC). 2004 wechselte sie als Referentin zum Wissenschaftlichen Vorstand des MDC. Hier war sie für ein breites Spektrum an unterschiedlichsten Aufgaben zuständig, darunter Flächenmanagement, Technologietransfer, Core Facilities sowie Schnittstelle zur Administration und insbesondere BBB. Daneben qualifizierte sie sich an der Helmholtz-Akademie und am Malik Management Zentrum St. Gallen sowie durch ein Fernstudium der Betriebswirtschaft an der Fernuniversität Hagen weiter.
Dr. Ulrich Scheller wurde 1964 in Grimma, Sachsen geboren. Von 1983 bis 1988 studierte er an der Universität Charkow, Ukraine, Biochemie, wo er auch sein Diplom erhielt. Seine Diplomarbeit schrieb er von 1987 bis 1988 am Allunions-Herz-Kreislauf-Forschungsinstitut in Moskau, Sowjetunion. Danach war er bis 1990 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mikrobiologie der Universität Leipzig und arbeitete anschließend bis 1991 am ZIM. Nach der Wende war er von 1992 bis 1996 wissenschaftlicher Mitarbeiter am MDC und ging nach seiner Promotion mit einem Forschungsstipendium der Leopoldina für ein Jahr an das Max-Planck-Institut für Biophysik nach Frankfurt/Main. Von 1997 bis 1999 baute er als Projektleiter das „Gläserne Labor“ der BBB auf. Nach achtjähriger Tätigkeit als Teamleiter der Campus-Öffentlichkeitsarbeit wechselt er im Jahre 2008 in die Geschäftsführung des Unternehmens.
forschen, heilen / 31.08.2015
MDC- und Charité-Forscher: Mit Gen MACC1 Hochrisikopatienten mit Gallenwegskarzinom erkennen - Entscheidungshilfe für Leberoperationen
Die Gallenwege sind das Abflusssystem für die von den Leberzellen produzierte Galle. Es gibt Gallengänge innerhalb und außerhalb der Leber. Die Gallengänge des rechten und linken Leberlappens vereinigen sich zum Hauptgallengang, der in den Zwölffingerdarm mündet. Dort wird die Galle für die Fettverdauung benötigt.
Zu den Gallenwegskarzinomen zählen das Klatskin-Karzinom, benannt nach dem amerikanischen Internisten Gerald Klatskin, und das intrahepatische Cholangiokarzinom (engl. Abkürzung: ICC). Diese Karzinome sind zwar selten – in Europa und den USA ist einer unter 100 000 Menschen betroffen – doch zählen sie neben dem Leberzellkarzinom zu den zweithäufigsten Karzinomen der Leber. Da sie meist zu spät erkannt werden, sind sie schwer zu behandeln und die Lebenserwartung der betroffenen Patienten ist stark eingeschränkt: Ungefähr 30 Prozent der Patienten überleben die ersten fünf Jahre nach einer Leberoperation.
Beim Klatskin-Karzinom staut sich die Galle am Zusammenfluss (Hepatikusgabel) der verschiedenen Gallengänge der Leber. Häufig ist das Karzinom bei der Diagnose schon so weit fortgeschritten, dass auch eine radikale Entfernung des Karzinoms unmöglich ist. Letzter Ausweg ist in solchen Fällen eine Lebertransplantation, die derzeit allerdings nur im Rahmen von Studien durchgeführt wird.
Bislang hatten die Ärzte keine Anhaltspunkte dafür, welchen Patienten am ehesten mit einer Lebertransplantation geholfen werden könnte. Erschwert wird diese Entscheidung zusätzlich durch den Organmangel. Andri Lederer, der ein Jahr im Labor von Prof. Stein am MDC arbeitete und auch in der Klinik für Allgemein-, Visceral- und Transplantationschirurgie der Charité bei Prof. Johann Pratschke tätig ist, betont: „Die Patienten mit einem Klatskin-Karzinom profitieren unter Umständen auch von einer Lebertransplantion und können lange leben, vorausgesetzt sie haben ein geringes Rückfallrisiko.“
MACC1 Gen hilft das Risiko zu bestimmen
Mit dem Metastasierungsgen MACC1 können Ärzte dieses Risiko jetzt zum ersten Mal auch für das Klatskin-Karzinom bestimmen. Dieses Gen hatten Prof. Stein, Prof. em. Peter Schlag (MDC und Charité) sowie Prof. Walter Birchmeier (MDC) 2009 in Gewebeproben von Darmkrebspatienten entdeckt. Es fördert nicht nur das Krebswachstum sondern auch die Metastasenbildung, weshalb sie das Gen kurz MACC1 nannten. (Die englische Abkürzung steht für „mit Metastasen verbundener Dickdarmkrebs 1“). Das Gen ist auch Hauptregulator des sogenannten HGF/Met-Signalwegs. Er steuert Zellwachstum, Zellwanderung und auch die Entstehung von Tochtergeschwülsten (Metastasen). Darüber hinaus spielt das Gen Met in diesem Signalweg eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Klatskin-Karzinoms.
Die Chirurgen Andri Lederer, Prof. Daniel Seehofer, Prof. Johann Pratschke und Prof. Schlag, sowie der Pathologe Prof. Manfred Dietel und die Krebsforscherin Prof. Stein untersuchten Gewebeproben von insgesamt 156 Patienten mit Klatskin- und ICC-Karzinomen, denen zwischen 1998 und 2003 ein Teil der Leber entfernt worden war. Unter ihnen befanden sich 76 Patienten mit Klatskin-Karzinomen. Die Gewebeproben enthielten sowohl Krebsgewebe, als auch karzinomfreies Gewebe. Hinzu kamen Gewebeproben von Patienten mit gutartigen Lebererkrankungen.
Aktivität von MACC1 in Krebsgewebe um das Zehnfache erhöht
Die Untersuchung ergab, dass das Gen MACC1 in dem Karzinomgewebe 10mal höher angeschaltet war als in gesundem Gewebe. Auch in Karzinomen, die sich nach der Operation bei den Patienten wieder gebildet hatten, war MACC1 viel stärker aktiv als in gesundem Gewebe. Die Überlebenszeit der Patienten mit hohen MACC1-Werten betrug im Schnitt etwas weniger als zwei Jahre (613 Tage), bei Patienten mit niedrigen MACC1-Werten hingegen über sechs Jahre (2257 Tage).
Die rückfallfreie Zeit, also die Zeit ohne Wiederauftreten des Karzinoms, betrug bei den Patienten mit hohen MACC1-Werten knapp zwei Jahre (753 Tage), bei Patienten mit niedrigen MACC1-Werten hingegen fast neun Jahre (3119 Tage).
Als Biomarker für das ICC-Karzinom erwies sich MACC1 jedoch als nicht geeignet. Die Forscher vermuten, dass ICC- und Klatskin-Karzinome sich klinisch unterschiedlich verhalten, da sie auch aus unterschiedlichen Gallenwegen innerhalb bzw. außerhalb der Leber stammen.
MACC1 – nicht nur Biomarker, sondern auch Angriffsziel
MACC1 ist darüber hinaus ursächlich für die Entstehung von Tochtergeschwülsten (Fernmetastasen) verantwortlich. Die Kliniker und Forscher sehen deshalb in MACC1 nicht nur einen Indikator für die Schwere einer Erkrankung, sondern auch ein Angriffsziel für eine Therapie. In präklinischen Studien testen Prof. Stein und ihre Kollegen bereits neue Substanzen, die sowohl die Expression als auch die Aktivität des MACC1-Gens hemmen.
Bluttest als Früherkennung
Je früher eine Krebserkrankung erkannt wird, desto größer sind die Aussichten auf eine erfolgreiche Therapie und eine lange Überlebenszeit. Deshalb hat Prof. Stein einen Bluttest zur Krebsfrüherkennung entwickelt, der auf dem MACC1-Gen basiert. Mit dem Bluttest ist es möglich, bereits in einem sehr frühen Stadium einer Krebserkrankung (Darmkrebs, Magenkrebs, Lungenkrebs) die Patienten zu erkennen, die ein hohes Risiko haben, lebensbedrohliche Metastasen zu bekommen. Mittlerweile ist der Test zum Nachweis von MACC1 in Tumoren und in Blut in den USA, Australien, Japan, Kanada und Europa patentiert.
Ziel ist, in Zukunft solche Früherkennungstests mit MACC1 auch für andere Krebserkrankungen, darunter auch das Klatskin-Karzinom zu entwickeln. Denn seit 2009 konnten Prof. Stein und Forscher aus verschiedenen Ländern zeigen, dass zwischen einer erhöhten MACC1-Expression und einer kürzeren Überlebenszeit der Patienten ein Zusammenhang bei vielen Karzinomen besteht. Dazu zählen Leberkrebs, Magenkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Lungenkrebs, Eierstockkrebs, Brustkrebs, Nasen-Rachen-Krebs, Speiseröhrenkrebs, Nierenkrebs, Blasenkrebs, Gallenblasenkrebs, Glioblastom und Knochenkrebs.
*MACC1 is an independent prognostic biomarker for survival in Klatskin tumor patients.
leben, bilden / 31.08.2015
Zu Besuch im Bundesministerium für Bildung und Forschung
Bundesministerin Johanna Wanka nutzte den Tag der offenen Tür, um mit den Gästen ins Gespräch zu kommen und am Stand des Gläsernen Labors zu experimentieren. Frau Wanka verriet Biologin Claudia Jacob vom Gläsernen Labor, dass ihr Großvater Imker war. Als Kind hat sie ihrem Großvater beim Schleudern des Honigs geholfen. Neben dem Thema Bienen in der Großstadt konnten die Besucher am Experimentierstand des Gläsernen Labors viele anschauliche Experimente zur Energiewende ausprobieren. In einem Experiment konnte Wasser mit Muskelkraft in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten werden. Mit dem so erzeugten Wasserstoff wurde über eine Minibrennstoffzelle ein Modellauto angetrieben.\n
\n
Foto: Experimentieren mit dem Gläsernen Labor (Foto: Heidi Sommer)
\n
Zur Seite des Bundesministeriums
www.bmbf.de/de/29263.php
leben / 27.08.2015
„Steine ohne Grenzen“ - Bezirksbürgermeisters beim Bildhauerprojekt mit Geflüchteten im Refugium Buch
Täglich ab 15 Uhr haben Jugendliche und Erwachsene des AWO Refugiums Buch die Möglichkeit, unter Anleitung der beiden Initiatoren des Projekts, den Bildhauern Silvia Fohrer und Rudolf J. Kaltenbach, die großen Steinblöcke zu gestalten. Sie können ihren Wünschen, Sorgen und Ängsten auf diese Weise Ausdruck verleihen. Das Angebot wird gut angenommen. „Es freut mich zu sehen, dass die Menschen, die hier leben, ihren Ort mitgestalten wollen. Auch ohne große Worte können sie so ausdrücken, was sie bewegt“ sagt Bezirksbürgermeister Matthias Köhne.
\nDerzeit leben in der Flüchtlingsunterkunft 480 Geflüchtete, davon sind 132 Kinder und Jugendliche. Mittlerweile sind schon mehrere große Sandsteinblöcke bildhauerisch bearbeitet worden und können auf dem Gelände des AWO Refugiums Buch, Karower-Chaussee/Groscurthstr. 29-33, besichtigt werden. Mehr Informationen zu dem Projekt „Steine ohne Grenzen“ gibt es unter: http://steineohnegrenzen-refugiumbuch.jimdo.com/
\nVom 1. – 27. September 2015 organisiert Herr Kaltenbach im Bucher Forst ein Symposium mit 20 Künstlerinnen und Künstlern, die für einen Monat Skulpturen aus Sandstein, Holz und Metall gestalten werden. Die dabei entstehenden Skulpturen sollen zum Abschluss des Projekts mit den von den Flüchtlingen gestalteten Steinen symbolisch zusammengeführt werden.
\nMehr dazu finden Sie hier.
\n\n
Foto: Der Pankower Bezirksbürgermeister Matthias Köhne im Gespräch mit Bildhauer Rudolf J. Kaltenbach und einem Bewohner des Refugiums Buch. Im Projekt „Steine ohne Grenzen“ auf dem Gelände der Flüchtlingsunterkunft können Jugendliche und Erwachseneihre Wünsche, Sorgen und Ängste bildhauerisch verarbeiten. (Foto: Bezirksamt Pankow)
\n
forschen / 27.08.2015
New Yorker Spitzenforscher kommt nach Berlin
Der deutsche Mediziner Erwin Böttinger wechselt von New York nach Berlin und wird neuer Vorstandsvorsitzender des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung (BIG). Er tritt am
1. November 2015 die Nachfolge von Ernst Theodor Rietschel an. Mit dem Amtsbeginn beim Berliner Institut für Gesundheitsforschung erhält Böttinger zugleich einen Ruf als Professor für „Personalisierte Medizin“ an die Charité - Universitätsmedizin Berlin.
Erwin Böttinger ist seit 2004 an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York tätig, seit 2007 ist er dort Direktor des Charles Bronfman Instituts für personalisierte Medizin. Nach dem Medizinstudium an der Universität in Erlangen-Nürnberg ging er 1987 in die USA, wo er unter anderem am Massachusetts General Hospital, der Harvard Medical School sowie am National Cancer Institute in Bethesda als Forscher tätig war. Von 2000 bis 2004 leitete er das Zentrum für Biotechnologie am Albert Einstein College of Medicine in New York. Forschungsschwerpunkt des Nierenspezialisten ist das Gebiet der personalisierten Medizin. Sie nutzt Ansätze der Genomik und Bioinformatik, um molekulare Krankheitsmechanismen identifizieren zu können, mit dem Ziel Vorbeugung, Diagnose und Therapie zu verbessern.
„Die Rückkehr eines international so erfolgreichen Forschers wie Herrn Erwin Böttinger freut mich ganz besonders, denn sie zeigt: Deutschland ist ein hochattraktiver Standort für internationale Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher. Mit seiner Expertise in dem zukunftsträchtigen Thema der personalisierten Medizin kann Herr Böttinger wichtige Impulse in der Gesundheitsforschung setzen und das Berliner Institut für Gesundheitsforschung deutschlandweit und international hervorragend positionieren“, sagte die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Johanna Wanka.
Auch für Berlin ist Erwin Böttinger ein großer Gewinn. Sandra Scheeres, Wissenschaftssenatorin des Landes Berlin und Aufsichtsratsvorsitzende der Charité betont: „Mit Erwin Böttinger haben wir eine international herausragende Persönlichkeit nach Berlin geholt. Herr Böttinger wird das Institut und damit die biomedizinische Forschung in Berlin voranbringen. Berlins Spitzenstellung in der Gesundheitsforschung erfährt eine weitere Stärkung.“
„Die Führung des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung als neue Körperschaft des öffentlichen Rechts und außeruniversitäre Wissenschaftseinrichtung des Landes Berlin ist eine einzigartige Aufgabe, die ich mit großer Begeisterung übernehme, denn am Max- Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin und der Charité - Universitätsmedizin Berlin arbeiten exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Außerdem verfügen beide Einrichtungen über hochmoderne Technologieplattformen für innovative biomedizinische Forschung. Diese müssen optimal zusammengeführt und in translationaler Forschung zum Wohle der Patientinnen und Patienten zur translationalen Anwendung gebracht werden. Damit können wir die großen medizinischen Herausforderungen der Zukunft in Prävention, Diagnose und Therapie meistern. Ernst Rietschel hat als Gründungs-Vorstandsvorsitzender dafür bedeutende Vorarbeit geleistet“, sagt Erwin Böttinger.
Böttinger wird als hauptamtlicher Vorstandsvorsitzender die Arbeit des BIG-Vorstands leiten und zusammen mit den Vorstandsvorsitzenden des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin und der Charité - Universitätsmedizin Berlin, dem Dekan der Charité - Universitätsmedizin Berlin sowie einem hauptamtlichen administrativen Vorstandsmitglied die strategische und wissenschaftliche Planung und deren Erfolgskontrolle verantworten. Der Vorsitzende des Vorstands wird vom Aufsichtsrat des BIG bestellt.
Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung wird seit 2015 zu 90 Prozent vom Bund und zu zehn Prozent vom Land Berlin finanziert. Für das Haushaltsjahr 2015 beträgt das Volumen 44 Millionen Euro und soll 2018 auf ein Volumen von jährlich 75,5 Millionen Euro anwachsen. Zudem unterstützt die private Initiative der kürzlich verstorbenen Stifterin der Stiftung Charité Johanna Quandt den Aufbau des Instituts mit insgesamt 40 Millionen Euro bis 2022.
Über das Berliner Institut für Gesundheitsforschung
Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung/Berlin Institut of Health (BIG/BIH) wurde 2013 gegründet. Es ist ein Zusammenschluss der Charité - Universitätsmedizin Berlin und des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC). Das BIG will mit neuen wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen in der Biomedizin neue diagnostische, therapeutische und präventive Ansätze in der Medizin und damit für die Gesundheit der Menschen schaffen. Dazu verfolgt das BIG einen systemmedizinischen, den ganzen Organismus betrachtenden Ansatz. Ziel des BIG ist, die Übertragung von Forschungserkenntnissen in die Klinik sowie die Rückkoppelung klinischer Befunde in die Grundlagenforschung zu beschleunigen und damit die translationale Medizin voranzubringen. Seit April 2015 ist das Berliner Institut für Gesundheitsforschung rechtlich selbstständige Körperschaft des öffentlichen Rechts, Charité und MDC sind darin rechtlich selbstständige Gliedkörperschaften.\n
\n
- Gemeinsame Pressemitteilung vom Bildungsministerium für Bildung und Forschung, der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft sowie vom Berliner Institut für Gesundheitsforschung -
Kontakte:
Markus Fels
Pressestelle
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Kapelle-Ufer 1 | 10117 Berlin | Germany
Tel. +49 (0)30 18 57-50 50
Fax +49 (0)30 18 57-55 51
presse@bmbf.bund.de
Thorsten Metter
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft
Bernhard-Weiß-Str. 6 | 10178 Berlin-Mitte | Germany
Tel. +49 (0)30 90227 5846
Fax +49 (0)30 90227 5020
Pressestelle@SenBJW.berlin.de
Alexandra Hensel
Leiterin Kommunikation/Presse
Berliner Institut für Gesundheitsforschung/Berlin Institute of Health (BIH)
Kapelle-Ufer 2 | 10117 Berlin | Germany
Tel. +49 (0)30 450 543019
Fax +49 (0)30 450 7543999
presse@bihealth.de
www.bihealth.org
forschen / 26.08.2015
Blasenentzündung: Wenn Bakterien die Angel auswerfen
Harnwegsinfektionen sind die häufigsten bakteriellen Entzündungen in Deutschland. Jede zweite Frau erkrankt mindestens einmal in ihrem Leben an einer Blasenentzündung, besonders quälend sind ständig wiederkehrende Infektionen. Dabei verfügt der Körper eigentlich über eine schlichte, aber effektive Abwehrmaßnahme: Geraten Bakterien in den Harntrakt, werden die Eindringlinge mit dem Urin wieder herausgespült. In manchen Fällen aber gelingt es ihnen, an der Innenwand der Blase Halt zu finden: So wie Moos in einem reißenden Fluss gedeihen kann, besiedeln die Einzeller dann die Schleimhäute der Harnwege – mit schmerzhaften Folgen.
Der überwiegende Teil der Harnwegsinfekte wird von Escherichia coli-Bakterien verursacht, die normalerweise im menschlichen Darm leben, und die auf ihrer Oberfläche mit Hunderten feinster Härchen, den sogenannten Pili bestückt sind. „Man kann sich jeden einzelnen Pilus wie eine Angelleine vorstellen“, sagt Adam Lange. „Die Leine ist fest und zugleich flexibel, und an ihrem Ende sitzt ein weiterer Eiweißbaustein, der sich wie ein Angelhaken spezifisch an bestimmte Moleküle der menschlichen Schleimhaut anheftet.“ Adam Lange untersuchte mit seiner Gruppe den Pilus vom Typ 1, durch den sich Darmbakterien an der Blaseninnenwand festsetzen. Er ist aus rund 3000 identischen Eiweißbausteinen aufgebaut, die perfekt ineinander passen und sich zu einer gewundenen Helix aneinanderlagern.
Die Analyse eines solch komplexen Gebildes ist für Strukturbiologen eine besondere Herausforderung, da der Molekülkomplex weder auskristallisiert noch löslich ist. Adam Lange, der vor zwei Jahren vom Europäischen Forschungsrat (ERC) eine Förderung über 1,5 Millionen Euro für die Erforschung von Infektionsmechanismen erhalten hat, ging das Problem daher mit einer Kombination dreier verschiedener Methoden an. Durch Elektronenmikroskopie wurde der Aufbau eines Pilus grob ersichtlich; mittels Kernspinresonanz (NMR) ermittelte er die atomare Struktur der einzelnen Eiweißbausteine. Und außerdem setzte er auch die noch junge Methode der Festkörper-NMR ein, mit der sich unlösliche Proteinaggregate analysieren lassen und zu deren Pionieren Lange gehört. „Je genauer wir Krankheitserreger bis hin ins atomare Detail verstehen, desto eher wird es gelingen, neue Wirkstoffe zu finden, die gezielt Infektionsmechanismen blockieren“, sagt Lange.\n
Text: Birgit Herden
Abbildung: Cartoon-Darstellung der Pilus-Struktur. Gezeigt werden sechs Pilusbausteine in einer Ansicht von oben. (Visualisierung: Lange, FMP)
Veröffentlichung:
Habenstein B, Loquet A, Hwang S, Giller K, Vasa SK, Becker S, Habeck M, Lange A. Hybrid Structure of the Type I Pilus of Uropathogenic E. coli (2015)
Angew Chem Int Ed Engl. DOI: 10.1002/anie.201505065. [Epub ahead of print]
Kontakt:
Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP)
Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin
Prof. Dr. Adam Lange
Tel: +49 30 947 93 191
E-mail: alange@fmp-berlin.de
Über das Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie
Das Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) gehört zum Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB), einem Zusammenschluss von acht natur-, lebens- und umweltwissenschaftlichen Instituten in Berlin. In ihnen arbeiten mehr als 1.500 Mitarbeiter. Die vielfach ausgezeichneten Einrichtungen sind Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft. Entstanden ist der Forschungsverbund 1992 in einer einzigartigen historischen Situation aus der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR.
leben, heilen / 26.08.2015
HELIOS Klinikum Berlin-Buch feiert großes Kindersommerfest
Eine musikalische Reise durch Afrika machen, Tanzen mit Detlef D! Soost und auf der Hüpfburg mal so richtig toben – das sollten sich kleine und große Kinder nicht entgehen lassen. Auf der Bastelstraße mit verschiedenen Materialien experimentieren, sich das Gesicht bunt bemalen lassen und noch viele andere Attraktionen warten auf die kleinen Besucher. Mit dabei sind auch die IFA-Freunde aus Trebus. Sie bringen ihre Oldtimer-Feuerwehr und ein Oldtimer-Polizeiauto mit, laden Groß und Klein zur Besichtigung und Probefahrt ein. Das Show- und Musikprogramm wird von Radio TEDDY organisiert. Highlight des Tages ist eine große Luftballon-Aktion. Unter dem Motto: „Mein Wunsch steigt in den Himmel“ werden unzählige Ballons mit großen und kleinen Wünschen der Gäste in den Himmel aufsteigen.
Das Motto des diesjährigen Sommerfestes im HELIOS Klinikum Berlin-Buch lautet: 20 Jahre Klinikclowns. Da ist es selbstverständlich, dass Clown Kalli nicht fehlen darf. Seit 20 Jahren besuchen er und andere Klinikclowns jeden Mittwoch die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Sie begleiten seit zwei Jahrzehnten kleine Patienten während ihrer Behandlung.
Im Rahmen des diesjährigen Festes hat das Team der Neonatologie alle frühgeborenen Kinder und ihre Eltern eingeladen. Im Mittelpunkt soll der Austausch von Erinnerungen an die gemeinsam verbrachten Tage und Stunden in der Klinik und die Freude über die Entwicklung der Sprösslinge stehen.
Das Kinder-Sommerfest wird organisiert durch das HELIOS Klinikum Berlin-Buch (Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin mit Neonatologie und Sozialpädiatrischem Zentrum, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinderneuroorthopädie, Kinderchirurgie) mit den Vereinen Berliner Herz, Initiative für chronisch kranke Kinder (ICKE) in Buch, Kinder in seelischer Not, Kinderlächeln, Kolibri, Tollkühn, der Rheumaliga sowie dem Bucher Ronald McDonald Elternhaus. Schirmherr ist der Berliner Gesundheitssenator Mario Czaja.
Sollte es das Wetter nicht zulassen draußen zu feiern, werden die kleinen und großen Gäste im Foyer und in der Shopmeile des Klinikums erwartet.
Veranstaltungszeit: Sonnabend, 5. September 2015, 14 bis 17 Uhr
Veranstaltungsort: HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei.
Zur HELIOS Kliniken Gruppe gehören 110 eigene Akut- und Rehabilitationskliniken inklusive sieben Maximalversorger in Berlin-Buch, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Schwerin, Wuppertal und Wiesbaden, 49 Medizinische Versorgungszentren (MVZ), fünf Rehazentren, elf Präventionszentren und 15 Pflegeeinrichtungen. HELIOS ist damit einer der größten Anbieter von stationärer und ambulanter Patientenversorgung in Deutschland und bietet Qualitätsmedizin innerhalb des gesamten Versorgungsspektrums. Sitz der Unternehmenszentrale ist Berlin.
HELIOS versorgt jährlich mehr als 4,2 Millionen Patienten, davon mehr als 1,2 Millionen stationär. Die Klinikgruppe verfügt insgesamt über mehr als 34.000 Betten und beschäftigt rund 69.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2013 erwirtschaftete HELIOS einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro. Die Klinikgruppe gehört zum Gesundheitskonzern Fresenius.
Foto: Die Clowns Betty und Kalli während der Clownsprechstunde in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. (Foto: HELIOS Kliniken/Thomas Oberländer)
Klinikkontakt:
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Prof. Dr. med. Lothar Schweigerer
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
Tel.: +49 (0)30 9401-54500
http://www.helios-kliniken.de
https://www.facebook.com/kinderklinik.berlin
leben, heilen, bilden / 25.08.2015
ZukunftsForum „Gesundheit neu denken“ lädt zu Bürgerdialog mit Bundesforschungsministerin Johanna Wanka
8. September, um 18:00 einlädt.
Der tiefgreifende Wandel der Informations- und Kommunikations- technologie bietet vielversprechende Möglichkeiten für die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens und der Pflege. Bürgerinnen und Bürger können mit der Ministerin und Expertinnen und Experten über Themen wie Telemedizin, eHealth und "Wearables" sprechen.
Die Veranstaltung im Berliner Dienstsitz des Bundesministeriums für Bildung und Forschung am Kapelle-Ufer 1, Berlin-Mitte (Nähe HBF), ist Teil des Bürgerdialogs „Gut leben in Deutschland“ der Bundesregierung.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich für die Teilnahme jetzt unter www.zukunft-verstehen.de/registrieren anmelden.
Einen Überblick über die neue Bürgerdialogreihe der ZukunftsForen erhalten Sie hier.
forschen / 25.08.2015
MDC- und MHH-Forscher zeigen, wie Membranen abgeschnürt werden – ein lebenswichtiger Prozess
Zur Weiterleitung von Signalen schütten Nervenzellen Botenstoffe aus, die in Vesikel verpackt sind. Diese Vesikel entstehen durch Membraneinstülpungen der Zellwand, die durch Dynamin abgeschnürt werden: Dazu wickelt sich zunächst eine Kette aus Dynamin spiralförmig um den Hals des entstehenden Vesikels. In einem zweiten Schritt erfolgt die energieabhängige Verengung der Spirale und die Freisetzung des Vesikels.
Die Wissenschaftler konnten die 3-dimensionale Struktur des Grundbausteins der Spirale aufklären. Er besteht aus vier Einheiten des molekularen Motors Dynamin, einem sogenannten Dynamin-Tetramer. "Wir sehen in der Struktur zum ersten Mal, wie genau sich die Dynamin-Tetramere zu einer Spirale aneinanderlagern", erklärt Dr. Katja Fälber aus der Kristallographie-Abteilung des MDC. "Die Struktur erklärt auch, warum dieser Prozess nur an Membranen erfolgt: Nur dort finden Umlagerungen im Dynamin-Tetramer statt, die die Kontaktstellen zur Spiralbildung freigeben.", erläutert Prof. Oliver Daumke.
**Crystal structure of the dynamin tetramer
\n
Foto: Prof. Oliver Daumke und Dr. Katja Fälber (Foto: privat)
leben, bilden / 24.08.2015
Ein spannender Ferientag für die Kinder aus dem Refugium Buch
Das Gläserne Labor veranstaltete am 21. August 2015 einen spannenden Forscherferientag unter Leitung von Dr. Bärbel Görhardt und Dr. Cornelia Stärkel für die Kinderfreizeitgruppe des Flüchtlingsheims Refugium Buch. Die Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren wurden zusammen mit den Betreuerinnen morgens beim Refugium abgeholt und zum Labor begleitet. Dort erwartete sie ein vielfältiges Programm mit kleinen, gut verständlichen Experimenten zu den Themen Magnetismus und Strom. Trotz Sprachbarriere waren die Kinder sofort begeistert und experimentierten sehr eifrig mit.
\nZwischendurch gab es selbstgebackenen Kuchen für alle und zum Schluss durfte jedes Kind einen Beutel mit Bastelanleitungen und einem Comic-Heft mitnehmen. Der Forscherferientag war ein voller Erfolg und für die Kinder aus dem Refugium eine schöne Abwechslung.
\nDie Kursgebühren übernahm das Gläserne Labor.
\n
heilen / 11.08.2015
Allogene Blutstammzelltransplantation im HELIOS Klinikum Berlin-Buch etabliert
In der Behandlung von Leukämien, Lymphomen und Multiplem Myelom -vor allem durch intensive Chemo-/Immuntherapien und die autologe Stammzelltransplantation - hat das Bucher Klinikum eine langjährige Tradition. Nun wurde das therapeutische Spektrum durch ein zusätzliches, sehr spezialisiertes Behandlungsverfahren ergänzt: die allogene Blutstammzelltransplantation. Dr. med. Herrad Baurmann, Leiterin der Einheit für Stammzelltransplantation im HELIOS Klinikum Berlin-Buch, erläutert das Verfahren: „Während Spender und Empfänger bei der autologen Stammzelltransplantation ein- und dieselbe Person sind, werden dem Patienten bei der allogenen Stammzelltransplantation Blutstammzellen eines gesunden, gewebegleichen Spenders übertragen. Aus diesen Stammzellen entwickelt sich nicht nur eine neue Blutbildung, sondern auch ein völlig neues Immunsystem für den Patienten.“
Die Spenderzellen können wichtige Kontrollfunktionen übernehmen und Krebszellen im Körper des Patienten beseitigen, die durch die Vorbehandlung nicht zerstört werden konnten. Dies ermöglicht eine Heilung auch in Fällen, in denen mit einer Chemotherapie keine ausreichende Wirkung erzielt werden kann. Voraussetzung für ein Anwachsen der Spenderzellen ist allerdings, dass das körpereigene Immunsystem des Patienten völlig ausgeschaltet wurde. „Damit ist die allogene Blutstammzelltransplantation eine sehr eingreifende Therapie, die nur funktionieren kann, wenn wir als Behandlungsteam mit größter Sorgfalt vorgehen und jeden Behandlungsschritt eng mit den Betroffenen abstimmen“, so Baurmann weiter.
Blutbildende Stammzellen werden aus dem Knochenmark oder aus dem Blut gesunder Spender gewonnen. Stammzellspender für einen Patienten können Geschwister oder freiwillige Spender sein, die in nationalen und internationalen Dateien registriert sind und in wesentlichen Gewebemerkmalen mit dem Erkrankten übereinstimmen. Die Stammzellen werden dem Kranken wie eine Bluttransfusion übertragen und finden alleine den Weg ins Knochenmark.
„Anders als die chirurgische Transplantation von Organen ist die Übertragung von blutbildenden Stammzellen selbst keine Kunst“, betont Dr. med. Baurmann. „Die Schwierigkeit besteht allerdings darin, den Patienten vor schwerwiegenden Infektionen zu bewahren, bis das Spenderimmunsystem ausreichend funktionsfähig ist, und die Behandlung so zu steuern, dass die Spenderzellen auf Dauer für und nicht gegen den Erkrankten arbeiten.“
Für die Durchführung der Behandlung steht im HELIOS Klinikum Berlin-Buch eine abgeschirmte Einheit mit hygienischer Ausstattung wie etwa gefilterter Luft und sterilem Wasser zur Verfügung. Die Patienten werden durch ein engagiertes Team aus erfahrenen Ärzten, Pflegekräften, Psychologen, Physiotherapeuten, Hygienefachkräften und Diätassistenten betreut.
Der Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Tumorimmunologie und Palliativmedizin, Professor Dr. med. Wolf-Dieter Ludwig, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir unser ärztliches Team verstärken und mit Frau Dr. med. Herrad Baurmann eine anerkannte Expertin als Leiterin dieser Einheit gewinnen konnten. Sie verfügt über eine langjährige und große Erfahrung auf dem Gebiet der autologen und allogenen Blutstammzelltransplantation.“
Klinikgeschäftsführer Dr. Sebastian Heumüller zur neuen Behandlung: „Wir sind stolz, dass im Bucher Klinikum mit diesem sehr komplexen Spezialverfahren das bereits vorhandene breite therapeutische Spektrum unseres Onkologischen Zentrums für unsere Patienten nochmals erweitert werden konnte.“
Die Behandlung von Krebspatienten ist eine interdisziplinäre Aufgabe. Das HELIOS Klinikum Berlin-Buch vereint eine Vielzahl von renommierten Experten unterschiedlicher Fachdisziplinen unter einem Dach, die für die Behandlung von Tumorpatienten auf modernste Geräte und innovative Therapieverfahren zurückgreifen können. Jährlich werden im Bucher Klinikum über 6000 Patienten mit Krebserkrankungen behandelt.
Zur HELIOS Kliniken Gruppe gehören 111 eigene Akut- und Rehabilitationskliniken inklusive sieben Maximalversorger in Berlin-Buch, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Schwerin, Wuppertal und Wiesbaden, 50 Medizinische Versorgungszentren (MVZ), fünf Rehazentren, zwölf Präventionszentren und 15 Pflegeeinrichtungen. HELIOS ist damit einer der größten Anbieter von stationärer und ambulanter Patientenversorgung in Deutschland und bietet Qualitätsmedizin innerhalb des gesamten Versorgungsspektrums.
Sitz der Unternehmenszentrale ist Berlin.
HELIOS versorgt jährlich rund 4,5 Millionen Patienten, davon 1,2 Millionen stationär. Die Klinikgruppe verfügt insgesamt über mehr als 34.000 Betten und beschäftigt rund 68.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2014 erwirtschaftete HELIOS einen Umsatz von rund 5,2 Milliarden Euro. Die Klinikgruppe gehört zum Gesundheitskonzern Fresenius.
Foto: Das Team der allogenen Stammzelltransplantation der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie um Chefarzt Prof. Dr. med. Wolf-Dieter Ludwig (4.v.l.) und Oberärztin Dr. med. Herrad Baurmann, Leitung Blutstammzelltransplantation (5.v.r.) (Foto: HELIOS Kliniken, Thomas Oberländer)
forschen / 10.08.2015
Skelettmuskelschwund bei Herzschwäche – MDC- und Charité-Forscher klären Mechanismus auf
Herzinsuffizienz zählt zu den häufigsten Todesursachen in den industrialisierten Ländern. Die Ursachen für diese Krankheit sind vielfältig. Dazu gehören Bluthochdruck, Erkrankung der Herzkranzgefäße, Diabetes, starkes Übergewicht (Adipositas) und Alter. „Dank der verbesserten medizinischen Versorgung können wir heute Patienten mit Herzinsuffizienz gut behandeln und deren Prognose verbessern, das heißt, die Überlebenszeit verlängern. Das bedeutet aber auch, dass wir zunehmend Patienten im fortgeschrittenen Stadium dieser Erkrankung haben. Sie leiden an Skelettmuskelschwund und nehmen stark ab, wodurch sich ihr Zustand zunehmend verschlechtert und lebensbedrohlich wird. Leider können wir diese Begleiterkrankung nicht gut behandeln“, erläutert Dr. Fielitz. Der Kardiologe vom Virchow-Klinikum der Charité leitet am ECRC in Berlin-Buch eine unabhängige Projektgruppe zur Proteinregulation im Herz- und Skelettmuskel.
Angiotensin II löst Muskelschwund aus
Bisher war bekannt, dass die Aktivierung des so genannten Renin-Angiotensin-Systems (RAAS) bei Patienten mit Herzinsuffizienz zum Abbau der Skelettmuskeln führt. Das komplizierte System aus Hormonen und Enzymen reguliert normalerweise den Wasser- und Salzhaushalt des Körpers sowie den Blutdruck. Patienten mit Herzinsuffizienz haben erhöhte Werte von einem der Mitspieler dieses Systems im Blut, dem Angiotensin II.
Bekannt war auch, dass es dieses Angiotensin II ist, das den Muskelschwund auslöst. Es stellt die Häckselmaschine des Körpers zum Abbau von Proteinen (Ubiquitin-Proteasom-System, UPS) an, indem es ein Muskelenzym bildet, das es quasi als Schalter einsetzt. Sobald das Muskelenzym, das die Forschung kurz MuRF1 nennt, aktiviert ist, baut die UPS-Maschinerie bei den Patienten das Muskeleiweiß ab, wodurch die Muskeln immer dünner und schwächer werden.
Bekommen die Patienten als Medikament sogenannte ACE-Hemmer, verringert sich bei ihnen der Abbau der Skelettmuskeln. ACE-Hemmer blockieren die Entstehung von Angiotensin II und werden üblicher Weise in der Behandlung von herzinsuffizienten Patienten eingesetzt. „ACE-Hemmer können den Muskelschwund zwar effektiv, aber nicht vollständig hemmen. Und oft kommt es nach fünf bis zehn Jahren zum Therapieversagen“, weist Dr. Fielitz auf die Problematik hin.
Neuen Regulator und Signalweg entdeckt
Hinzu kommt, dass der genaue Signalweg, über den Angiotensin II die Bildung von MuRF1 erhöht, bisher nicht ganz verstanden war. Doch die Kenntnis darüber ist unerlässlich, will man neue Ansätze für eine verbesserte Therapie finden. Dr. Fielitz und seine Mitarbeiter wollten deshalb wissen, wie genau Angiotensin II die Bildung von MuRF1 in Muskelzellen steigert und welcher Signalweg dieses Muskelenzym steuert.
Dazu durchforsteten sie humane Skelettmuskelbibliotheken und sichteten über 250 000 sogenannte cDNAs, mit deren Hilfe sie neue Steuerungsmoleküle (Transkriptionsfaktoren) für das Muskelenzym zu finden hofften. Und sie wurden fündig. Sie entdeckten den Transkriptionsfaktor EB (TFEB). Er bindet an spezielle Steuerelemente im MuRF1-Gen und schaltet dadurch die Produktion dieses Muskelenzym an. Die Forscher konnten zeigen, dass TFEB die Expression von MuRF1 in Muskelzellen um das 70fache erhöht. Damit ist TFEB der stärkste bisher bekannte Aktivator der MuRF1-Expression und ein Schlüsselelement für den Muskelabbau.
Doch gibt es noch weitere Schlüsselelemente in diesem komplexen Regelkreis, der letztlich durch das Angiotensin II angestoßen wird. Denn die Aktivität eines so wichtigen Transkriptionsfaktors wie TFEB muss durch ein äußerst fein abgestimmtes Netzwerk von Proteinen in Schach gehalten werden. Eben dieses Netzwerk das die Aktivität von TFEB reguliert, haben die Forscher entdeckt und im Detail beschrieben.
Eines dieser Regulationsproteine ist das Enzym HDAC5. Es hemmt die Aktivität des Transkriptionsfaktors TFEB. Dadurch wird weniger MuRF1 gebildet und so der Muskelabbau verringert. Das zweite Enzym, die Proteinkinase D1, die durch Angiotensin II aktiviert wird und dann in den Zellkern wandert, wirft das schützende Enzym HDAC5 aus dem Zellkern heraus und schaltet dadurch TFEB im Zellkern an. Das führt zu einer vermehrten Bildung von MuRF1 und löst den muskulären Proteinabbau aus.
Die Proteinkinase D1 ist damit ein weiterer böser Spieler in diesem Prozess, den die Forscher sowohl in Muskelzellkulturen als auch in Mäusen untersucht hatten. „Mit der Kenntnis dieses neuen Signalwegs können wir möglicherweise in Zukunft den Skelettmuskelabbau bei Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz an verschiedenen Punkten zu verhindern suchen“, hofft Dr. Fielitz.
*Angiotensin II Induces Skeletal Muscle Atrophy by Activating TFEB-Mediated MuRF1 Expression
04.08.2015
Rekordquartal trotz Sanierungsaufwand
Im ersten Halbjahr 2015 stieg der Umsatz so um 7,1 Mio. Euro oder 11% auf 69,0 Mio. Euro. Der wesentliche Effekt von 6,0 Mio. Euro beruht auf der günstigeren US-Dollar/Euro-Relation. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat sich das EBIT nahezu verdoppelt und stieg auf 11,7 Mio. Euro. Der Halbjahresgewinn nach Steuern und Minderheiten hat sich mehr als verdoppelt und stieg auf 7,5 Mio. Euro oder 1,41 Euro/Aktie.
Das Segment Isotope Products profitierte am stärksten vom schwächeren Euro und verzeichnete zudem einen Akquisitionseffekt. Die Umsätze stiegen um 17% auf 33,6 Mio. Euro. Aus diesen Effekten entsteht jedoch kein Ergebniszuwachs, so dass das EBIT bei 7,1 Mio. Euro konstant bleibt.
Im Segment Strahlentherapie stiegen die Umsätze währungsbedingt um 0,8 Mio. Euro auf 14,7 Mio. Euro. Diese Umsätze reichten nicht aus, um die Kostenbasis zu decken. Das operative EBIT lag bei -1,4 Mio. Euro. Hinzu kamen positive Währungseffekte von 0,8 Mio. Euro und Rückstellungen von 1,3 Mio. Euro für beschlossene Restrukturierungsmaßnahmen und Standortschließungen. Das Segment-EBIT liegt somit bei -1,9 Mio. Euro.
Das Segment Radiopharma wuchs beim Umsatz über den Währungseffekt hinaus auch organisch, insbesondere in der Gerätesparte und bei den Gallium-Generatoren. Die Position „Sonstige betriebliche Erträge“ enthält den Großteil des Verkaufserlöses der OctreoPharm-Beteiligung. Hierdurch stieg das EBIT um ein Vielfaches auf 7,4 Mio. Euro.
Das Segment Sonstige steigerte den Umsatz aufgrund von Preiserhöhungen leicht um 0,1 Mio. Euro auf 3,5 Mio. Euro. Das EBIT verbesserte sich deutlich um 0,6 Mio. Euro auf -0,8 Mio. Euro. Die Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus dem Saldo eines positiven und eines negativen Effekts: Das Segment erhält ebenfalls einen Ertrag aus dem Verkauf der OctreoPharm-Beteiligung. Zum anderen ist das Segment von einer angekündigten Preiserhöhung bei einem wichtigen Entsorgungsweg betroffen, so dass sich die Rückstellungen für Altabfälle weiter erhöhen.
Der Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit liegt mit 3,9 Mio. Euro deutlich besser als im Vorjahreszeitraum und speist sich im Wesentlichen aus dem Abbau von Forderungen des Segments Strahlentherapie.
Für das Jahr 2015 wird ein Umsatzanstieg auf über 133 Mio. Euro erwartet und eine Ergebnisverbesserung auf über 2,00 EUR/Aktie angestrebt.
Den vollständigen Quartalsbericht finden Sie hier:
http://www.ezag.com/fileadmin/ezag/user-uploads/pdf/financial-reports/deutsch/euz215d.pdf
Über Eckert & Ziegler.
Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN DE0005659700), gehört mit rund 700 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin.
Wir helfen zu heilen.
Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:
Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations
Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de
forschen / 03.08.2015
Neue Rolle von ursprünglichem Herz-Kreislaufmolekül für das Immunsystem entdeckt
Der Rezeptor wurde 2002 von Dr. Genevieve Nguyen von INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) in Paris entdeckt. Ihre Entdeckung beflügelte zunächst die Herz-Kreislauf-Forschung, da der Rezeptor sowohl das Enzym Renin als auch dessen Vorläufer Prorenin bindet. Dieser Fähigkeit verdankt er seinen Namen (Pro)Renin-Rezeptor, kurz PRR. Renin ist in das Renin-Angiotensin-System eingebunden, das den Wasser- und Salzhaushalt und den Blutdruck reguliert. Störungen in diesem System können zu Bluthochdruck führen. Inzwischen stellte sich aber heraus, dass der Rezeptor PRR in keinerlei Zusammenhang mit Bluthochdruck steht. Aber wozu ist er dann nütze?
Rezeptor hat fundamentale Bedeutung für den Organismus
Inzwischen haben weitere Forschungen ergeben, dass der Rezeptor in nahezu allen Geweben und Zellen vorkommt. Um seine Funktion zu ermitteln, schalteten Forscher den Rezeptor in unterschiedlichen Geweben bei der Tauffliege Drosophila, bei Zebrafischen und Säugern wie Mäusen aus. Die Folge waren schwere Schädigungen zum Beispiel an den Nieren und am Herzen. Im frühen Entwicklungsstadium führte das Ausschalten des Rezeptors zum Absterben der Embryos. „Das bedeutet, der Rezeptor PRR hat eine fundamentale biologische Funktion im Organismus“, erläutert Forschungsgruppenleiter Prof. Müller vom ECRC.
Besonders stark ist der Rezeptor in den T-Zellen des Immunsystems ausgeprägt. Diese Zellen haben die Aufgabe Krankheitserreger zu erkennen und andere Zellen des Immunsystems für die Abwehr der Eindringlinge auf den Plan zu rufen. Die Forscherinnen und Forscher des ECRC untersuchten, was geschieht, wenn der Rezeptor in T-Zellen von Mäusen ausgeschaltet wird, die sich zur Schulung im Thymusgewebe befinden. Das Ergebnis: die Entwicklung der T-Zellen war massiv gestört. „In der Herz-Kreislauf-Forschung kam die Überlegung auf, einen Inhibitor zu entwickeln, um das Renin-Angiotensin-System auf eine alternative Weise zu inhibieren. Aber alle Untersuchungen, auch unsere, zeigen, dass dieser Rezeptor so wichtig für die Entwicklung des Organismus ist, dass es einfach zu gefährlich wäre, ihn zu blockieren“, betont Prof. Müller.
*New role for the (pro)renin receptor in T-cell development
forschen / 31.07.2015
RNA-bindendes Protein beeinflusst zentralen Mediator zellulärer Entzündungs- und Stressreaktionen
RC3H1/ROQUIN ist bereits in früheren Studien als RNA-bindendes Protein beschrieben worden, das die Stabilität verschiedener mRNAs beeinflusst. Allerdings war unklar, wie ROQUIN mRNAs erkennt und wie viele mRNAs duch ROQUIN reguliert werden. Dr. Yasuhiro Murakawa und Dr. Markus Landthaler vom Berliner Institut für Medizinische Systembiologie (BIMSB) des MDC konnten in Zusammenarbeit mit den MDC-Arbeitsgruppen von Prof. Udo Heinemann, Dr. Stefan Kempa, Prof. Claus Scheidereit, Dr. Jana Wolf und anderen zeigen, dass ROQUIN an mehr als 3.800 verschiedene mRNAs bindet. Sie identifizierten insgesamt über 16.000 Bindestellen, an die das Protein andockt. Damit hat ROQUIN offenbar einen größeren Einfluss auf die Regulation der Genexpression als bisher vermutet. Darüber hinaus konnten die Forscher die Bindungsabschnitte von ROQUIN aufklären, die einen Einblick darüber geben, wo Protein-RNA Interaktionen stattfinden.
ROQUIN reguliert die Reaktion auf DNA-Schäden
ROQUIN bindet bevorzugt mRNAs, die als Reaktion auf DNA-Schädigungen aber auch im Rahmen von Entzündungsreaktionen hergestellt werden. Viele der betroffenen mRNAs liefern Baupläne für Proteine, die ihrerseits die Aktivität von Genen beeinflussen und so wiederum die Produktion anderer Proteine regulieren. ROQUIN trägt hier nach Ansicht der Forscher zur Feinabstimmung der Regulationsmechanismen bei.
Unter den Zielen, die ROQUIN angreift, ist auch die mRNA des Proteins A20 (auch TNFAIP3 genannt). A20 dient zur Feedback-Kontrolle eines Komplexes, IkappaBalpha-Kinase-Komplex (IKK) genannt, der die Aktivierung des Genschalters NF-kappaB reguliert. Das IKK/NF-kappaB Modul reguliert die Expression einer Vielzahl von Genen und ist einer der zentralen Mediatoren bei Entzündungsreaktionen und bei zellulären Stressreaktionen, die beispielsweise durch DNA Schäden ausgelöst werden.
Damit das IKK/NF-kappaB Modul nicht dauerhaft aktiv bleibt, sorgt es selbst dafür, dass verstärkt Proteine wie A20 produziert werden, die die Aktivität des IKK/NF-kappaB Moduls verringern. Indem ROQUIN den Abbau der mRNA für A20 reguliert, moduliert es indirekt die Aktivität des IKK/NF-kappaB Moduls.
Besseres Verständnis von Autoimmunerkrankungen
Die Forscher gehen davon aus, dass die Bedeutung von ROQUIN sogar noch weiter reicht. Auch bei anderen Signalwegen ist anzunehmen, dass ROQUIN die Lebensdauer Protein-kodierender mRNAs verringert und so eine Feinabstimmung ermöglicht. Wichtig sind die Erkenntnisse zum Beispiel, um Autoimmunerkrankungen besser zu verstehen und womöglich zu verhindern. So gilt das Protein A20 etwa als Schutzfaktor gegen Arthritis. Seinen Gegenspieler ROQUIN zu unterdrücken, könnte ein Ansatz zur Behandlung dieser chronischen Gelenkentzündung sein.
*RC3H1 post-transcriptionally regulates A20 mRNA and modulates the activity of the IKK/NF-kB pathway
forschen / 30.07.2015
Dem Altern auf den Fersen
Jede Zelle besteht aus verschiedenen Kompartimenten. Eines davon ist das Endoplasmatische Retikulum (ER). Hier reifen unter anderem Proteine, die in die Blutbahn abgegeben werden, etwa Insulin oder Antikörper des Immunsystems, in einem oxidativen Milieu. Eine Art Qualitätskontrolle, die sogenannte Proteinhomöostase, sorgt dafür, dass das oxidative Milieu aufrechterhalten wird und Disulfidbrücken ausgebildet werden können. Disulfidbrücken formen und stabilisieren die dreidimensionale Proteinstruktur und sind somit essentiell für eine einwandfreie Funktion der sekretorischen, also zum Beispiel ins Blut wandernden Proteine.
Gleichgewicht gerät aus den Fugen
Wissenschaftler am Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie in Berlin konnten nun erstmals zeigen, dass das Endoplasmatische Retikulum im Alter seine oxidative Kraft verliert, wodurch sich das reduzierende/oxidierende Gleichgewicht – kurz Redox – in diesem Kompartiment verschiebt. Damit sinkt die Fähigkeit, die für die korrekte Proteinfaltung so wichtigen Disulfidbrücken auszubilden. In der Folge können viele Proteine nicht mehr korrekt reifen und werden instabil.
Es war zwar bekannt, dass es im Alter zu einer vermehrten Proteinmissfaltung kommt, aber nicht, ob dadurch auch das Redox-Gleichgewicht beeinflusst wird. Ebenso wenig war bekannt, dass der Verlust an oxidativer Kraft im ER auch das Gleichgewicht in einem weiteren Kompartiment der Zelle zum Kippen bringt: Umgekehrt nimmt nämlich das ansonsten Protein reduzierende Cytosol im Alter oxidierende Eigenschaften an, was zu den bekannten oxidativen Proteinschädigungen wie die Freisetzung freier Radikale führt.
„Bislang war völlig unklar, was im Endoplasmatischen Retikulum während des Alterungsprozesses passiert. Diese Frage haben wir nun beantworten können“, sagt Dr. Janine Kirstein, Erstautorin der Studie, die im Fachmagazin EMBO Journal* erschienen ist. Gleichzeitig konnten die Wissenschaftler zeigen, dass es eine starke Korrelation zwischen Proteinhomöostase und Redox-Gleichgewicht gibt. „Das ist absolut neu und hilft uns besser zu verstehen, warum sekretierte Proteine wie unsere Antikörper im Alter und nach Stress instabiler werden und an Funktion verlieren. Dies könnte erklären, warum die Immunabwehr im Alter abnimmt“, so die Biologin weiter.
Stress hat gleiche Auswirkungen wie das Alter
Den Verfall der oxidativen Milieus konnten die Forscher auch nach Stress nachweisen. Synthetisierten sie in der Zelle amyloide Proteinfibrillen, die Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson oder Chorea Huntington hervorrufen, setzten sie die gleiche Kaskade in Gang. Außerdem konnten sie zeigen, dass Amyloide, die in einem bestimmten Gewebe synthetisiert werden, auch negative Auswirkungen auf das Redox-Gleichgewicht in einem anderen Gewebe im selben Organismus hat. „Proteinstress führt zu den gleichen Auswirkungen wie das Alter“, erläutert Kirstein. „Insofern sind unsere Erkenntnisse nicht nur für das Altern, sondern auch für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer interessant.“
Für ihre Experimente nutzte das Forscherteam den Fadenwurm - ein etabliertes Modellsystem, um Alterungsprozesse auf molekularer Ebene zu untersuchen. Da der Fadenwurm transparent ist, konnten die Forscher fluoreszenz-basierte Sensoren verwenden, um die Oxidation in den einzelnen Zellkompartimenten zu messen. Am lebenden Fadenwurm konnte so genau verfolgt werden, wie sich der Redox-Zustand im Alter verändert. Zusätzlich wurde der Einfluss der Proteinaggregation an kultivierten Zellen menschlichen Ursprungs untersucht. Die Daten waren deckungsgleich mit denen im Fadenwurm.
Erkenntnisse für neue diagnostische Biomarker nutzen
„Wir wissen jetzt eine ganze Menge mehr, haben aber auch gelernt, dass Altern wesentlich komplexer ist, als bislang angenommen“, betont Biologin Kirstein. So ist beispielsweise die Übertragung des Proteinfaltungsstress auf das Redox-Gleichgewicht – sowohl innerhalb der Zelle von einem Kompartiment zum anderen als auch zwischen zwei verschiedenen Geweben – noch völlig unklar.
Dennoch ist die Altersforschung durch den Fund aus Berlin ein ganzes Stück weitergekommen, zumal er auch einen praktischen Nutzen verspricht. Das Redox-Gleichgewicht könnte künftig als Basis für neue Biomarker dienen, um sowohl Alterungs- als auch neurodegenerative Prozesse zu diagnostizieren. Janine Kirstein: „Der Ansatz wird momentan sicher weniger zu therapeutischen Zwecken genutzt werden können, aber die Entwicklung diagnostischer Werkzeuge ist durchaus vorstellbar.“
Das Projekt ist eine Kooperation zwischen Laboren aus Berlin, Chicago, Kyoto und München.
\n
Abb.: Abgebildet ist eine einzelne Muskelzelle des Fadenwurms, die den Fluoreszenzsensor Redox-GFP im Endoplasmatischen Retikulum synthetisiert. Der Sensor wird mit zwei verschiedenen Wellenlängen angeregt. Grüne Bereiche signalisieren reduzierende Bedingungen und blaue Bereiche oxidierte Zustände. Maßstabsleiste entspricht 10 µm. (Quelle: FMP)
\nText: Beatrice Hamberger
forschen / 27.07.2015
Georg Forster-Forschungspreis der Alexander von Humboldt-Stiftung für brasilianischen Herz-Kreislaufforscher – Zusammenarbeit mit dem MDC
Prof. Santos Forschungsschwerpunkt sind die so genannten Angiotensin Peptide. Sie sind Teil eines komplizierten Systems aus Hormonen und Enzymen, das den Wasser- und Salzhaushalt des Körpers sowie den Blutdruck reguliert und als Renin-Angiotensin-System (RAS) bezeichnet wird. Die Angiotensine dieses Systems sind Hormone, die großen Einfluß auf die Regulation des Herz-Kreislauf-Systems haben und bei der Entstehung von Bluthochdruck, Herz-Kreislauf- sowie Nierenerkrankungen eine Rolle spielen. Medikamente, die die Aktivität dieser Angiotensine hemmen, gehören zu den erfolgreichsten Therapieoptionen für diese Erkrankungen.
1988, während eines Forschungsaufenthalts in der Cleveland Clinic in Cleveland, Ohio, USA, entdeckte Prof. Santos ein neuartiges Angiotensin-Peptid, kurz Ang-(1-7) genannt. Er konnte zeigen, dass dieses Angiotensin eine schützende Funktion hat und Gegenspieler von Angiotensin II ist, das den Blutdruck in die Höhe treibt.
Alamandine – ein neues Hormon im Renin-Angiotensin-System
In Zusammenarbeit mit Prof. Bader am MDC entdeckte er, dass Ang-(1-7) unter anderem sowohl bei Entzündungen, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen als auch bei der Stoffwechselkontrolle schützend wirkt. Die Zusammenarbeit von Prof. Santos und Prof. Bader führte daher auch bereits zur Entwicklung von neuartigen Wirkstoffen gegen Herzkreislaufkrankheiten und zu einigen gemeinsamen Patenten. Am MDC wird Prof. Santos sich jetzt auf die Analyse der Funktionen eines weiteren Hormons aus dem Renin-Angiotensin-System konzentrieren, dem Alamandine, das er kürzlich zusammen mit Prof. Bader entdeckt hat.
Prof. Santos wurde im Dezember 1951 in Rio de Janeiro geboren und hat in Sao Paulo und Belo Horizonte Biologie und Medizin studiert. Er war zu Forschungsaufenthalten in den USA und ist seit 1998 regelmäßig am MDC in Berlin. Seit 1984 ist er an der renommierten Bundesuniversität von Belo Horizonte im Bundesstaat Minas Gerais, einer der größten Universitäten Brasiliens, tätig, und erhielt dort 2002 einen Lehrstuhl.
Prof. Santos hat sich auf seinem Forschungsgebiet einen internationalen Ruf erworben und zahlreiche Ehrungen erhalten. So war er von 2010 - 2013 Präsident der Interamerikanischen Gesellschaft für Bluthochdruckforschung – sie umfasst sowohl Nord- als auch Südamerika, und jeweils für zwei Jahre Präsident der Brasilianischen Gesellschaften für Physiologie und Hypertonie. Dazu ist er Mitglied in der Brasilianischen Akademie der Wissenschaften und im Council on Hypertension der American Heart Association (AHA).
Georg Forster – Universalgelehrter und Revolutionär
Der Prof. Santos zuerkannte Forschungspreis ist benannt nach Georg Forster (1754 – 1794), einem der bedeutendsten deutschen Universalgelehrten, Weltumsegler, Schriftsteller und Revolutionär. Mit dem Forschungspreis werden, so die Alexander von Humboldt-Stiftung, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ihr „bisheriges Gesamtschaffen“ ausgezeichnet, deren „grundlegende“ Forschungen „das eigene Fachgebiet … nachhaltig geprägt haben“.
Derzeit arbeitet im Labor von Prof. Bader darüberhinaus die mexikanische Biologin und Immunologin Dr. Lorena Gómez-García vom Mexikanischen Institut für Kardiologie (Instituto Nacional de Cardiologia) in Mexiko-Stadt. Sie erhielt ein Forschungsstipendium der AvH, das ebenfalls nach Georg Forster benannt ist.
forschen, produzieren, leben, erkunden / 26.07.2015
Skulpturen von Ulrike Mohr vor Max-Rubner-Haus des MDC in Berlin-Buch installiert
Mit ihrer Arbeit thematisiert Ulrike Mohr das Prinzip der Chiralität, der Händigkeit: Beide Skulpturen bilden ein Modell des Moleküls „Carvon“ ab, das in der Natur in den Formen (D)-Carvon (Bild) und seinem Spiegelbild (R)-Carvon vorkommt und nach Pfefferminze beziehungsweise Kümmel riecht. Die Moleküle bestehen aus weißlackierten Metallkugeln, welche die chirale Strukturformel von Carvon darstellen.
\nIn Sichtachse zu den beiden Molekülen durchziehen schmale lange Beete mit Pfefferminz- und Kümmelpflanzen die polygonalen Grünflächen vor der gegenüberliegenden Gebäude der Berliner Ultrahochfeld-Anlage des Experimental and Clinical Research Center (ECRC) von MDC und Charite. Die Auswahl der Kümmel- und Pfefferminzsorten basiert auf einer Pflanzensammlung Karls des Großen. Kümmel und Minze sind alte Heil- und Gewürzpflanzen, die eine Verbindung zur Geschichte des Campus als Forschungs- und ehemaligen Krankenhausstandort schaffen.
\nUlrike Mohr wurde 1970 in Tuttlingen geboren und studierte an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und an der Trondheim Academy of Fine Art, Norwegen, Kunst und Bildhauerei. Ihre Arbeiten werden in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland gezeigt. Sie nahm unter anderem an der 5. Berlin Biennale für Zeitgenössische Kunst und der 6th Nordic Biennial for Contemporary Art in Norwegen teil und erhielt bereits mehrere Stipendien, unter anderem das Istanbul-Stipendium des Berliner Senats sowie das Arbeits- und Katalogstipendium der Stiftung Kunstfonds Bonn. Derzeit sind Arbeiten von ihr bei ARTER, space for art in Istanbul und im Z33, house for contemporary art, in Belgien zu sehen.
\n\n
Foto: Skulpturen der Künstlerin Ulrike Mohr. (Photo: David Ausserhofer/ Copyright: MDC)
forschen, heilen / 23.07.2015
Wetterwechsel kann krank machen: Schlaganfallrisiko steigt nach Temperaturstürzen
Wir reagieren auf das Wetter, darin besteht schon längst kein Zweifel mehr. Ob Sonne oder Regen, Hitze oder Kälte – der menschliche Körper muss sich ständig an Temperaturschwankungen und Luftdruckänderungen anpassen. Auch Schlaganfall-Ursachen können ihren Ursprung im Wetterverlauf haben. Diesen Zusammenhang konnte nun eine Arbeitsgruppe um Dr. med. Florian Rakers, Assistenzarzt der Klinik für Neurologie im HELIOS Klinikum Berlin-Buch und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Universitätsklinikums Jena, nachweisen.\n
„Wenn die Lufttemperatur rasch fällt oder sich die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck binnen eines Tages stark ändern, steigt das Risiko eines Schlaganfalls deutlich an“, weiß Dr. med. Florian Rakers. Die Ergebnisse wurden jetzt in einer aktuellen Studie der Universität Jena veröffentlicht.*
Entscheidend seien vor allem schnelle Wetterwechsel, betont Rakers. Noch bis zu 48 Stunden nach einem Temperatursturz bleibt das Risiko erhöht, einen Schlaganfall zu erleiden.
Bei einem Temperaturabfall um drei Grad steigt das Schlaganfallrisiko, laut Studie, bereits um elf Prozent, bei sechs Grad bereits um gut 20 Prozent. Dabei spielt die Höhe der Temperatur selbst keine Rolle, wohl aber der Temperaturunterschied. Ein ähnliches Risiko lässt sich auch bei sinkendem Luftdruck oder der Luftfeuchtigkeitsänderung feststellen. Eine Änderung des Luftdrucks um mehr als 10 Hektopascal oder eine Änderung der Luftfeuchtigkeit um mehr als fünf Prozent innerhalb von 24 Stunden steigert das Schlaganfallrisiko, wie Dr. med Rakers und das Team seiner Arbeitsgruppe feststellten, sogar um bis zu 63 Prozent.
Durch akute Wetteränderungen werden vor allem sogenannte kardioembolische Schlaganfälle begünstigt. Hierbei handelt es sich um Schlaganfälle, die durch Blutgerinnsel ausgelöst werden, die sich im Herzen aufgrund von bestimmten Herzrhythmusstörungen („Vorhofflimmern“) bilden und dann als Embolie in das Gehirn gelangen. Hier verschließen sie meist größere hirnversorgende Blutgefäße. Daraus resultieren in der Regel schwerwiegende Schlaganfälle. „Akute Temperaturstürze können ein Vorhofflimmern auslösen und somit zur Entstehung des Schlaganfalls beitragen“, führt Dr. med. Rakers aus.
Grundsätzlich spielen auch weitere physiologische Gesetze eine Rolle: Bei akut fallenden Temperaturen versucht sich der Körper vor dem Auskühlen zu schützen, indem sich die Gefäße zusammenziehen. An ohnehin verengten Gefäßabschnitten kann dies zum kompletten Verschluss des Gefäßes und damit zum Schlaganfall führen. Für diesen Zusammenhang spricht auch die Tatsache, dass das Schlaganfallrisiko bei rapiden Temperaturanstiegen deutlich sinkt.
Besonders empfindlich auf Wetteränderungen reagieren Menschen, die ohnehin ein erhöhtes Schlaganfallrisiko aufweisen, wie zum Beispiel Diabetiker, Patienten mit Gefäßerkrankungen, Bluthochdruck sowie ältere Menschen.
Der Experte rät deshalb, in diesen Tagen vermehrt auf Warnsignale eines Schlaganfalls zu achten.
Typische Symptome, die einem Schlaganfall vorausgehen können, sind halbseitige Lähmungen an Armen, Beinen oder im Gesicht, Sehstörungen sowie Schwindel oder Gangunsicherheit. „Jeder Schlaganfall ist ein Notfall. Betroffene müssen schnellstmöglich versorgt werden, am Besten in einem Krankenhaus mit einer Schlaganfallspezialstation, der sogenannten Stroke Unit. Im Zweifel immer einen Notarzt rufen“, empfiehlt Dr. med. Florian Rakers.
Foto: Dr. med. Florian Rakers (Foto: HELIOS Kliniken, Thomas Oberländer)
forschen / 20.07.2015
Dorothea Fiedler wird Direktorin am FMP
Für FMP-Direktor Volker Haucke geht mit der Berufung seiner neuen Kollegin ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung - neben der Entlastung durch die gemeinsame Leitung des FMP erhofft er sich Impulse durch ein ganz neues Forschungsfeld: „Bei Dorothea Fiedlers Arbeit geht es um kleine zuckerähnliche Moleküle, die im intrazellulären Energiestoffwechsel eine sehr große Rolle zu spielen scheinen und über die man bislang kaum etwas weiß.“
Aufgewachsen ist Dorothea Fiedler in Hamburg. Sie studierte anorganische Chemie an der Universität Würzburg und anschließend an der University of California in Berkeley, wo sie auch promovierte. Sie arbeitete bei Prof. Ken Raymond, einem Experten für anorganische Moleküle in organischen Systemen. Im Labor von Prof. Robert Bergmann stand Organometallchemie im Mittelpunkt. Schließlich überquerte Dorothea Fiedler die Bucht von San Francisco, um als Postdoc im Labor des Chemischen Biologen Prof. Kevan M. Shokat an der UCSF weiterzuarbeiten. Hier erforschte sie Wege der Signaltransduktion in der Zelle und im Körper. Die Signalübertragung in biologischen Netzwerken ist hochkomplex. „Bis heute ist es unglaublich faszinierend für mich, dass Signalübertragung und Stoffwechsel in einer Körperzelle mit solch hoher Präzision ablaufen“, sagt sie. Sobald es hier zu Fehlern und Defekten kommt, entstehen zum Teil schwere Krankheiten. Ein wichtiges Ziel ihres Forschungsprogrammes ist es, die Mechanismen jener Signale aufzuklären, die zur Entstehung von Tumoren und zur Ansiedlung von Metastasen führen.
Seit August 2010 arbeitet Dorothea Fiedler an der Princeton University, dort erforscht sie die Regulierungsfunktion von anorganischen Phosphorverbindungen, die beim Krebswachstum eine wichtige Rolle spielen. Einen Schwerpunkt bildet eine weitere Gruppe von Botenstoffen in der Zelle, die sogenannten Inositol-Pyrophosphate. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Fettstoffwechselkrankheiten, starkem Übergewicht und Diabetes Typ 2. Bereits in Princeton hat Dorothea Fiedler mit ihrem Team neue Methoden entwickelt, um die Kaskaden der chemischen Reaktionen von Inositol-Pyrophosphaten in einzelne Schritte zu zerlegen.
Dass Dorothea Fiedlers wissenschaftliche Arbeit große Aufmerksamkeit erregt, zeigt sich nicht zuletzt in den Auszeichnungen. So erhielt sie 2013 einen der 15 Förder-Grants der renommierten Sidney Kimmel Foundation für Krebsforschung in Höhe von 200.000 US-Dollar. Dorothea Fiedlers Arbeiten demonstrieren, so die Jury, hervorragende Innovationskraft und seien sehr vielversprechend. Handverlesen sind auch die nur sieben Stipendiaten der Rita Allen Foundation, in deren Reihen sich Nobelpreisträger und zahlreiche andere inzwischen hochdekorierte Wissenschaftler finden. Von der Rita Allen Foundation erhielt Dorothea Fiedler einen Grant in Höhe von 500.000 Dollar. Ihr größter Grant in den USA war der NIH Director’s New Innovator Award mit 1.5 Millionen Dollar. Er entfällt nun wegen des Umzugs zurück nach Deutschland.
Am FMP will sie die erfolgreiche Arbeit fortsetzen. „Die vergangenen Jahre haben wir genutzt um die nötigen Techniken und Werkzeuge zu entwickeln. Jetzt geht es erst richtig los, und das FMP hat wirklich alles – tolle Kollegen und beste Infrastruktur –, was wir zum Durchstarten benötigen“, sagt die frisch ernannte FMP-Direktorin.
Das Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) gehört zum Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB), einem Zusammenschluss von acht natur-, lebens- und umweltwissenschaftlichen Instituten in Berlin. In ihnen arbeiten mehr als 1.500 Mitarbeiter. Die vielfach ausgezeichneten Einrichtungen sind Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft. Entstanden ist der Forschungsverbund 1992 in einer einzigartigen historischen Situation aus der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR.
Kontakt:
Prof. Dr. Dorothea Fiedler
Direktorin am FMP
Leiterin Bereich und Abteilung Chemische Biologie I
Leibniz Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP)
Robert-Roessle-Strasse 10,
13125 Berlin,
E-mail: fiedler@fmp-berlin.de
Silke Oßwald
Öffentlichkeitsarbeit
Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP)
Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin
phone: +49 30 94793104
E-mail: Osswald@fmp-berlin.de\n
\n
Foto: Prof. Dr. Dorothea Fiedler (Foto: privat)
produzieren / 17.07.2015
WISE s.r.l. wirbt 3 Mio. € zur klinischen Entwicklung neuartiger Neuromodulationsimplantate für die Rückenmarkstimulation ein
Das Medizintechnikunternehmen WISE s.r.l., das die nächste Generation implantierbarer Elektroden für die Neuromodulation entwickelt, hat Anfang Juni 3 Mio. € im Rahmen einer Serie A Finanzierungsrunde eingeworben. Principia SGR, eine italienische Venture Capital Firma führte diese an. Die bestehenden Investoren High-Tech Gründerfonds, Atlante Seed und b-to-v Partners haben sich ebenfalls an der Runde beteiligt, gemeinsam mit drei neuen Investoren Atlante Ventures, F3F und Antares.
WISE entwickelt basierend auf der eigenen, patentierten Technologieplattform mit dem Namen Supersonic Cluster Beam Implantation (SCBI) neuartige, hochflexible und dehnbare implantierbare Neuromodulationselektroden für unterschiedliche neurologische Anwendungen. WISE plant sein Hauptprodukt, ein faltbares Implantat für die Rückenmarksstimulation (Spinal Cord Stimulation), bis 2018 auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen wird mit den eingeworbenen Mitteln die klinische Entwicklung der Implantate und den Aufbau eines ISO-zertifizierten SCBI Produktionssystems an einem neuen Startort in Mailand finanzieren.
Antonio Falcone, der CEO von Principia SGR und Lead-Investor der Finanzierungsrunde, kommentierte: „Wir freuen uns besonders dieses Investment in die hoch-innovative Technologie von WISE bekannt zu geben, da wir denken, dass sie das Potential für grundlegende Innovationen im Feld der Neuromodulation ausweist. WISE ist das erste Investment, das wir aus unserem neuen Fonds Principia III – Health heraus tätigen und wir freuen uns, WISE zukünftig mit unserer Expertise und unserem Netzwerk beim Eintritt in den wachsenden Markt der Rückenmarkstimulation zu unterstützen.“
„Basierend auf den Fortschritten bei der Produktentwicklung im letzten Jahr und dank der finanziellen Unterstützung unserer neuen und bestehenden Investoren sind wir nun in einer hervorragenden Position, unsere neuen Neuromodulationsprodukte in Richtung Marktreife zu entwickeln. Hierfür werden wir mit dem Bau einer ersten Produktionsanlage beginnen und die CE-Zertifizierung für unser erstes Produkt für die Elektrokortikographie voraussichtlich 2016 abschließen“, sagte CEO und Mitgründer von WISE, Dr. Luca Ravagnan und fügte hinzu: „Wir glauben, dass wir im Bereich der Rückenmarkstimulation zum ersten Mal in der Lage sein werden, dem Patienten ein Produkt anzubieten, das die Leistungsfähigkeit von Plattenelektroden mit der minimal-invasiven Implantationsroutine von perkutanen Elektroden kombiniert“.
Dr. Christian Jung, Senior Investment Manager beim High-Tech Gründerfonds, kommentierte: „Die Technologieplattform von WISE ist einzigartig und wird die derzeitigen Grenzen der Neuromodulation entscheidend verschieben. Patienten, bei denen heute schon Neuromodulation angewandt wird, profitieren von den geringeren Nebenwirkungen der Technologie. Neuromodulation wird zukünftig auch bei Patienten mit bestimmten Indikationen und komplexen Anforderungen angewendet werden können, für die die derzeitig erhältliche Technologien noch nicht genügen.“
Die Elektroden und Kabel die derzeit in der Neuromodulation zum Einsatz kommen, haben zwei wichtige Nachteile: Sie können durch Bruch Ihre Leitfähigkeit verlieren und sich auch verschieben. Beide Probleme beruhen auf der Formsteifigkeit des derzeitig verwendeten Materials. Die patentierte Technologie von WISE hat gegenüber den Wettbewerbern den Vorteil, elektrische Leitungsbahnen in biokompatible Silikone einzufügen, was hoch-elastische Elektroden von sehr hoher Zuverlässigkeit ergibt. Dehnungen und Verdrehungen bleiben ohne Risiko für einen elektrischen Bruch oder einer Verlagerung der Elektrode. Die Elektroden von WISE sind zudem einfacher herzustellen als derzeitige Standardelektroden und können für Patienten maßgefertigt werden. Das Entzündungsrisiko für das umliegende Gewebe ist durch die geringen Abmessungen der Implantate und die Weichheit des Materials ebenfalls deutlich herabgesetzt.
„Die verringerte Invasivität der Technologie ist ein Hauptmerkmal, das die Nachfrage nach den vielseitigen Produkten von WISE auf dem sehr schnell wachsenden Markt für Neuromodulation treiben wird. Wir werden das Unternehmen nun in der klinischen Phase der Entwicklung tatkräftig unterstützen und sind zuversichtlich, dass das CE-Zulassungsverfahren rasch erfolgreich abgeschlossen werden kann,“ fügte Dr. Alvise Bonivento Senior Investment Manager bei Atlante hinzu.
Nähere Informationen sind erhältlich unter info@wiseneuro.com oder auf der Website des Unternehmens www.wiseneuro.com.
Über WISE
WISE entwickelt basierend auf der patentierten Supersonic Cluster Beam Implantation (SCBI) Technologieplattform des Unternehmens neuartige, hochflexible und dehnbare implantierbare Elektroden für die Neuromodulation in unterschiedlichen neurologischen Indikationen.
Nach der chirurgischen Implantation von Elektroden werden bei der Neuromodulationstherapie elektrische Impulse an das neuronale Gewebe abgegeben. Die Elektroden, die WISE mittels der neuartigen SCBI Technologie herstellt, bestehen aus elektrischen Leiterbahnen in einer sehr dünnen Elastomerfolie. Dadurch können Verlagerungen, das Brechen oder Beschädigungen, wie sie bei derzeitigen Produkten zu beobachten sind, zukünftig vermieden werden.
WISE entwickelt faltbare Plattenelektroden, die durch minimalinvasive Verfahren implantiert werden können. Dieser werden bei chronischen Schmerzpatienten zur Behandlung mittels Rückenmarkstimulation eingesetzt, ein Markt mit hohen Wachstumstraten und großem medizinischem Bedarf. Das Unternehmen bereitet derzeit die CE-Zertifizierung und darauf aufbauende klinische Studien für sein erstes Produkt, ein Elektrokortikografie-Elektrodennetz zur Messung und Stimulation der Hirnrinde, vor.
Das Unternehmen, 2011 durch ein Team von Festkörperphysikern aus der Universität Mailand und des Angel-Investors Agite! S.p.A gegründet, hat bislang Finanzierungen von Agite!, Atlante Seed und Atlante Ventures, HTGF, b-to-v Partners, Principia SGR und Privatinvestoren erhalten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Mailand, Italien mit einer Niederlassung in Berlin, Deutschland.\n
www.wiseneuro.com
Über Atlante
Atlante Ventures und Atlante Seed sind Fonds der Intesa Sanpaolo Gruppe, eine der führenden Bankengruppen in der Eurozone, die speziell auf das Seed- und Frühphasenstadium ausgerichtet sind. Die Atlante Fonds investieren in innovative Unternehmen, die noch am Anfang stehen aber hohes Wachstumspotential besitzen und mit einen speziellen High-Tech Fokus haben. Die Atlante Fonds zählen zu den aktivsten italienischen VC Fonds sowohl in Bezug auf abgeschlossene Investments (rund 30 bislang) als auch in Bezug auf Exits und IPOs.
Über b-to-v Partners
Die b-to-v Partners AG mit Sitz in St. Gallen ist mit 200 Mitgliedern eines der führenden Netzwerke unternehmerischer Privatinvestoren in Europa. Zudem ist die Gesellschaft auch als eigenständiger Investor tätig, der die ihm anvertrauten Mittel in Start-ups, Mittelstandsbeteiligungen und Special Opportunities investiert. b-to-v verbindet die Branchenexpertise und Erfahrung unternehmerischer Privatinvestoren und der Investment Professionals im eigenen Team mit Beteiligungsmöglichkeiten an Firmen, die von überzeugenden Unternehmern geführt werden. Mit diesem Investmentansatz hat sich b-to-v zum Ziel gesetzt, nachhaltigen Mehrwert sowohl für die weltweit finanzierten Unternehmen als auch für die investierenden Unternehmer zu schaffen und attraktive Renditen zu erreichen. Das gemeinsame Investieren und die Freude an der gegenseitigen finanziellen, inhaltlichen und persönlichen Unterstützung von Unternehmer zu Unternehmer ist Kern der b-to-v Philosophie.
www.b-to-v.com
Über F3F
F3F ist ein italienisches Unternehmen geführt von der Biotech- und Healthcare Unternehmerin Iris Ferro. F3F hat seinen Sitz in Mailand und investiert sowohl in klassische Assets wie Immobilien als auch in innovative Unternehmen, wie z.B. im Bereich Life Sciences.
About Antares
Antares ist eine 1995 gegründete Investmentfirma, die Mario Zanone Poma und seiner Familie kontrolliert wird. Ein Teil des Investments erfolgt in innovative Start-Up Firmen.
Über den High-Tech Gründerfonds
Der High-Tech Gründerfonds investiert Risikokapital in junge, chancenreiche Technologie-Unternehmen, die vielversprechende Forschungsergebnisse unternehmerisch umsetzen. Mit Hilfe der Seedfinanzierung sollen die Start-Ups das F&E-Vorhaben bis zur Bereitstellung eines Prototypen bzw. eines „Proof of Concept“ oder zur Markteinführung führen. Der Fonds beteiligt sich initial mit 500.000 Euro; insgesamt stehen bis zu zwei Millionen Euro pro Unternehmen zur Verfügung. Investoren der Public-Private-Partnership sind das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, die KfW Bankengruppe sowie die 18 Wirtschaftsunternehmen ALTANA, BASF, Bayer, B. Braun, Robert Bosch, CEWE, Daimler, Deutsche Post DHL, Deutsche Telekom, Evonik, Lanxess, media + more venture Beteiligungs GmbH & Co. KG, METRO, Qiagen, RWE Innogy, SAP, Tengelmann und Carl Zeiss. Der High-Tech Gründerfonds verfügt insgesamt über ein Fondsvolumen von rund 576 Mio. EUR (272 Mio. EUR Fonds I und 304Mio. EUR Fonds II).
high-tech-gruenderfonds.de
Contact:
WISE
Dr. Luca Ravagnan
Tel: +39 02 5666 0193
info@wiseneuro.com
forschen / 16.07.2015
Berliner Institut für Gesundheitsforschung fördert neue Anwendungen in der Medizintechnik
Mit dem ersten Projekt wird der Bau eines Prototypen zur Blutdruckmessung bei Patientinnen und Patienten unterstützt, bei denen die gebräuchlichen Messsysteme nicht angewendet werden können – zum Beispiel Thalidomidgeschädigte. Thalidomid ist vor allem unter dem Namen „Contergan“ bekannt. Dr. Ulrich Kertzscher vom Labor für Biofluidmechanik (Charité) hat ein nicht-invasives Messverfahren für diese Patientinnen und Patienten entwickelt. Das neu entworfene Blutdruckmessgerät soll an Thalidomidgeschädigten validiert werden, langfristig soll es auch für Patientinnen und Patienten mit anderen Indikationen nutzbar sein.
Die Entwicklung eines „intelligenten“ intravenösen Katheters wird mit dem zweiten Projekt aus der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie am Campus Benjamin Franklin gefördert. Um die Versorgung zu verbessern, entwickelten Dr. Michael Notter und sein Team einen technologisch vernetzten Katheter, der es ermöglicht, Prätransfusionsproben in der Routineversorgung und am Unfallort automatisiert, schnell und verwechslungsfrei zu gewinnen. Radiofrequenz- und mobile Computertechnik unterstützen das ärztliche Personal am Krankenbett darin, Fehler bei der Verabreichung zu vermeiden; Prozessschritte werden automatisch dokumentiert. Michael Notter erwartet, dass die so verbesserten Prozesse nicht nur die Patientensicherheit erhöhen, sondern auch das Personal entlasten werden.
Aus dem Bereich der Intensivmedizin stammt das dritte geförderte Projekt. Dabei geht es darum, dem Delir vorzubeugen, einer akuten Funktionsstörung des Gehirns. Sie tritt insbesondere bei Patientinnen und Patienten sehr häufig auf, die intensivmedizinisch behandelt werden. Präventionsmaßnahmen von Delirien können sich nachweislich positiv auf das Überleben und die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten im Anschluss an die Behandlung auswirken. Mit den gewährten Fördermitteln wird Dr. Alawi Luetz (Charité) die notwendige Steuersoftware eines optischen Bespielungssystems weiter verbessern, um diese zur Marktreife zu bringen.
Die drei vom BIH Technologietransferfonds Medizintechnik 2015 geförderten Projekte wurden Ende Juni 2015 von einer externen Expertenkommission in Rahmen eines zweistufigen Verfahrens ausgewählt. Antragsberechtigt waren Forscherinnen und Forscher der Charité - Universitätsmedizin Berlin und des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC).
Über das Berliner Institut für Gesundheitsforschung/Berlin Institute of Health (BIH)
Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung/Berlin Institute of Health (BIH) wurde 2013 gegründet. Es ist ein Zusammenschluss der Charité - Universitätsmedizin Berlin und des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) mit dem Ziel, translationale Medizin basierend auf einem systemmedizinischen Ansatz und durch die beschleunigte Übertragung von Forschungserkenntnissen in die Klinik sowie die Rückkoppelung klinischer Befunde in die Grundlagenforschung voranzubringen. Seit April 2015 ist das BIH selbstständige Körperschaft des öffentlichen Rechts, Charité und MDC sind darin eigenständige Gliedkörperschaften. Das Institut wird mit neuen wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen in der Biomedizin neue diagnostische, therapeutische und präventive Ansätze in der Medizin und damit für die Gesundheit der Menschen schaffen.
produzieren, bilden / 13.07.2015
Summer School bietet praxisnahen Überblick über den Prozess der Arzneimittelentwicklung
Bereits zum neunten Mal organisieren der Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland (VBIO e.V.) und das Gläserne Labor Berlin-Buch in diesem Jahr die bewährte „Biotech & Pharma Business Summer School“. Die Veranstaltung findet vom 9. bis 12. September 2015 auf dem Campus Berlin-Buch statt. Die Summer School vermittelt Nachwuchskräften aus Academia und Industrie einen umfassenden Überblick über den komplexen Prozess der Arzneimittelentwicklung und -zulassung. Ziel des Intensivkurses ist ein vertieftes Verständnis für Herangehensweisen, Erfordernisse und potentielle Konflikte in den einzelnen Phasen.\n
\n
Überblick über alle Phasen: Von der Grundlagenforschung bis zur Zulassung
\nDer Einstieg in das Berufsfeld „Arzneimittelentwicklung“ fällt vielen Absolventen biowissenschaftlicher Studiengänge nicht leicht: Der Prozess von der Grundlagenforschung zu Zulassung eines Medikamentes ist langwierig, und stark reguliert. Es herrschen ausgeprägte Arbeitsteilung und sehr spezifische Herangehensweisen. Die Biotech & Pharma Business Summer School schafft hier Orientierung. Sie vermittelt einen grundlegenden Überblick über den Gesamtprozess der Wertschöpfungskette von der Wirkstoffforschung über Entwicklung und Patentierung eines Wirkstoffes, präklinische und klinische Tests bis hin zu Produktion und Zulassung.
Die Biotech & Pharma Business Summer School richtet sich an alle, die einen Einblick in die unterschiedlichen Phasen der Arzneimittelentwicklung gewinnen und sich darüber beruflich qualifizieren wollen. Nachwuchswissenschafter aus der biomedizinischen Grundlagenforschung sind ebenso angesprochen wie Young Professionals aus Biotechnologieunternehmen und forschenden Pharmazieunternehmen.
\n
Erfahrene Dozenten aus der Praxis
Gemeinsam verfolgen die Teilnehmer in Vorträgen und praktischen Übungen den langen Weg von der Idee, über die Entwicklung bis hin zum Markt. Die Dozenten aus Forschungsinstitutionen, Pharma- und Biotech-Unternehmen, bringen neben Denkimpulsen, auch Tipps und Tricks aus der Praxis ein. Die anspruchsvolle und vielseitige Mischung aus Gesprächen, Diskussionsrunden, Vorträgen, Fallbeispielen und praktischen Übungen ermöglicht es den Teilnehmern, sich im Verlauf des fünftägigen Kurses ein vertieftes Verständnis über die Abläufe bei der Arzneimittelentwicklung zu erarbeiten.
Die Summer School zeichnet sich aus durch ihre große Praxisnähe und die persönliche Atmosphäre. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 20 begrenzt, eine frühe Anmeldung wird empfohlen.
\n
Details und Anmeldung
\nNähere Informationen bzw. Anmeldeunterlagen erhalten Sie unter www.vbio.de und unter www.glaesernes-labor.de/biotech_pharma.shtml.
\nFür Rückfragen stehen Ihnen Dr. Kerstin Elbing (elbing@vbio.de; Tel. 030-27891916) und Daniela Giese (d.giese@bbb-berlin.de, Tel: 030-9489-2922) gerne zur Verfügung.
forschen / 10.07.2015
MDC ehrt Prof. Carmen Birchmeier-Kohler zum 60. Geburtstag mit wissenschaftlichem Symposium
Prof. Birchmeier-Kohler befasst sich mit molekularbiologischen Fragen der Embryonal- und Organentwicklung der Säuger, die unter anderem bei Fehlentwicklungen des Nervensystems, bei Skelettmuskel- und Herz-Erkrankungen sowie Krebs eine Rolle spielen. Mit Hilfe so genannter "Knock-out"-Mäuse – bei ihnen werden gezielt bestimmte Gene ausgeschaltet, um zu sehen, welche Funktion sie im Organismus haben – konnte sie mit ihren Mitarbeitern die Rolle verschiedener Wachstumsfaktoren und ihrer Rezeptoren sowie der von ihnen kontrollierten Transkriptionsfaktoren für die Entwicklung des Organismus entschlüsseln.
Ausbildung in Deutschland, der Schweiz und den USA
Die am 6. Juli 1955 in Waldshut in der Nähe der Schweizer Grenze geborene Forscherin studierte von 1974 – 1979 Chemie und Biochemie an den Universitäten Konstanz, der University of California, San Diego (UCSD) sowie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich. Nach ihrer Promotion 1984 bei dem Molekularbiologen Prof. Max Birnstiel an der Universität Zürich ging sie als Postdoktorandin an das Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) auf Long Island, New York, in das Labor des Genetikers Prof. Michael Wigler, einem Pionier der Onkogen-Forschung. In Cold Spring Harbor entdeckte sie selbst zwei dieser Gene, die Krebs auslösen, wenn sie mutiert sind. Prof. Wigler war zu dem Geburtstagssymposium nach Berlin gekommen und referierte über die Entwicklung von Methoden zur Früherkennung von DNA-Mutationen, die zu Krebs und auch Autismus führen können.
Nur zwei Jahre nach ihrer Postdoktorandenzeit erhielt Carmen Birchmeier-Kohler eine Wissenschaftlerstelle am CSHL, und drei Jahre später, 1989, wurde sie Leiterin einer unabhängigen Juniorforschungsgruppe am Max-Delbrück-Laboratorium der Max-Planck-Gesellschaft in Köln. 1993 erhielt sie einen Ruf an das 1992 gegründete MDC und kam dann 1995, vor 20 Jahren, als Forschungsgruppenleiterin nach Berlin-Buch.
Seit 2002 hat sie zudem eine C4-Professur an der Medizinischen Fakultät der Freien Universität (FU) Berlin inne, jetzt Charité – Universitätsmedizin Berlin. Zudem ist sie im Vorstand des Exzellenzclusters NeuroCure, ein im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder gefördertes Programm an der Charité mit dem Forschungsschwerpunkt Neurowissenschaften. Weiter ist sie stellvertretende Sprecherin des Sonderforschungsbereichs (SFB) 665 zu Entwicklungsstörungen im Nervensystem.
Neben dem Leibniz-Preis 2002 erhielt Prof. Birchmeier-Kohler 1989 den Bennigsen Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen. 2002 wurde sie zum Mitglied der European Molecular Biology Organization (EMBO) gewählt und 2012 zum Mitglied der Academia Europaea.
Breit gefächertes Themenspektrum
So vielfältig die Forschungsinteressen von Prof. Birchmeier-Kohler sind, so breit gespannt war auch der Bogen der Vorträge auf ihrem Geburtstagssymposium. Den Festvortrag hielt Prof. Thomas Jessell von der Columbia Universität in New York über „Spinal Circuits for Skilled Movements“ (Die Bedeutung spinaler Schaltkreise für die Motorik). Er gilt als der Experte für die Spezifizierung neuronaler Schaltkreise im Rückenmark. Das motorische Nervensystem und seine Schaltkreise standen auch im Fokus des Vortrags von Prof. Silvia Arber vom Biozentrum der Universität Basel.
Erst seit wenigen Jahren ist bekannt, dass auch das Gehirn Erwachsener über Stammzellen verfügt und damit das Potential zur Erneuerung von Nervenzellen hat. Darüber, welche Signale und Faktoren diese Stammzellen regulieren, sprach Prof. François Guillemot vom Francis Crick Institute in London. Prof. Rhona Mirsky vom University College in London berichtete über die Fähigkeit von Schwann-Zellen geschädigte Nervenzellen, bzw. deren Ausläufer, die Axone, zu reparieren.
Prof. Christian Haass von der Ludwig-Maximilians Universität München beleuchtete in seinem Vortrag die Frage, ob ein bestimmtes Eiweiß, das Enzym Beta-Secretase, für die Entwicklung einer Therapie gegen Alzheimer Angriffsziel sein und ausgeschaltet werden kann. Das Enzym ist an der Entstehung der Plaques bei der Alzheimer Krankheit beteiligt, die den Untergang von Nervenzellen auslösen. Über den Tastsinn berichtete Prof. David Ginty von der Harvard Medical School in Boston. Prof. Gary Lewin vom MDC referierte über den afrikanischen Nacktmull, der in Kolonien unter der Erde lebt und keinen Säureschmerz empfindet.
Organisatoren des MDC-Symposiums waren Prof. Gary Lewin, Prof. Fritz G. Rathjen, Prof. Erich Wanker und Dr. Michael Strehle. Es wurde finanziell unterstützt vom Sonderforschungsbereich SFB 665 sowie vom Exzellenzcluster NeuroCure.
leben / 10.07.2015
Bucher Bürgerforum über die Zukunft der Waldweide und das Gut Hobrechtsfelde
Erfolgreiches Konzept der Waldweide wird fortgesetzt
\nFünfzig Meter Sicherheitsabstand zu den Weidetieren im Waldweidegebiet zwischen Karow und Schönower Heide empfiehlt Revierförster Olaf Zeuschner Spaziergängern, die durch die Gehege streifen. Ganz besonders dann, wenn die Kühe Jungtiere mit sich führen. Zwar sind seit Beginn des Beweidungsprojekts im Jahr 2011 keine ernsthaften Zusammenstöße zwischen Mensch und Tier dokumentiert, doch sollte man die Tiere dennoch respektieren, rät er.
\nDas Waldweideexperiment, das vier Jahre durch das Bundesamt für Naturschutz, das Land Berlin, die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg, Landkreis Barnim und Förderverein Naturpark Barnim gefördert worden ist, hat großen Anklang in der Öffentlichkeit gefunden. Umfragen unter Besuchern bescheinigen der halboffenen Landschaft um Hobrechtsfelde einen hohen Attraktivitäts- und Erholungswert.
\nDie Förderung des Projekts ist in diesem Frühjahr ausgelaufen. Eine neue Zukunft bekommt es durch einen neuen Träger, die Berliner Forsten, die den bisherigen Beweider – die Agrar GmbH Hobrechtsfelde – weiterhin beauftragt hat, die Rinder und Pferde auf den ca. 800 ha großen Beweidungsflächen zu betreuen.
\n\n
Revier für Seeadler, Neuntöter und Biber
\nWie der Pankower Forstamtsleiter Romeo Kappel auf dem Bucher Bürgerforum feststellte, sei die Zahl der Erholungssuchenden bei schönem Wetter auf durchschnittlich 1400 pro Tag angewachsen. Das wissenschaftliche Begleitprogramm des Waldweideprojekts insbesondere durch die Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (BB berichtete) habe u. a. gezeigt, dass die Biodiversität durch die Beweidung ansteigt. In den halboffenen Flächen sind viele vom Aussterben bedrohte Vogelarten anzutreffen, wie der Neuntöter, Wendehals oder Seeadler. Fledermausarten und Kiebitze haben zugenommen, zwei Wiedehopfpaare gibt es in der Schönower Heide. Neubewohner der Flächen ist ein Biber, der am sogenannten Teich 13 entdeckt wurde.
\nBis 2020 wollen die Forsten das Projekt vorerst weiterführen. Kleine Korrekturen in den Tierbesatzzahlen werde es geben, um Schäden zu minimieren. Aus dem Bucher Hochwald sollen alle Weidetiere verschwinden. Geplant ist weiterhin, an der Bucher »Moorlinse« eine Aussichtsplattform zu errichten.
\n\n
Neues Konzept für das Stadtgut Hobrechtsfelde
\nDer Leiter des Naturparks Barnim Dr. Peter Gärtner stellte das neue Konzept für das »Mustergut Hobrechtsfelde« vor. Punkten soll es künftig als technisches Denkmal, als Besucher- und Informationszentrum für den Erholungsraum und als Ausflugsort vor den Toren Berlins. 13 Millionen Euro hat der Förderverein des Naturparks Barnim für das Gesamtpaket veranschlagt.
»Planer, Architekten und Akteure haben ein Konzept entwickelt, in dem es nicht darum geht, ein neues Disneyland zu erschaffen«, so Peter Gärtner. Es gehe darum, den traditionell landwirtschaftlich genutzten Raum wieder zu beleben und in Verbindung zu setzen zum Naherholungsgebiet um Hobrechtsfelde.
Konkret wollen die Akteure den Gutseingang wieder von der Dorfstraße ermöglichen. Geplant sind große Gewächshäuser auf dem Gelände, die im Winter als Orangerie genutzt werden können. Die Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH in Lobetal sind als Betreiber im Gespräch. Regional produzierte Produkte sollen in einem gutseigenen Hofladen vertrieben werden. Auf der Gutshoffläche seien Märkte vorstellbar, kleinere und größere Events, wie das traditionelle Walpurgisnachtfeuer.
\nDen rechten Gutsbereich sollen 80 bis 200 m2 große regionale Produktionswerkstätten flankieren, die zum landwirtschaftlichen Charakter des Ortes passen. Die Tiergehege werden verkleinert und südlich des Speichers konzentriert, hinter dem Speicher könnte es einen Naturerlebnisparcour geben. In den alten Speicher soll Gastronomie einziehen.
\nWie viel neue Entwicklung verträgt der kleine Ort Hobrechtsfelde? Diese Frage ist das Stichwort für die Anwohner von Hobrechtsfelde. Während des Bürgerforums meldeten sie sich zu Wort. »Bei den vergangenen Events in diesem Jahr rollte eine riesige Lawine von Menschen und Autos an. Alles war zugeparkt, die Grasnarben wurden zerstört. Nach dem Walpurgisfeuer konnten wir drei Tage kein Fenster öffnen. Wir leiden unter Lärm und Dreck – das ist keine Lebensqualität mehr«, erklären sie. Und auch Ulf Heitmann, Vorstand der WBG Bremer Höhe, der die Wohnhäuser gehören, meint, der 240-Seelen-Ort vertrage keine Großveranstaltungen.
Heitmann versucht seit einigen Jahren, das alte Gemeinschaftshaus im Dorf wieder zu beleben. Ein ernst zu nehmender Interessent ist gefunden – Karuna e. V., der bereits in Buch die Montessori-Schule betreibt. Vielleicht kann im Gemeinschaftshaus Arbeiten und Wohnen verwoben werden, hofft Ulf Heitmann. Wird der Veranstaltungssaal in diesem Zusammenhang revitalisiert, könnten hier kleinere Veranstaltungen stattfinden.
Dr. Peter Gärtner versteht die Aufregung nicht. »Großveranstaltungen sind in unserem Konzept nicht vorgesehen.« Im Eingangbereich des Gutes sei ein Parkplatz geplant. Noch in diesem Jahr soll eine Betreibergesellschaft die benötigten Fördermittel einwerben. Der Förderverein Naturpark Barnim freut sich über Partner, die wirtschaftlich mit einsteigen wollen.
\n\n
Text: Kristiane Spitz
\nAbbildung: Zukünftiges Mustergut: Der Speicher soll einen flachen Anbau erhalten, um dort einen Gastronomiebetrieb zu ermöglichen. Auf dem Gelände sollen Werkstätten für regionale Produkte (gelb markiert) entstehen, ein Hofladen und Gewächshäuser (blau markiert). (Abb.: Förderverein Naturpark Barnim e.V.)
leben, bilden / 10.07.2015
Umweltbildung im eigenen Schulwald

Vor zehn Jahren entstand die Idee, die Kinder der staatlichen Bucher Grundschule ein Stück vom nahegelegenen Forst pflegen zu lassen. Daraus entstand ein eigener Schulwald – der einzige in Berlin.
Ein Heer von kleinen Hainbuchen und Stieleichen trägt die Namen der Schülerinnen und Schüler, die sie gepflanzt haben. Noch sind die Schilder unter Hülsen verborgen, die die jungen Bäume schützen. In vier bis fünf Jahren, wenn die Bäume groß genug sind, kommen sie wieder ans Licht. Ihre Paten werden dann schon längst die Schule gewechselt haben, aber vielleicht ihrem Wald, dem Schulwald der Grundschule Am Sandhaus, noch verbunden sein.
Der Bucher Forst wächst zu weiten Teilen auf ehemaligen Rieselfeldflächen. Seit sie vor etwa 30 Jahren stillgelegt wurden, hat man zahlreiche Anstrengungen unternommen, die belasteten Flächen aufzuforsten. Teile des ausgetrockneten porösen Bodens wurden aufwändig mit Lehm stabilisiert und Flächen erneut mit Wasser versorgt. Inzwischen ist eine abwechslungsreiche Landschaft entstanden, in der seit einigen Jahren sogar Schottische Hochlandrinder und Konikpferde weiden. Für die Umweltbildung ist dieser Forst mehr als prädestiniert, weshalb das Schulwaldprojekt von Beginn an durch die Berliner Forsten unterstützt wurde.
Unterricht im Freilandlabor
Lebenskundelehrerin Ingrid Bonas, die das Projekt koordiniert und begleitet, bildet pro Jahr etwa 24 Schüler als „Waldmanager“ aus. Von April bis in den Herbst verbringen die Kinder mit ihr rund 14 Stunden im „Freilandlaboratorium“, beobachten die Natur, lernen das Ökosystem Wald kennen und pflegen ihr Waldstück. Außerdem bereiten sie die schulischen Pflanztage vor.
„Viele Viertklässler warten schon ungeduldig darauf mitzumachen, denn Waldmanager können sie erst ab der fünften Klasse werden“, so Frau Bonas. Voraussetzung ist die Erlaubnis der Eltern und ein Fahrradführerschein – der Schulwald will schnell erreicht sein. Einen Teil der Theorie erfahren die Waldmanager im Winter, wenn Biologin Antje Neumann Themen wie biologische Vielfalt und Klimaschutz vermittelt oder mit ihnen anhand von Knospen Baumarten bestimmt. Der Winterunterricht wird von der Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE finanziert, ebenso der Kauf junger Bäume für den Schulwald. Karin Schulz, Leiterin des HOWOGE-Servicecenters in Buch, erklärt das Engagement: „Uns liegt dieses Projekt am Herzen, denn unser Eindruck ist, dass die unmittelbaren Walderfahrungen zunehmend verloren gehen. Viele Bucher Kinder wachsen eher als Stadtkinder auf, obwohl der Wald vor der Tür liegt.“
Dass in den letzten Jahren junge Bäume gekauft und mit Hülsen versehen wurden, ist einem Lernprozess geschuldet. „Anfangs haben die Klassen im Bucher Forst eigenständig junge Triebe von Ahorn und Buche ausgegraben und unter Anleitung der Forstmitarbeiter eingepflanzt. Doch die wenigsten Bäumchen entwickelten sich. Meist hatten die Wurzeln das Ausgraben nicht überstanden oder Rehe die Triebe verbissen“, berichtet Frau Bonas.
Gemeinsam Bäume pflanzen
Nun finden jeden Herbst zwei erfolgversprechende Pflanzaktionstage für alle größeren Schüler der Grundschule Am Sandhaus statt – ab der dritten Klasse sind sie dabei. Auf dem Weg zum Schulwald gibt es bereits Stationen mit Wissensfragen oder Sportaufgaben, die die Waldmanager vorbereiten und betreuen. Die eigentliche gemeinsame Arbeit im Schulwald wird von Forstleuten begleitet. „Es ist beeindruckend zu sehen, mit welcher Energie die Kinder dabei sind, Bäume zu pflanzen, Hülsen anzuheften oder Unkraut zu beseitigen“, so Ingrid Bonas, „sie arbeiten locker zwei Stunden ohne Pause durch.“ Dieser Einsatz wird honoriert – mit Baumpatenschaften
und Lagerfeuer beim Förster.
„Durch den direkten persönlichen Bezug der Schülerinnen und Schüler zu ihrem eigenen Wald erhält die schulische Umweltbildung einen besonderen Stellenwert“, sagt Ingrid Bonas. „Wir spüren das auch bei den Anmeldungen. Der Schulwald wird von vielen Eltern als großes Plus hervorgehoben.
Text: Christine Minkewitz
forschen / 08.07.2015
W2-Professur für MDC-Hirnforscher Jochen Meier an der TU Braunschweig
Prof. Meier erforscht die Informationsverarbeitung im Gehirn im Zusammenhang mit Erkrankungen, bei denen das Zentralnervensystem hypererregt ist, wie zum Beispiel bei Epilepsien und Muskelkrämpfen. Im gesunden Organismus besteht immer ein Gleichgewicht zwischen der Erregung von Nervenzellen (Neuronen) und ihrer Hemmung. Es gibt im Gehirn Rezeptoren wie den Glyzin-Rezeptor, die elektrische Impulse im Gehirn hemmen und die somit nicht an die nachgeschaltete Nervenzelle weitergeleitet werden. Ist die Funktionsweise dieser hemmenden Rezeptoren verändert, geht bei den Betroffenen quasi die Sicherung durch und es kommt zu Übererregbarkeits-Zuständen.
Um herauszufinden, was im Gehirn auf molekularer Ebene schief läuft, erforscht Prof. Meier einen Vorgang, den die Forschung als RNA-Editierung bezeichnet. Dabei werden beim Umschreiben der in den Genen enthaltenen DNA-Textbausteine in RNA auf enzymatischem Weg einzelne Buchstaben durch andere ersetzt. Das Ergebnis ist, dass der in der Sprache der Gene, der DNA, verfasste Ursprungstext nicht mehr deckungsgleich ist mit der RNA, der Sprache, die den Code für die Textbausteine der Proteine enthält. „Mit dieser Maßnahme gelingt es der Zelle, sich über die im Genom vorgeschriebene Information hinwegzusetzen und ihrer eigenen genetischen Textvorgabe durch gezielt gesetzte Änderungen einen völlig anderen Sinn zu geben“, erläutert der Biologe dieses Phänomen. Prof. Meier will auch in Braunschweig nach solchen Stellen im Nervensystem fahnden und ihre Rolle bei neurologischen Erkrankungen studieren. „Eine detaillierte Kenntnis der molekularen, zellulären und physiologischen Vorgängen ist die Grundvoraussetzung für die Entwicklung effektiver Therapieansätze“, betont der Hirnforscher.
Jochen Meier wurde am 14. Oktober 1970 in Neustadt an der Weinstraße geboren. Er studierte von 1990 bis 1995 an den Universitäten Mainz, Tübingen und Heidelberg Biologie. Nach seinem Diplom am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg ging er 1996 für vier Jahre an die École Normale Supérieure nach Paris, Frankreich, und promovierte im Jahre 2000 an der Universität Pierre et Marie Curie. Während dieser Zeit erhielt er mehrere Stipendien, unter anderem vom Verband der Chemischen Industrie (VCI) und von der NATO. Von 2001-2006 forschte er am Johannes-Müller-Institut für Physiologie der Charité - Universitätsmedizin Berlin und erhielt 2006 die Leitung einer Helmholtz-Hochschul-Nachwuchsgruppe der Helmholtz-Gemeinschaft am MDC. Darüber hinaus war er auch immer in der Lehre aktiv und erhielt von den Studenten des Internationalen Studiengangs Medical Neurosciences der Charité zwei Lehrpreise.\n
Foto: Prof. Jochen Meier (Photo: David Ausserhofer/Copyright: MDC)
forschen / 07.07.2015
Prof. Michael Bader vom MDC in São Paulo ausgezeichnet
Prof. Bader ist Biologe und Pharmakologe, hat an der Universität Freiburg studiert und an der Freien Universität Berlin habilitiert. Seit 1994 ist er Forschungsgruppenleiter am MDC und hat seit 2010 eine Professur für Molekulare Kardiovaskuläre Endokrinologie an der Charité – Universitätsmedizin Berlin inne. Die Stiftung ist benannt nach Emil Karl Frey und Eugen Werle, den Entdeckern des Kallikrein-Kinin-Systems. Sie wurde 1988 von dem Zeitungsverleger und Förderer von Wissenschaft und Forschung, Henning Leonhard Voigt, gegründet. Empfänger der Medaille waren unter anderem die beiden Nobelpreisträger Prof. Oliver Smithies und Prof. Robert Huber.\n
Weitere Informationen: www.frey-werle-foundation.com/Activities.html#Anchor-Recipients-14210#http://www.frey-werle-foundation.com/Activities.html#Anchor-Recipients-14210
\nFoto: Prof. Michael Bader (Photo: David Ausserhofer/ Copyright: MDC)
leben / 03.07.2015
Quartier in Sommerlaune
„Die Kultur Tage Buch“, so Andreas Dahlke, Gesellschafter der Ludwig Hoffmann Quartier Objektgesellschaft, „sollen eine Tradition begründen, die das Leben in Buch bereichert. Das entspricht dem Selbstverständnis des Ludwig Hoffmann Quartiers als ein Ort, an dem es sich nicht nur gut wohnen, sondern auch gut leben lässt. Hier gibt es alles, von Schulen bis zu Gesundheitseinrichtungen, was einen Wohnstandort attraktiv macht.“
Anlässlich der Eröffnung der Kultur Tage Buch war auch Matthias Köhne, Bezirksbürgermeister von Pankow, ins Ludwig Hoffmann Quartier gekommen. In seiner Grußansprache sagte er: „Dieses Projekt gehört zu den derzeit größten Wohnungsbauvorhaben nicht nur in Pankow, sondern in ganz Berlin. Mit mehr als 700 Wohnungen und einer umfassenden sozialen Infrastruktur verkleinert das Ludwig Hoffmann Quartier die in Buch bestehende Lücke zwischen Angebot und Nachfrage attraktiver Wohnmöglichkeiten spürbar.“\n
Die Schulen im Quartier, eine gute Anbindung an die Innenstadt, der nahe Naturpark Barnim und erschwingliche Mieten gaben für viele den Ausschlag hierher zu ziehen. „Wir erleben erstmals, wie schön der Sommer hier im Quartier ist, wenn sich viel im Freien abspielt“, so eine junge Mutter. „Wir genießen den Park, lernen unsere Nachbarn kennen und die Kinder schließen Freundschaften.“ Mittlerweile bringen viele Bewohner selbst Vorschläge ein, das Leben im Quartier zu gestalten.
\n
Veranstaltungsvielfalt
Das Programm der Kultur Tage Buch am Eröffnungstag zeichnete sich durch eine große Vielfalt aus. Dabei reichte das Spektrum der Angebote von einer Führung durch das unter Denkmalschutz stehende Gebäudeensemble sowie Wohnungsbesichtigungen über interaktive Spiele für Kinder von Pfeffersport e.V. bis zu einem Jazzkonzert am Abend.
Die Ausstellungen sind bis zum 9. Juli 2015 täglich von 16 - 19 Uhr zu besichtigen.
\n
Über die Ausstellungen
\n„Whispering Wall“ im Festhaus (Haus 20)
Von den Wänden hallen Schritte durch den leeren Saal, Vogelzwitschern und Außengeräusche füllen den Raum. „Grenzgänger“ ist der Titel des Audiostücks, das die Besucher in den Bann zieht. Im oberen Stockwerk des Festhauses: eine verfallene Kammer mit einer Lautsprecherwand, aus der Worte der „Enttäuschung“ klingen. Im nächsten Saal durchmisst eine Komposition für Violine den Raum, die nur einen einzigen Ton variiert.
Die verschiedenen Audioinszenierungen von Albert Raven lassen das Gebäude intensiv wahrnehmen. Noch unsaniert, vermittelt es einen Eindruck von der Geschichte des Areals.
albertraven.de/projects-whisperingwall
Ausstellung „Im Rauschen des Ozeans – Formation der Kraft“ (Haus 25)
Die Kühle der gekachelten Böden und Wände im früheren Küchentrakt ist wie geschaffen für die großformatigen Fotografien von Vincent Mosch. Sie zeigen Wasserbewegungen, Wellen und Gischt in faszinierenden Details. Allein die Präzision der Abbildungen lässt spüren, welche ungeheuren Kräfte das Meer beherrschen. Die Schönheit einer einzelnen Welle ist ebenso Thema wie kleinste Elemente des aufschäumenden Wassers.
www.vincentmosch.de
Über das Ludwig Hoffman Quartier
\nDas Ludwig Hoffmann Quartier (LHQ) ist eine komplexe Stadtquartierentwicklung in Berlin-Buch mit einem finanziellen Volumen von 250 Millionen Euro. Realisiert wird das Projekt von der Ludwig Hoffmann Quartier Objektgesellschaft mbH & Co. KG., mit Gesellschafter Andreas Dahlke an der Spitze. Bis Ende 2018 werden auf dem rund 280.000 Quadratmeter großen Areal ebenfalls etwa 700 Wohnungen, zwei Schulen, ein Kindergarten, eine Sporthalle mit dazugehöriger Sportanlage, eine Seniorenwohnanlage und weitere soziale Einrichtungen entstehen. 2014 wurden 240 Wohnungen fertiggestellt, von denen ein Großteil bereits bezogen ist. Um die Einheitlichkeit des Ensembles aus mehr als 30 überwiegend denkmalgeschützten Gebäuden zu wahren, wird ein denkmalpflegerisches Leitkonzept für die Sanierung der Gebäude und zur Wiederherstellung des Parkdenkmals im neoklassizistischen Stil umgesetzt.
Foto: Zur Eröffnung der Kultur Tage Buch begrüßte Andreas Dahlke, Gesellschafter des Ludwig-Hoffmann-Quartiers (Mitte) den Bezirksbürgermeister Matthias Köhne (rechts) und den SPD-Bundestagsabgeordneten für Pankow, Klaus Mindrup. (Foto: Frederic Schweizer)
leben / 03.07.2015
Planfeststellungsverfahren zur ökologischen Entwicklung der Panke - Auslegung bis zum 28.07.2015
Vom 29. 06. 2015 bis zum 28. 07. 2015 liegen die Planunterlagen an folgenden Standorten zur Einsichtnahme aus:
\n
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt,
\nAm Köllnischen Park 3, 10179 Berlin (Lichthof, linker Seitenraum)
Montag bis Freitag 10.00 - 18.00 Uhr
Stadtteilbibliothek Buch,
\nWiltbergstraße 19-23, 13125 Berlin
\n
Montag 13.00 - 19.00 Uhr
Dienstag 11.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch 13.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 13.00 - 19.00 Uhr
Freitag 13.00 - 17.00 Uhr
\n
Bibliothek am Luisenbad,
\nTravemünder Straße 2, 13357 Berlin
Montag bis Freitag 10.00 - 19.30 Uhr
Zusätzlich sind die Planunterlagen auch im Internet unter www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/wasser/ogewaesser/de/pfv.shtml einsehbar.
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der auf der o.g. Internetseite abrufbaren amtlichen Bekanntmachung.
leben, erkunden, bilden / 03.07.2015
Der Archäologie- und Abenteuerspielplatz Moorwiese feiert Geburtstag
14 - 19 Uhr zum sechsten Male das Gauklerfest statt.
Nach einem Umzug zu Beginn können die Kinder an Moorlympiaden-Disziplinen ihr Können unter Beweis stellen: Wettnagel, Sockeln, Bogenschießen, Speerschleudern, Holzschwirren, Stelzenlaufen, Sackhüpfen, Eierlaufen. Ab 16 Uhr beehren uns die Hussiten von TRIVIUM aus Bernau und ab 17 Uhr wird es ein Bühnenprogramm mit Überraschungsgästen nicht nur für Kinder geben.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt, auch gibt es ein Karussell, Grabungsgeschichten, Zinnguß, Märchenhütte und einen Infostand, wo man alles zu den aktuellen Entwicklungen auf der Moorwiese und darüber hinaus erfahren kann.
Partner 2015: der Waldkindergarten Waldkind, Der Spielwagen, Der Würfel, Abenteuerspielplatz Kolle37, Trivium, Immoscout24
Die Moorwiese ist geöffnet:
Dienstags - Freitags 13:30 - 18 Uhr für Kinder von 6 - 16 Jahren Samstags ist Familientag von 13 -18 Uhr
Schließzeit: 26.7. - 17.8.2015
Ansprechpartner:
Martyn Sorge
ArchäologieSpielProjekt MOORWIESE
Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.
Wiltbergstr. 29a, 13125 Berlin – Buch
0176 57 266 053
http://mooor.de
Kinderklub "Der Würfel"
Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.
Wolfgang-Heinz-Str. 45, 13125 Berlin
Telefon: +49 30 94 93 055 Fax: +49 30 94 79 38 53 http://www.kinderclub-wuerfel.de/\n
\n
Foto: Abenteuerspielplatz mit Lehmbauten - gebaut nach dem Vorbild archäologischer Funde (Foto: Moorwiese)
investieren, produzieren / 30.06.2015
IPSEN hat die Übernahme der OctreoPharm Sciences abgeschlossen
OPS wurde 2009 gegründet und entwickelt innovative Medikamente für das klinische Management von neuroendokrinen Tumoren (NET). OPS hat die erste Finanzierungsrunde im Jahr 2011 mit dem VC Fonds Technologie Berlin (IBB Beteiligungsgesellschaft), Eckert Life Science Accellerator, Berlin und der KfW durchgeführt. In einer zweiten Finanzierungrunde beteiligten sich Shaanxi Xinyida Investment Co. Ltd., Xian (China) und die Eckert & Ziegler AG als neue Investoren an der OPS.
“Als neuer Teil von IPSEN, einem der führenden Pharmaunternehmen auf dem Gebiet der neuroendokrinen Tumore, werden wir in der Lage sein, den signifikanten Mehrwert von OPS201 und OPS202 in aussagekräftigen klinischen Studien zügig zu bestätigen. Dies wird das theranostische Konzept als Innovation im Bereich der Nuklearmedizin vorantreiben“ sagte der Geschäftsführer und Mitbegründer der OctreoPharm Sciences GmbH, Dr. Hakim Bouterfa.
Das Therapeutikum OPS201, welches dieses Jahr mit der Phase I/II der klinischen Testung beginnen wird, beruht auf einem antagonistischen Somatostatin Analog der nächsten Generation mit verbesserter Bindung zum sst2 Rezeptor. Da das Peptid im Vergleich zu den derzeit genutzten Agonisten der zweiten Generation, wie DOTA-TATE, DOTA-TOC oder DOTA-NOC, bis zu 5-mal mehr radioaktive Dosis an den Tumor transportieren kann, ist es ein vielversprechender Kandidat, der das Potenzial besitzt, das Ergebnis der Peptid-Rezeptor-Radionuklidtherapie (PRRT) zu verbessern. Im Rahmen eines theranostischen Ansatzes entwickelt OPS dasselbe Peptid als Gallium-68 markiertes Diagnostikum OPS202 für die PET-CT.
Prof. Dr. Richard P. Baum, Chefarzt des Zentrums für Molekulare Radiotherapie an der Zentralklinik Bad Berka und Mitglied des wissenschaftlichen Beratungsgremiums von OPS, kommentierte: „Die Firma hat kürzlich auf der SNMMI Konferenz in Baltimore, USA, überzeugende erste klinische Ergebnisse von OPS202 vorgestellt. Diese Daten deuten stark darauf hin, dass die Anwendung der neuen antagonistischen Peptide einen zusätzlichen klinischen Nutzen für die GEP/NET Patienten verspricht.“
Christian Seegers, Senior Investment Manager der IBB Beteiligungsgesellschaft, sagte: „Die Gründer haben seit Abschluss der ersten Finanzierungsrunde im März 2011 sehr effizient und zielgerichtet Produktkandidaten für die Diagnose und Therapie von neuroendokrinen Tumoren entwickelt. Mit IPSEN konnte der ideale Partner für die Weiterentwicklung von OPS201 und OPS202 gefunden werden. Wir sind hoch erfreut über diesen sehr attraktiven Exit.“
IPSEN plant die Unternehmensstandorte und die Belegschaft zu erhalten, um so einen erfolgreichen Transfer des Know-hows und der Expertise der OPS sicherzustellen.
Marc de Garidel, Chairman und CEO von IPSEN, erklärte: „Die Übernahme von OctreoPharm ermöglicht IPSEN den Zugang zu einem neuen wissenschaftlichen Gebiet, auf dem die OctreoPharm eine einzigartige Expertise im Bereich antagonistischer Peptide für die Diagnose und Behandlung von neuroendokrinen Tumoren besitzt. Dies ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, die weltweit führende Position im Management von NET zu erreichen und unterstreicht die Relevanz unserer Entwicklungsstrategie.“
Über die OctreoPharm Sciences GmbH:
Die OctreoPharm Sciences GmbH mit Sitz in Berlin (Deutschland) ist ein auf die klinische Entwicklung insbesondere von Radiopharmazeutika für die Diagnostik und Therapiekontrolle neuroendokriner Tumore spezialisiertes Unternehmen. Weitere Informationen unter www.octreopharmsciences.com.
Über die IBB Beteiligungsgesellschaft:
Die IBB Beteiligungsgesellschaft (www.ibb-bet.de) stellt innovativen Berliner Unternehmen Venture Capital zur Verfügung und hat sich am Standort Berlin als Marktführer im Bereich Early Stage Finanzierungen etabliert. Die Mittel werden vorrangig für die Entwicklung und Markteinführung innovativer Produkte oder Dienstleistungen sowie für Geschäftskonzepte der Kreativwirtschaft eingesetzt. Seit März 2015 befinden sich zwei von der IBB Beteiligungsgesellschaft verwaltete Fonds in der Investitionsphase, der VC Fonds Technologie Berlin II mit einem Fondsvolumen von 60 MEUR und der VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin II mit einem Fondsvolumen von 40 MEUR. Beide VC Fonds sind finanziert durch Mittel der Investitionsbank Berlin (IBB) und des europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE), verwaltet vom Land Berlin. Seit 1997 hat die IBB Beteiligungsgesellschaft Berliner Kreativ- und Technologieunternehmen in Konsortien mit Partnern über 1.006 MEUR zur Verfügung gestellt, wovon die IBB Beteiligungsgesellschaft 141 MEUR als Lead-, Co-Lead oder Co-Investor investiert hat.
\n
Lesen Sie auch den Artikel in der Berliner Morgenpost, der am 3. Juli 2015 zum Thema erschien:
www.morgenpost.de/berlin-aktuell/startups/article205438629/Franzosen-zahlen-50-Millionen-Euro-fuer-Berliner-Start-up.html
forschen, investieren, produzieren, leben, heilen / 25.06.2015
Berliner Zukunftsorte präsentierten sich auf dem Berliner Hoffest 2015
Am gemeinsamen Stand der Berliner Zukunftsorte informierte sich Michael Müller über die Entwicklungspotenziale und Aktivitäten der zehn Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorte, die das Wirtschaftswachstum und die Strahlkraft Berlins als „Smart City“ in den nächsten Jahren maßgeblich bestimmen werden. Hardy Schmitz, Geschäftsführer der WISTA Management GmbH und Dr. Ulrich Scheller, Geschäftsführer der BBB Management GmbH Campus Berlin-Buch, zeigten, welches Potenzial in den Transformationsräumen und Zukunftsorten dieser Stadt steckt. Durch eine enge Vernetzung von Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft bieten Standorte wie Adlershof, Buch, Schöneweide oder der EUREF Campus technologie- und wissensorientierten Unternehmen exzellente Bedingungen für Innovation und Kreativität. Orte wie der CleanTech Businesspark, Tegel oder Tempelhof werden künftig jeweils eigene Akzente setzen.
Zu den Besuchern des Zukunftsorte-Stands gehörten auch Staatssekretär Henner Bunde, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung, und die Geschäftsführer von Berlin Partner, Andrea Jora (im Amt ab 1. Juli 2015) und Dr. Stefan Franzke.
Foto: (v.r.n.l.) Am Stand der Berliner Zukunftsorte: Der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller; Dr. Ulrich Scheller, Geschäftsführer der BBB Management GmbH Campus Berlin-Buch; Hardy Schmitz, Geschäftsführer der WISTA Management GmbH; Andrea Joras, neue Geschäftsführerin von Berlin Partner (ab 1. Juli 2015) und Dr. Stefan Franzke, ebenfalls Geschäftsführer von Berlin Partner. (Foto: Manfred Gutzmann)\n
forschen / 25.06.2015
Neue Omics-Technologieplattform des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung eröffnet
Die Forschung des BIH ist translational und systemmedizinisch ausgerichtet. WissenschaftlerInnen, die in BIH-Projekten tätig sind, benötigen deshalb eine hochmoderne Forschungsinfrastruktur, die speziell auf die Anforderungen ihrer Arbeit zugeschnitten ist. Um dies zu gewährleisten, hat das BIH im Jahr 2014 einen großen Teil – 29 Prozent – seines Infrastruktur-Budgets in den Ausbau und die Ausstattung der verschiedenen Technologieplattformen investiert.
Für den Aufbau der Omics-Plattform wurden rund sieben Millionen Euro verausgabt: Die Genomik-Plattform arbeitet jetzt mit zwei hochmodernen Sequenziergeräten („Next Generation Sequencing“) und bietet damit ein breites Spektrum an Sequenzierungsmethoden an. Die Metabolomik-Plattform ist mit jeweils drei neuesten Massenspektrometern ausgestattet. Je nach Probenmaterial können etwa 100 polare Verbindungen und zusätzlich mehrere hundert höhermolekulare Verbindungen analysiert werden. Auch die Proteomik-Plattform wurde mit zwei hochauflösenden Massenspektrometern der neuesten Generation ausgestattet. Hier können sowohl „targeted“ als auch „non-targeted“ proteomische Analysen durchgeführt werden. Damit ist es je nach Anforderung möglich, sowohl viele tausende Proteine als auch einige spezifische Proteine mit großer Genauigkeit zu identifizieren und zu quantifizieren. Die neu etablierte Roboter-basierte Probenvorbereitungspipeline ermöglicht einen hohen Probendurchsatz und eine hohe Reproduzierbarkeit der Präparationen.
Die mittels Omics-Technologien generierten Daten werden beispielsweise benötigt, um neue krankheitsassoziierte Gene, Metaboliten und Proteine zu identifizieren und zu charakterisieren. Zusammen mit einem Stammzelllabor und ergänzt durch die Bioinformatik und die IT-Infrastruktur des BIH bietet die Omics-Plattform einen integrierten Service für die wissenschaftlichen Arbeiten. Die Expertise der Omics-Plattform wird bereits vielfach eingesetzt; unter anderem arbeiten die 2014 angelaufenen großen Verbundprojekte des BIH, in denen zu Alzheimer, Erbkrankheiten bei Kindern und T-Zell-Therapie bei Krebs geforscht wird, mit Omics-Verfahren.
Die neue Omics-Platform vereint die verschiedenen Omics-Hochdurchsatztechnologien unter einem Dach und ist somit zukunftsweisend für die Etablierung neuer Forschungsinfrastrukturen. Das Konzept für den Aufbau der neuen BIH-Omics-Plattform basiert auf der erstklassigen Expertise der Technologieplattformen des Berliner Instituts für medizinische Systembiologie (BIMSB) und des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin (MDC).
Die Omics-Technologieplattform des BIH befindet sich auf dem Campus Berlin-Buch, im dafür umgebauten „BIH Open Space Labs“-Gebäude. Bis Ende August 2015 soll die Inbetriebnahme aller Geräte abgeschlossen und die Omics-Plattform voll funktionsfähig sein. Weitere BIH-Technologieplattformen im Aufbau sind Bioinformatik, Stammzellen, IT, Biobank, Bildgebende Verfahren in der Medizin, Transgene Techniken und Chemische Biologie.
Über das Berliner Institut für Gesundheitsforschung/Berlin Institute of Health (BIH)
Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung/Berlin Institute of Health (BIH) wurde 2013 gegründet. Es ist ein Zusammenschluss der Charité - Universitätsmedizin Berlin und des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin (MDC) mit dem Ziel, translationale Medizin basierend auf einem systemmedizinischen Ansatz und durch die beschleunigte Übertragung von Forschungserkenntnissen in die Klinik sowie die Rückkoppelung klinischer Befunde in die Grundlagenforschung voranzubringen. Seit April 2015 ist das BIH selbstständige Körperschaft des öffentlichen Rechts, Charité und MDC sind darin eigenständige Gliedkörperschaften. Das Institut wird mit neuen wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen in der Biomedizin neue diagnostische, therapeutische und präventive Ansätze in der Medizin und damit für die Gesundheit der Menschen schaffen.
Kontakt:
Alexandra Hensel
Berliner Institut für Gesundheitsforschung|Berlin Institute of Health (BIH)
Kapelle-Ufer 2 | 10117 Berlin | Germany
Tel. +49 (0)30 450 543019
Fax +49 (0)30 450 7543999
hensel@bihealth.de
www.bihealth.org
bilden / 22.06.2015
KARUNA und Gläsernes Labor eröffnen neue Lernstationen der KARUNA-Präventionsparcours
Heute haben der KARUNA - Zukunft für Kinder und Jugendliche in Not International e.V. und das Gläserne Labor in Berlin neue Lernstationen des Präventionsparcours von KARUNA pr|events "Von Wimpertierchen und badenden Eiern" in Anwesenheit der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales, Frau Christine Köhler-Azara, feierlich eröffnet.
\n
KARUNA – Zukunft für Kinder und Jugendliche in Not e. V. versteht sich als ein Netzwerk spezialisierter Angebote an den Schnittstellen der Jugend- und der Suchthilfe, im Bereich der Demokratiebildung, der Partizipation, in der Prävention und Inklusion durch Kindergarten und Schule, sowie im Themenfeld der Armutslinderung im In- und Ausland.
Das Gläserne Labor in Berlin-Buch ist eine 1999 gegründete Bildungseinrichtung auf dem renommierten Wissenschafts- und Biotechnologiepark Campus Berlin-Buch. Seine drei Forschungslabore bieten als außerschulische Lernorte rund 20 Experimentierkurse zu den Themen Genetik, Neurobiologie, Zellbiologie, Ökologie, Chemie und Physik für Schüler der Sekundarstufe an.
KARUNA pr|events ist ein Angebot des KARUNA e.V. und bietet interaktive Aktionsparcours zu verschiedenen Themen der Suchtprävention an. Dabei wird Wissen zu den Themen Alkohol, Tabak, Cannabis, gesunde Lebensführung, Umgang mit Medien spielerisch vermittelt und direkt angewendet.
Im Rahmen der Zusammenarbeit des KARUNA e.V. und des Gläsernen Labors in Berlin-Buch haben 40 Schüler der KARUNA Montessori Gemeinschaftsschule unter realen Laborbedingungen zu chemischen und biologischen Phänomenen des Tabaks und des Alkohols geforscht. Die Ergebnisse des Kooperationsprojektes wurden genutzt, um für die Mitmachparcours von KARUNA pr|events neue Lernstationen zu bauen. Diese ermöglichen den ca. 20.000 Schülerinnen und Schülern, die KARUNA pr|events jährlich besuchen, die noch tiefere Auseinandersetzung mit der Wirkungsweise von Tabak und Alkohol. Ziel der erweiterten Ausstellung ist es, die forschungsnahen Experimentierkurse des Gläsernen Labors mit den Präventionsangeboten von KARUNA pr|events zusammenzubringen, so dass möglichst viele Schüler und Multiplikatoren von den Projektergebnissen dieses einmaligen Kooperationsmodells profitieren können.
Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales, Frau Köhler-Azara
„Durch die Kooperation des Karuna e.V. und dem Gläsernen Labor war es möglich, dass Schülerinnen und Schüler durch Experimentieren eigene Erkenntnisse über die Wirkungen von Alkohol und Tabakrauch auf Lebewesen gewinnen konnten. Als Landesdrogenbeauftragte begrüße ich es sehr, dass sich die jungen Menschen aktiv und mit Spaß an der Sache suchtpräventives Wissen erarbeitet haben. Und ich gratuliere den Initiatoren des Projektes zu ihrer Idee, Suchtprävention erlebbar zu machen.“
Gläsernes Labor, Christian Forbrig
„Oft führt der Reiz des Unbekannten dazu, Drogen aus Neugier auszuprobieren. Dem konnten wir vorgreifen, indem wir Substanzen wie Tabak, Alkohol und Cannabis aus einer analytischen Perspektive betrachteten und damit die von ihnen ausgehenden Risiken aufdecken konnten. Zum Erfolg des Projektes führte bestimmt auch der Projektcharakter, über einen längeren Zeitraum mit denselben Bezugspersonen intensiv an einem Thema und über verschiedene Zugänge zu arbeiten. Dazu gehörten Experimente im Labor, Exkursionen in professionelle Analytiklabore, Gespräche mit Betroffenen und die Nachbearbeitung im Unterricht.“
Karuna e.V., Jörg Richert
„Wir freuen uns über die Ausstellung und die neuen Lernstationen, die aus der Zusammenarbeit des KARUNA e.V. und dem Gläsernen Labor entstanden sind, weil so Präventionsangebote nachhaltig wirken können. Selbständig und wissenschaftlich gewonnene Erkenntnisse werden in die Lebenswelt junger Menschen integriert und befähigen sie zu einer bewussten und fundierten Entscheidung im Umgang mit Drogen. Wir beabsichtigen mit der Ausstellung bei KARUNA pr|events unsere Präventionsangebote mit der pädagogisch wertvollen und forschungsnahen Arbeit im Gläsernen Labor zu verknüpfen und für möglichst viele Kinder und Jugendlichen erlebbar zu machen.“
Kontakt
KARUNA pr|events
Mauritiuskirchstr. 3
10365 Berlin
Foto: Experiment mit Zigarettenrauch: Welche schädlichen Stoffe sind im Rauchgas enthalten? (Foto: KARUNA e.V.)
investieren, leben / 19.06.2015
Eröffnung des Bucher Schlossparkportals nach Sanierung
Das Eingangsportal des Schlossparks Buch wurde am Donnerstag, dem 25. Juni 2015 durch den Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Jens-Holger Kirchner (Bü90/Grüne), wieder zur Nutzung freigegeben. In den letzten 20 Monaten wurden die Mauern, Zäune und Tore überarbeitet und fehlende Teile ergänzt.
\nDer Vorplatz zur Straße erhielt einen neuen Belag und die ehemals vorhandenen Bäume wurden nachgepflanzt. Auf der Schlossparkseite des Portals wurden der Weg und die beidseitigen Grünflächen erneuert. Während der Bauzeit war der Zugang zum Park gesperrt, so dass durch die Freigabe des Portals der historische Eingang wieder nutzbar sein wird.
\nDie Gesamtkosten belaufen sich auf 250.000 EUR und wurden aus der bezirklichen Investitionsplanung finanziert.
\n\n
Foto: Zahlreiche engagierte Bucher Bürger waren gekommen, um das schöne, repräsentative Portal mit einzuweihen. Viele von ihnen pflegen den Park ehrenamtlich. (Foto: Bezirksamt Pankow)
investieren, leben / 18.06.2015
Straßenbau in der Bucher Wiltbergstraße beginnt im Juli 2015
Der Durchgangsverkehr der Wiltbergstraße wird in beiden Richtungen über eine ertüchtigte Umleitungsstrecke geführt. Diese führt über die Hobrechtsfelder Chaussee, den Pölnitzweg und die Straße Alt-Buch. Nicht nutzbar ist die Umleitung wegen der Eisenbahnbrücke im Pölnitzweg für Fahrzeuge ab einer Höhe von 3,90 Meter.
Aufgrund von Staugefahr wird gebeten, die Baustelle möglichst weiträumig zu umfahren. Es wird angestrebt, die Erreichbarkeit des P+R Parkplatzes während der 1. Bauphase über die Umleitungsstrecke aufrecht zu erhalten. Die geplante Bauzeit beträgt vier Jahre. Die geplanten Kosten belaufen sich auf ca. 6.980.000 EUR und werden aus dem Programm Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) finanziert.
\n
Foto: Wiltbergstraße in Höhe Schlosspark-Passage (Foto: BBB Management GmbH)
forschen / 18.06.2015
Helmholtz International Fellow Award für Prof. Yehudit Bergman aus Israel
Prof. Sommer würdigte in seiner Rede Prof. Bergman als international anerkannte Expertin für Epigenetik. Unter Epigenetik versteht die Forschung Mechanismen, die nicht die Erbinformation DNA in ihrer Sequenz verändern, sondern regulieren, wann welche Gene abgelesen und angeschaltet werden. Prof. Bergman konzentriert sich dabei zum einen auf die Rolle epigenetischer Mechanismen bei der Entwicklung des Immunsystems, zum anderen auf den Einfluss epigenetischer Faktoren auf Stammzellen und die Entstehung von Krebs. Sie arbeitet seit Jahren eng mit dem Krebsforscher und Immunologen Prof. Klaus Rajewsky vom MDC zusammen. Darüber hinaus kooperiert sie auch mit dem Epigenetiker Prof. Frank Lyko vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg, das wie das MDC ebenfalls zur Helmholtz-Gemeinschaft gehört. Dabei geht es um ein Helmholtz-Israel-Projekt zu chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen.
Prof. Bergman hat außerdem maßgeblichen Anteil am Aufbau des Deutsch-Israelischen Helmholtz-Doktorandenkollegs „Frontiers in Cell Signaling & Gene Regulation“ (SignGene), das das MDC, die Hebrew University und das Technion – Israel Institute of Technology in Haifa im Januar 2013 gegründet haben. Weitere Partner sind die Humboldt-Universität zu Berlin (HU) und die Charité – Universitätsmedizin Berlin. Das internationale Ausbildungsprogramm für junge Naturwissenschaftler läuft bis 2019. Es markiert einen Höhepunkt der seit Jahren engen wissenschaftlichen Beziehungen zwischen dem MDC und seinen Partnern in Israel.
Yehudit Bergman stammt aus Tel Aviv, Israel. Sie promovierte 1980 in Immunologie am Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel und ging anschließend an die Stanford University in Kalifornien, USA, um ihren Postdoc in Immunologie und dann in Molekularbiologie am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge zu machen. An der Hebrew University in Jerusalem hat sie den Dr. Emanuel Rubin Chair für Medizin inne und ist dort gewähltes Mitglied des Senats der Medizinischen Fakultät. 2004 wurde sie zum Mitglied der European Molecular Biology Organization (EMBO) in Heidelberg gewählt.\n
\n
Foto: Helmholtz International Fellow Award für die Krebsforscherin und Immunologin Prof. Yehudit Bergman, Hebrew University Jerusalem (HUJI), Israel, mit Prof. Thomas Sommer, Vorstand (komm.) des MDC Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft nach der Preisverleihung am 18. Juni 2015 im MDC. (Photo: Peter Himsel/ Copyright: MDC)
\n
leben, erkunden / 15.06.2015
Kultur Tage Buch: Flüsternde Wände, Bilder des Ozeans und Jazzmusik
Unter dem Motto „Kultur verbindet“ bieten die Kultur Tage Buch in diesem Jahr ein vielfältiges Programm. Besonders hervorzuheben sind dabei eine Klanginstallation und eine Fotoausstellung.
Für das frühere Festhaus hat der niederländische Künstlers Albert Raven zwei Audio-Werke produziert, die eine besondere Begegnung mit dem Gebäude und seiner Geschichte ermöglichen. Sie sind Teil seines Projekts „Whispering Wall“ (Flüsterwand), das frühere Klänge heraufbeschwört und mit den neuen Klängen des Gebäudes verschmelzen lässt. „Bewegt man sich durch das Gebäude, beeinflusst die Audioinstallation nicht nur das Hören, sondern auch das Sehen und Denken. Es macht darauf aufmerksam, was war und was wäre, was ist und was sein könnte“, beschreibt Albert Raven.
Die zweite Ausstellung mit dem Titel "Im Rauschen des Ozeans - Formation der Kraft", zeigt erstmals Fotografien und eine Videoinstallation von Vincent Mosch zu diesem Thema. Ausstellungsort ist der verlassene Küchentrakt des Genesungsheims, dessen morbider Charme im starken Kontrast zu den Werken von Mosch steht. Ihn fasziniert die Kraft des Ozeans, die hereinbrechende Flut, die sinnbildlich für den grundlegenden Wandel eines Ortes stehen kann: „Die Tiefe des Ozeans findet ihren Ausdruck in der Welle, die sich scheinbar so unerklärlich aus ihm erhebt. An der Oberfläche wird sie zur dramatischen Akteurin eines gewaltigen Schauspiels, Endpunkt einer Schwingung, die sich in der Brechung offenbart: Eine enorme Kraft, die aus anderen, fernen Zusammenhängen resultiert, wird plötzlich sichtbar“.
Musikalischer Höhepunkt wird am Eröffnungstag das Konzert des „Deuce Jazzpel Duos“ sein.
Für Familien und Kinder hält der Sportverein Pfefferwerk e.V. am 3. Juli einen Parcours bereit, den man mit Pedalos und oder Rollstühlen befahren kann. Darüber hinaus lässt sich die inklusive Sportart Frisbee-Golf ausprobieren, die auch für Rollstuhlfahrende geeignet ist.
Zu den Gästen zählen neben Bucher Bürgern und Bewohnern des Ludwig Hoffmann Quartiers auch Vertreter aus der Politik und Wirtschaft Berlins und des Bezirks Pankow. Der Bezirksbürgermeister von Berlin Pankow, Matthias Köhne, wird das Eröffnungsgrußwort halten.
\n
Eröffnung der Kultur Tage Buch am 3. Juli 2015
15.00 - 17.30 Uhr, am Haus 20:
Kinder- und Familienprogramm
- \n
- Infostände, interaktive Spielstände \n
- für Kinder \n
- Historische Führung \n
- Wohnungsbesichtigungen \n
- Spanferkel und weitere regionale Köstlichkeiten von Ingos Gerüchteküche \n
18.00 Uhr, vor Haus 20
Eröffnung der Kultur Tage Buch durch das Ludwig Hoffmann Quartier und Bezirksbügermeister Matthias Köhne
18.30 Uhr, Haus 25:
Vernissage der Ausstellung "Im Rauschen des Ozeans - Formation der Kraft", Fotografien von Vincent Mosch
19.00 Uhr, Haus 20:
Vernissage der Audioinstallation "Whispering Walls" von Albert Raven
20.00 - 21.00 Uhr, am Haus 20:
Konzert des Deuce Jazzpel Duos
Die Ausstellungen sind vom 4. - 9. 7. 2015 täglich von 16 - 19 Uhr zu besichtigen.
Hier finden Sie das Programm zum Download.
\n
Über die Kultur Tage Buch
Bereits vor einem Jahr fand im Ludwig Hoffmann Quartier ein Kulturevent unter dem Titel „Historische Woche“ anlässlich des 100jährigen Jubiläums des Areals statt. Unter anderem wurden Werke des Grafikers und Bilderhauers Ignatius Taschner ausgestellt sowie Fotografien der Künstlergruppe „EXurban“. Die Kultur Tage Buch sollen einen positiven Beitrag zur Kultur in Berlin-Buch leisten. Das entspricht dem Selbstverständnis des Ludwig Hoffmann Quartiers als lebendiger Stadtteil, indem man nicht nur gut wohnen, sondern auch angenehm leben kann. Mit zwei Schulen, einem Kindergarten, einer geplanten Sportanlagen sowie geplanten Servicewohnungen für Senioren und anderen sozialen Einrichtungen besitzt das Ludwig Hoffmann Quartier alles, was einen Wohnstandort attraktiv macht. Außerdem steht das Stadtquartier allen offen. Dieser Geist soll auch mit den Kultur Tagen Buch lebendig werden.
Kontakt für Rückfragen:
Ludwig Hoffmann Quartier
Objektgesellschaft mbH & Co. KG
Wiltbergstraße 50, Haus 13
13125 Berlin
Telefon: 030 - 40 50 59 54
Mobil: 0171 22 3000 5
anne.kretschmar@l-h-q.de
Weitere Informationen:
www.ludwig-hoffmann-quartier.de
https://de-de.facebook.com/ludwighoffmannquartier
\n
Foto: Zum 100-jährigen Jubiläum wurden im großen Saal des Festhauses Werke des Bilderhauers Ignatius Taschner gezeigt. (Foto: BBB Management GmbH)
\n
forschen, produzieren, leben, erkunden, bilden / 13.06.2015
15. Lange Nacht der Wissenschaften auf dem Campus – Die Welt der Biologie, Chemie und Medizin – großes Angebot auch für Jugendliche und Kinder
Beliebt bei den Besuchern auf dem Campus Berlin-Buch waren die Führungen durch die Forschungslabore von MDC, FMP und ECRC. So konnten die Besucher zum Beispiel im MDC lernen, weshalb die nur wenige Zentimeter großen Zebrafische es ermöglichen, die Funktion des Herzens des Menschen detailliert zu erforschen. Sie erfuhren, wie Gene stillgelegt werden und wozu. Vom Blut zur Diagnose: In einem anderen MDC-Labor konnten Besucher in die Welt der kleinsten Moleküle unseres Körpers eintauchen und erfahren, wie Wissenschaftler das humane Metabolom – alles was mit dem Stoffwechsel zusammenhängt - mit Unterstützung der modernsten Technik der Massenspektrometrie erforschen.\n
\n
Am FMP erfuhren die Besucher bei der Laborführung „Von Würmern und Menschen – was wir von Nematoden übers Altern lernen können“, wie der Alterungsprozess abläuft und warum gerade ältere Menschen von Demenz und neurodegenerativen Krankheiten betroffen sind. In einer anderen FMP-Laborführung lernten die Besucher, welche Auswirkungen Fehlfunktionen im Kommunikationsprozess des Gehirns haben können und konnten unter Anleitung Zellen kultivieren und unter dem Mikroskop betrachten. In den FMP-Vorträgen „Arzneimittel, Drogen, Gifte, Homöopathie – was Sie darüber wissen sollten“ und „Stille Post – wie Nervenzellen miteinander kommunizieren“ erläuterten die Referenten den Unterschied zwischen Arzneimittel und Gift und wie die neuronale Kommunikation in unserem Gehirn erforscht wird. „Kennen Sie vielleicht noch die TKKG-Bande?“, wurden die Besucher am FMP gefragt und eingeladen einen spannenden Kriminalfall zu lösen. Ausgestattet mit einer 3D Brille tauchten die Besucher ein in die Welt der Proteinstrukturen und lernten Neues über den genetischen Fingerabdruck.
\n
Im Gläsernen Labor waren die Besucher bei fünf verschiedenen Programmen zum Mitmachen eingeladen. So konnten sie die bunte Welt der Chemie erkunden, mittels DNA-Analyse ein fiktives Verbrechen aufklären, Axone, Dendriten und Synapsen in Aktion erleben, Wasserproben untersuchen und Biobrennstoffzellen bauen.
Lesung mit Bernhard Kegel: Die Herrscher der Welt: Wie Mikroben unser Leben bestimmen
Der Berliner Schriftsteller Bernhard Kegel stellte sein neues Buch „Die Herrscher der Welt: Wie Mikroben unser Leben bestimmen“ vor. Erst dank verbesserter DNA-Analysen erkennen Forscher, wie schwindelerregend hoch die Zahl und Vielfalt von Bakterien, Viren und anderen Mikroben ist – und wie groß ihre Bedeutung.
Forscherdiplom für Kinder
Auf Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter warteten zahlreichen Experimentierstationen. Die Einrichtungen des Campus, der Forschergarten sowie die Partnerschulen des Gläsernen Labors luden zum Experimentierten rund um Biologie, Chemie und Physik ein. So konnten die kleinen Forscher lernen, wie man Fingerabdrücke nimmt und vergleicht, eine Nachricht in Geheimschrift verfassen, das Unsichtbare unter dem Mikroskop sichtbar machen und kaltes Licht erzeugen. Eifrige kleine Forscher erhielten ihr persönliches Forscherdiplom.
Auch in diesem Jahr konnten die Besucher außerdem wieder aus 14 Bildern die drei besten Bilder der Wissenschaft küren. Die Ausstellung hatte das MDC organisiert. Beim Speakers‘ Corner sprachen Wissenschaftler über ihre Lieblingsthemen in interaktiven Kurzvorträgen. Bereits zum zweiten Mal auf dem Campus zu Gast war das mobile BIOTechnikum, ein doppelstöckiges Ausstellungsfahrzeug des Bundesforschungsministeriums mit Labor, multimedialer Ausstellung und Kino. Hier konnten sich Jugendliche über Karrierewege in der Biotechnologie informieren.
\n
Foto: Wie ist die Maus zu Haus? (Foto: Peter Himsel/Campus Berlin-Buch)
leben / 12.06.2015
4. VitalLauffest: HOWOGE lud zum großen Sportereignis in Buch
Vom Sportplatz der Marianne-Buggenhagen-Schule, der Ausgangs- und Zielpunkt war, starteten zuerst die Bambini-Läufer über eine Distanz von 800 Metern. Die "Großen" folgten bei den 5-km-Jedermann-, 9-km-Fortgeschrittenen und 5-km-Firmenläufen. Moderator Christoph Azone von RadioEINS sorgte für gute Stimmung und feuerte die Läuferinnen und Läufer zusätzlich an.
Mit dabei waren Mitarbeiter des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin und der BBB Management GmbH, die mit je einem Team beim Firmenlauf antraten. Neben dem Lauf gab es für alle Gäste und Teilnehmende ein unterhaltsames Familienprogramm.\n
\n
Zu den Ergebnislisten und der HOWOGE-Bilder-Galerie geht es hier: http://www.howoge.de/unternehmen/aktuelles/artikel/4-vitallauf-der-howoge-fotos-und-ergebnisse.html
Foto: Auf dem Siegerpodest: Die BBB Management GmbH Campus Berlin-Buch belegte mit ihrem Team den dritten Platz: (v.l.n.r.) Geschäftsführer Dr. Ulrich Scheller, Eileen Bauer (CampusVital) und Lars Kempe. Im Vordergrund: Sophia Eltrop, Geschäftsführerin der HOWOGE. (Foto: Ralf Nordmann, BBB Management GmbH)
forschen, produzieren, leben, erkunden, bilden / 11.06.2015
Wissen lockt: Lange Nacht der Wissenschaften auf dem Campus Buch
Systembiologie: Von Würmern lernen, wie wir unsere Gene nutzen
Lassen Sie sich auf einer Führung in ein MDC-Labor die erstaunliche Fähigkeit des unsterblichen Plattwurms Schmidtea mediterranea zur Selbstheilung erklären, und wie die Forscher den Fadenwurm C. elegans nutzen, um den Code der Genregulierung zu entschlüsseln. Mit modernsten Techniken werden den Modellorganismen molekulare Geheimnisse entlockt, die einiges über uns Menschen lehren.
Zebrafisch – ein Modell für die Herz-Kreislauf-Forschung
Wäre der Zebrafisch ein Superheld aus den Marvel Comics, wäre er nahezu unsichtbar. Denn bei seinen durchsichtigen Babys können wir die gesamte Entwicklung der Organe beobachten. In der Langen Nacht der Wissenschaften führt die AG Panakova durch ihr Labor und erklärt, wie man Gene des Zebrafisches gezielt aus- und anschaltet, um den menschlichen Herz-Kreislauf besser zu verstehen.
DNA-Detektive: Finden Sie den Täter
Von Tatort bis CSI: Crime Scene Investigation – kaum ein TV-Krimi kommt ohne die DNA-Analyse aus, um den Mörder zu überführen. Im wahren Leben ist es nicht anders. Im Gläsernen Labor auf dem Campus Buch werden Besucher bei der Langen Nacht der Wissenschaften selbst zu Detektiven und klären ein fiktives Verbrechen auf.
MDC unter der Lupe
Zoomen Sie in die MDC-Forschung rein und entdecken Sie eine Welt mit mikroskopischen Wesen, Zellen in Petrischalen, Krankheiten auf zellulärer Ebene – zusammen mit Wissenschaftlern, die täglich daran arbeiten. Und lernen Sie Grundlegendes über die Technik, die all diese Geheimnisse enthüllt: die Mikroskopie.
Hacker auf dem Campus
Hacker lösen Probleme ähnlich wie Wissenschaftler – kreativ, aber mit weniger Materialeinsatz. MDC-Wissenschaftler zeigen selbstgebaute Hande-Mikroskope, die die eigenen Zellen knipsen (#cellfie!) und eine Laser-Lampe, die das Leben in einem Speichtropfen sichtbar macht.
Die Herrscher der Welt: Wie Mikroben unser Leben bestimmen
Erst dank verbesserter DNA-Analysen erkennen Forscher, wie schwindelerregend hoch die Zahl und Vielfalt von Bakterien, Viren und anderen Mikroben ist – und wie groß ihre Bedeutung. Lesung mit Buchautor Bernhard Kegel.
Das komplette Programm für Buch finden Sie hier.
Die Lange Nacht der Wissenschaften beginnt in Buch bereits ab 16.00 Uhr.
Veranstaltungsort:
Campus Berlin-Buch
Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin
Kontakt: Annett Krause M.A.
Telefon: 030 - 9489 2920
E-Mail: lnw@bbb-berlin.de
Weitere Informationen:
www.campus-berlin-buch.de
https://de-de.facebook.com/MaxDelbrueckCentrum
\n
Foto: Experimentieren im Gläsernen Labor (Foto: Peter Himsel)
\n
forschen / 10.06.2015
Kleine Unterschiede – Neue Einblicke in die Genregulation von Krankheitsgenen
Wird ein Gen abgelesen, wird sein in der Sprache der DNA enthaltener Bauplan für Proteine im Zellkern in RNA umgeschrieben (transkribiert). „Auf dieser Ebene erkennt man viele aber bei weitem nicht alle individuellen Unterschiede in der Genregulation“, erläutert Prof. Norbert Hübner, Senior Autor der Publikation und Leiter der Forschungsgruppe Medizinische Genomforschung und Genetik von Herz-Kreislauferkrankungen im MDC. Zusammen mit Sebastian Schafer (MDC, NHRIS) und Eleonora Adami (MDC) sowie Forschern aus mehreren Forschungseinrichtungen in Berlin, den Niederlanden, England und Tschechien, untersuchten sie deshalb die Genregulation auf der nächsten Ebene, der Translation. Sie findet außerhalb des Zellkerns, im Zellplasma statt. Bei der Translation wird die RNA-Sequenz in Aminosäuresequenzen übertragen (translatiert) und in den Proteinfabriken der Zelle, den Ribosomen, zu Proteinen zusammengebaut.
Zunächst durchforsteten die Wissenschaftler das komplette Genom zweier Rattenstämme, – ein Stamm hatte Bluthochdruck, der andere nicht – und schauten sich dort speziell die Gene von Herz- und Lebergewebe an. Dann setzen sie eine neue Technik ein, die als Ribosomal-profiling bezeichnet wird, kurz Ribo-seq. Sie ermöglicht es festzustellen, welcher Anteil an RNA tatsächlich in Protein umgesetzt (translatiert) wird. Das Ergebnis: bei der Translation hatten sie fast doppelt so viel unterschiedlich angeschaltete Herz- und Lebergene erfasst, wie bei der Transkription. Anschließend verglichen sie diese Daten mit den entsprechenden Genen des Menschen in genomweiten Assoziierungsstudien. Hier zeichnet sich ab, dass offenbar viele Herz- und Lebergene des Menschen hauptsächlich während der Translation reguliert werden. Die Forscher sind davon überzeugt, dass das Erfassen individueller Unterschiede bei der Translation neue Einblicke in die Genregulation von Erkrankungen ermöglicht.
*Translational regulation shapes the molecular landscape of complex disease phenotypes\n
forschen, heilen / 10.06.2015
Vom Neuroblastom lernen, wie sich Krebstumoren behandeln lassen
Krebs ist eine komplexe und deswegen schwer heilbare Krankheit: Tumorzellen entwickeln und verbreiten sich in einem dynamischen Prozess, bei dem unter anderem individuelle Eigenschaften der Erkrankten, Umweltbedingungen, erbliche und epigenetische Faktoren sowie die zelluläre Umgebung des Tumors eine Rolle spielen. Erfolgversprechende Wege zur Krebsbehandlung könnten deswegen individuelle therapeutische Interventionen auf der Basis von Biomarkern und molekularen Signaturen sein, die beispielsweise Aussagen über die Eigenschaften des Tumors und die Mechanismen der Metastasierung erlauben. Solche Daten können heute mit Hochdurchsatzverfahren gewonnen werden – bislang wird dieses Wissen noch nicht ausreichend für systemmedizinische Ansätze genutzt und in anwendbare Therapien übersetzt (Translation). Hier setzt das jetzt vom BIH geförderte Verbundprojekt „Terminate NB: From Cancer DiagnOMICS to Precision Medicine: Model Neuroblastoma“ unter Leitung von Prof. Dr. Angelika Eggert (Charité) und Prof. Dr. Matthias Selbach (MDC) an: Das Neuroblastom wird als Modellkrankheit genutzt, um ein Konzept zur Tumorcharakterisierung aufzubauen, das alle verfügbaren Daten auf molekularer Ebene integriert und mit dem sich neue Diagnostik- und Therapieansätze zur Behandlung dieses und anderer Krebsleiden entwickeln lassen.
Das Neuroblastom ist eine Krebserkrankung des Nervensystems, an der meist Kinder erkranken und die individuell sehr unterschiedlich verläuft. Während leichte Formen häufig ohne Therapie spontan ausheilen, ist die Krankheit in der schweren Form oft tödlich. Was sie für die Forschung interessant macht: Es gibt nur wenige Mutationen, die für das aggressiv bösartige Verhalten der schweren Form verantwortlich sind. Das erleichtert die Suche nach genetisch bedingten Ursachen der Krankheit. Zudem existieren für das Neuroblastom seit langem standardisierte Protokolle in der Diagnose und Therapie, so dass die ForscherInnen für ihre Untersuchungen auf umfangreiche und gut dokumentierte Patientenproben zurückgreifen können. Diese Proben werden im Projekt genutzt, um die zentralen Signalnetzwerke zu identifizieren und zu verstehen, welche für die typischen Eigenschaften der hochaggressiven Neuroblastom-Tumorzellen verantwortlich sind. Die geförderten ForscherInnen wollen die auftretenden Mutationen analysieren und ein besseres Verständnis für das unterschiedliche Verhalten der Tumorzellen entwickeln.\n
„Wir haben jetzt die Möglichkeit, mit den besten wissenschaftlichen und technologischen Verfahren neue Meilensteine in der Krebsforschung zu erreichen. Das Neuroblastom ist eine perfekte Modellkrankheit, um die molekularen Mechanismen zu analysieren, mit innovativen systemmedizinischen Ansätzen zu verstehen und daraus abgeleitete klinische Anwendungen auch auf andere Krebsarten zu übertragen“, sagt Projektleiterin Angelika Eggert. Sie ist Direktorin der Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie der Charité, Matthias Selbach ist Leiter der Forschungsgruppe „Proteome Dynamics“ des MDC. Er hat dort Technologien aufgebaut, mit denen Proteine in Tumorzellen systematisch charakterisiert werden können.„Zusammen mit den anderen Technologieplattformen am BIH sowie mit der Bioinformatik können wir jetzt erstmals einen Überblick über die relevanten Prozesse auf allen Ebenen bekommen“, sagt Matthias Selbach. Projektlaufzeit ist von August 2015 bis Juli 2019, geforscht wird in insgesamt acht interdisziplinär arbeitenden Teilprojekten mit 27 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von MDC und Charité.
\n
Kollaborative Verbundprojekte (Collaborative Research Grants) am BIH
Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung fördert gemeinschaftliche, interdisziplinäre Vorhaben von Charité- und MDC-Grundlagenforscherinnen und -forschern sowie Klinikerinnen und Klinikern. Ausschlaggebend für die Förderung ist ein systemmedizinischer Ansatz mit klarer translationaler Perspektive. Die Collaborative Research Grants sind eines der zwei entwickelten Instrumente zur Forschungsförderung. Mit ihnen werden größere, langfristig angelegte Verbundvorhaben mit bis zu acht Teilprojekten gefördert. Die Anträge wurden durch ein externes Gutachtergremium begutachtet. Collaborative Research Grants werden für einen Zeitraum von vier Jahren gefördert. Weitere Informationen zu den Verbundprojekten finden Sie im Internet (www.bihealth.org/de/forschung/forschungsprojekte).
Über das Berliner Institut für Gesundheitsforschung/Berlin Institute of Health (BIH)
Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung/Berlin Institute of Health (BIH) wurde 2013 gegründet. Es ist ein Zusammenschluss der Charité - Universitätsmedizin Berlin und des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin (MDC) mit dem Ziel, translationale Medizin basierend auf einem systemmedizinischen Ansatz und durch die beschleunigte Übertragung von Forschungserkenntnissen in die Klinik sowie die Rückkoppelung klinischer Befunde in die Grundlagenforschung voranzubringen. Seit April 2015 ist das BIH selbstständige Körperschaft des öffentlichen Rechts, Charité und MDC sind darin eigenständige Gliedkörperschaften. Das Institut wird mit neuen wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen in der Biomedizin neue diagnostische, therapeutische und präventive Ansätze in der Medizin und damit für die Gesundheit der Menschen schaffen.
leben, heilen, bilden / 08.06.2015
Medizin entdecken - Bucher Klinikum öffnet seine Türen zur Langen Nacht der Wissenschaften
Einblicke in den OP-Saal, begehbares Arterienmodell und Wissenswertes zur Gesundheitsvorsorge
Das Team des HELIOS Gefäßzentrums mit Angiologie, Diabetologie und Gefäßchirurgie informiert am begehbaren Arterienmodell über den anatomischen Aufbau einer Schlagader, mögliche Erkrankungen und Therapien. Über sechs Meter Länge werden hier Arteriosklerose, Gefäßverschluss, Thromben, Blutplättchen, die Anlage eines Bypasses zur Blutumleitung sowie moderne Behandlungsmethoden (Stentimplantation) bei Erweiterung der Schlagader (Aneurysma) dargestellt.
Bei Ernährungs-Quiz und spielerischen Übungen kann jeder sein Wissen über die Volkskrankheit Diabetes und die Forderung von Gesundheitsexperten „10.000 Schritte am Tag“ testen. Denn Bewegung stärkt das Herz, senkt den Blutdruck, beeinflusst den Blutfettspiegel günstig, fördert die geistige Wachheit, wirkt entspannend, verbessert die Belastbarkeit der Knochen und Sehnen, lässt unsere Muskeln wachsen und fördert die Durchblutung. Daran sind Sie interessiert? Dann haben Sie sicher auch Spaß an der neuen Rückenschule.
Sie wollten schon immer einen Operationssaal besuchen, ohne selbst gleich Patient zu sein? Oder sehen, wie ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk eingesetzt wird? Wie Ärzte ohne Skalpell operieren und eine endoskopische Untersuchung funktioniert? Wie Strahlen mit neuester Medizintechnik heilen helfen? Wie hoch ihr Herzinfarktrisiko und was eine Blutwäsche ist? Das und noch vieles mehr zeigen Ihnen die Medizinexperten vor Ort im Bucher Klinikum. Die Besucher können viel Interessantes über die Gesundheitsvorsorge erfahren und auch darüber, was Ärzte und Pflegefachkräfte mit ihren interdisziplinären Teams gemeinsam mit Physikern, Psychologen und Therapeuten sowie modernster Ausstattung leisten können.
Kinder-Uni und Babypass für nach 1942 in Buch Geborene
Besonders interessant für die kleinen Gäste sind sicher die Angebote der KinderUni. Hier gehen Chefärzte gemeinsam mit den Kindern vielen Fragen nach: Warum tut es nicht weh, wenn man operiert wird? Wie funktioniert die Haut – das größte Organ des Menschen? Wo kommt der blaue Fleck her? Sechs- bis Zwölfjährige können außerdem Sinne spielend erleben und von einer Hebamme erfahren, wie ein Kind zur Welt kommt.
Für nach dem 1.11.1942 in Berlin-Buch Geborene hat das Geburtshilfeteam etwas Besonderes vorbereitet: Bei Vorlage des Personalausweises wird ein neuer Babypass entsprechend der Angaben aus den inzwischen historischen Geburtenbüchern ausgestellt.
Zauberpflaster und Schlafluft, minimalinvasives Gummibärchenfischen und Kuscheltierröntgen sind auch in diesem Jahr wieder dabei. Außerdem gibt es Erste-Hilfe-Übungen unter dem Motto „Prüfen, rufen, drücken“, viele Gesundheits-Tipps für den Alltag sowie ein Spiel-, Sport- und Bühnenprogramm. Zu Gast sind die Kindergruppe der Musik- & Tanzschule „MelodiKa“ aus Berlin-Karow, die Cheerleaders der SG Schwanebeck 98 e.V., Angelika Mann und Clown Rainer König mit Liedern vom Traumzauberbaum und Zirkusgeschichten. Ein Elektrorollstuhlparcours, Gipskurs, Erste-Hilfe-Quiz, das Kinderschminken, Malen und Basteln, die Hüpfburg und Kulinarisches ergänzen das Angebot.
Herzlich willkommen am 13. Juni 2015 von 16 bis 23 Uhr im HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin. Karten gibt es ab 15.30 Uhr am Infotisch.
Foto: Ein Highlight bei der Langen Nacht der Wissenschaften im HELIOS Klinikum Berlin-Buch: Zu Besuch im Operationssaal. (HELIOS/Thomas Oberländer)
investieren, leben / 04.06.2015
Neue Gebiete für Stadtumbau in Buch
Herr Holtkamp, in Buch wurden zahlreiche Kitas und Freizeiteinrichtungen mit Hilfe der Stadtumbau-Förderung saniert. Welche neuen Vorhaben werden in nächster Zeit realisiert?
Es rücken andere Handlungsfelder in den Vordergrund, wie Wohnen, Verkehr und die Gestaltung des öffentlichen Raums. Das ist Ergebnis eines Dialogs mit Fachämtern, Unternehmen und der Öffentlichkeit. Noch 2015 wird eine neue Maßnahmenliste für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept für Berlin-Buch vom Bezirksamt beschlossen. Der Bezirk hat auch eine deutliche Erweiterung der Stadtumbau-Gebietskulisse bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt beantragt – fast eine Verdoppelung der Fläche. Ab 2016 sollte dann feststehen, welche Projekte grundsätzlich in das Förderprogramm aufgenommen werden.
Warum soll die Förderkulisse ausgedehnt werden?
Wenn wir neue Wohnbaupotenziale erschließen wollen, richtet sich der Blick inzwischen auf weitere Flächen, die nordwestlich der S-Bahn-Linie liegen. Auf dieser Seite wächst Buch durch das Ludwig-Hoffmann-Quartier in Richtung des heutigen Zentrums zusammen. Dort liegen die beiden früheren Regierungskrankenhäuser brach, und es gibt große Potenzialflächen für den Wohnungsneubau. Die erweiterte Kulisse würde auch das Umfeld des S-Bahnhofs umfassen, so dass wir uns der schwierigen Park & Ride-Situation annehmen könnten. Hunderte Pendler fahren mit dem Auto bis Buch, um dann in die S-Bahn umzusteigen, denn hier beginnt der Innenstadttarif. Auch die Fahrradparkplätze reichen kaum. Mit dem Förderprogramm Stadtumbau könnten wir das Umfeld des Bahnhofs attraktiver, funktionaler gestalten und zukunftsweisende Mobilität unterstützen. Gut ausgebaute Fahrradrouten zum Campus, zu den Kliniken und Wohnsiedlungen, E-Bike- und Carsharing-Stationen würden dem Gesundheitsstandort gut zu Gesicht stehen. Die Fahrradwege ließen sich teilweise mit dem entstehenden Panke-Erholungsraum verbinden.
Die Regierungskrankenhäuser stehen seit langem leer. Welche Aufgabe käme auf Sie zu, wenn diese Teil der Stadtumbaukulisse werden?
Neben vorbereitenden Fragen, etwa, wie die Flächen planungsrechtlich einzuschätzen sind, wäre unsere Aufgabe, zu überlegen, wie man mit Stadtumbau bestimmte Investitionshemmnisse beseitigen könnte. Die Spannbreite reicht dabei von Projektideen über Erschließungskonzepte bis hin
zum Abriss.
In welchen Zeiträumen könnte der Wohnungsneubau vorangehen?
Für kurz- bis mittelfristige Bauprojekte kämen der nördliche Teil der Brunnengalerie, ein Gebiet am Kappgraben – Buch IV genannt – sowie das Umfeld der Straße am Sandhaus in Frage.
Wie steht es um das geplante kooperative Bildungszentrum für Buch?
Das Bezirksamt favorisiert jetzt den Standort im künftigen dritten Teil der Schlosspark-Passage. Für den Bau des Bildungszentrums sollen unter anderem Stadtumbau-Mittel eingesetzt werden, da es ein neuer, wichtiger Anziehungspunkt sein würde. Die Beantragung der Mittel soll in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Die verlängerte Schlosspark-Passage wird auch als Tor zur Brunnengalerie fungieren und kann deren Entwicklung beflügeln.
Wieviel Geld darf Buch aus dem Stadtumbau-Programm erwarten?
Je nach Kulissenerweiterung, gut begründet – aber immer im Wettbewerb mit anderen Bezirken – rechnen wir mit zwei bis drei Millionen Euro pro Jahr.
Wann rechnen Sie mit der Entscheidung, ob das Bucher Stadtumbaugebiet erweitert wird?
Nach positiver Entscheidung durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt kann Endes des Jahres 2015 mit einem Senatsbeschluss über die Erweiterung der Stadtumbaukulisse in Buch gerechnet werden.
Wo sehen Sie Buch in zehn Jahren?
Der historische Ortskern ist mit der neuen Mitte, von Schlosspark-Passage bis Bürgerhaus zusammengewachsen. Buch ist ein attraktiver grüner Stadtteil mit sozial gemischter Bevölkerung, die die öffentliche und soziale Infrastruktur gemeinsam nutzt. Die vielen Menschen, die täglich nach Buch mit der S-Bahn zur Arbeit kommen, finden eine „Green and Smart City“ im besten Sinne vor.
Interview: Christine Minkewitz
Abbildung: Für eine attraktive Ortsmitte: Entwurf des Bildungszentrums (Abb. Widerker)\n
Mehr zur Aktualisierung des Integrierten Stadtentwicklungs- konzepts von Buch:
www.planergemeinschaft.de/ISEK-Buch
forschen, leben, heilen / 04.06.2015
Alzheimer – auf der Suche nach wirksamen Therapien
\n
\n
\n
\n
Wie ist Ihre Hochschulambulanz entstanden?
Im Norden Berlins und den angrenzenden Landkreisen leben sehr viele ältere Menschen, die allein aufgrund ihres Alters ein erhöhtes Risiko haben, an einer Gedächtniserkrankung zu leiden. Dies ist einer der Gründe, warum wir vor zwei Jahren die Gedächtnissprechstunde in Buch gegründet haben. Unsere Hochschulambulanz bietet eine spezialisierte Diagnostik von kognitiven Störungen, von der Betroffene aus der Region profitieren. Zum anderen finden wir hier am Experimental and Clinical Research Center der Charité und des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin (MDC) exzellente Bedingungen, um chronisch neurodegenerative Erkrankungen zu erforschen und Therapien zu entwickeln.
Welchen Schwerpunkt hat Ihre Ambulanz?
Die Ambulanz wendet sich generell an Menschen, die 50 Jahre oder älter sind und eine Minderung ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit oder eine dauerhaft gedrückte Stimmung bei sich feststellen. Viele chronisch neurodegenerative Erkrankungen werden erst mit dem Rentenalter, also 65 Jahren, symptomatisch. Wir sind aber daran interessiert, diese Erkrankungen zu erkennen, wenn noch keine Symptome auftreten und nur ein biologischer Nachweis möglich ist. In Sonderfällen, wenn der Verdacht auf eine erbliche neurodegenerative Erkrankung besteht, bieten wir auch jüngeren Patienten eine Untersuchung an.
Auf welche Weise ist es möglich, Patient Ihrer Ambulanz zu werden?
Um von uns aufgenommen zu werden, bedarf es lediglich einer Überweisung. Als Hochschulambulanz ergänzen wir die kassenärztliche Versorgung und sind ganz besonders darum bemüht, am Fortschritt in der Diagnostik und Behandlung von Patienten mitzuwirken. Unsere Diagnostik bieten wir zunächst allen Patienten an, unabhängig von klinischen Studien.
Welche Untersuchungen führen Sie durch?
Nach der Anamnese und einem ersten orientierenden Gedächtnistest legen wir fest, ob ein ausführlicheres neuropsychologisches Screening und Bluttests erfolgen sollten. Im Screening prüfen wir eine Vielzahl von kognitiven Domänen: die Gedächtnisleistung, die Orientierungsleistung und die Fähigkeit, komplexe Formen oder Muster zu erkennen und zu reproduzieren. Ergeben sich Auffälligkeiten, veranlassen wir eine Bildgebung des Kopfes sowie eine Untersuchung der Gehirnflüssigkeit.
Unsere Patienten haben den Vorteil, mittels Ultrahochfeld-Magnetresonanz-Tomographie untersucht werden zu können. Diese Technologie wird hier am ECRC eingesetzt und stellt das Gehirn in bisher unerreichter Genauigkeit dar. Unser Kooperationspartner ist Professor Niendorf, welcher die Berlin Ultrahigh Field Facility leitet. Die Untersuchung des Gehirnwassers, auch Liquor genannt, gehört ebenfalls zu unseren Spezialleistungen. Dadurch können wir zunächst ausschließen, dass die Gedächtnisstörungen durch eine chronische Entzündung des zentralen Nervensystems verursacht werden. Durch einen Vergleich der Eiweiße im Blut und im Liquor ermitteln wir, ob eine Störung der Blut-Hirn-Schranke vorliegt. Im nächsten Schritt bestimmen wir weitere Proteine im Liquor, sogenannte Neurodegenerations-Biomarker. Dazu gehören Beta-Amyloid-Proteine, aus denen die typischen Plaques entstehen und Tau-Proteine. Beide Spezialmessungen führen wir in Kooperation mit Professor Heppner von der Neuropathologie der Charité und Professor Erich Wanker vom MDC durch.
Wie profitieren die Patienten von der Gedächtnissprechstunde?
Wir können dank der spezialisierten Untersuchungen sehr genau diagnostizieren, ob und in welchem Maß eine kognitive Störung oder ein demenzielles Syndrom vorliegt. Was wir aber auch in relevantem Maße finden, sind kognitive Defizite im Rahmen von depressiven Störungen. Das ist ganz entscheidend für die weitere Therapie. Ohne die Spezialdiagnostik könnten wir in einigen Fällen nicht differenzieren, ob eine Depression vorliegt, die kognitive Defizite verursacht, oder ob eine beginnende chronisch neurodegenerative Erkrankung vorliegt – welche von einer Depression begleitet wird. Das sind völlig unterschiedliche Erkrankungen, die mit vollkommen anderen Therapieoptionen verbunden sind.
Unsere Patienten profitieren durch die Teilnahme an klinischen Studien, selbst dann, wenn die Testmedikamente nicht die gewünschte Wirkung zeigen. Aufklärung und Zuwendung helfen, dass der Krankheitsverlauf günstig beeinflusst wird. Hinzu kommt, dass durch vielfältige Laboruntersuchungen auch andere Erkrankungen, zum Beispiel Kreislauf- oder Krebserkrankungen frühzeitig erkannt werden.
Über welche Möglichkeiten der Behandlung von Alzheimer verfügen Sie?
Je nach Schweregrad bieten wir zunächst eine Behandlung auf Rezept an. Es gibt zugelassene Antidementiva, die den Krankheitsverlauf im Mittel um ein halbes und bis zu einem Jahr verzögern können. Sie tragen dazu bei, die kognitive Leistungsfähigkeit und die alltagspraktischen Fähigkeiten zu verbessern. Obwohl diese Medikamente Nebenwirkungen haben und den Krankheitsprozess nicht ursächlich beeinflussen, raten wir den Patienten dazu, diesen Aufschub zu nutzen.
Darüber hinaus sind unsere medikamentösen Behandlungsoptionen begrenzt. Wir würden uns Medikamente wünschen, die die Symptome besser beeinflussen können. Vor allem aber würden wir uns Medikamente wünschen, die die Ursache und das Fortschreiten der Alzheimererkrankung wirksam bekämpfen können. Sie zu finden, ist Gegenstand von klinischen Studien, die wir hier in Buch durchführen.
Wie viele Patienten kommen in Ihre Sprechstunde?
Wir haben im Moment hier am Standort vier Erstuntersuchungen pro Woche, also fast 200 Patienten pro Jahr. Dazu kommen derzeit vierzig Patienten, die wir regelmäßig, in circa vierwöchigem Abstand in unseren klinischen Studien betreuen.
Welche Fortschritte erwarten Sie in den kommenden 10 bis 15 Jahren?
Wir kennen eine Reihe pathologischer Vorgänge von chronisch neurodegenerativen Erkrankungen, besonders von Morbus Alzheimer. Bis heute ist es nicht gelungen, durch die Behandlung einzelner pathologischer Phänomene eine Wirkung auf das Ganze zu entfalten. Unser Ziel ist es, noch frühere Krankheitsstadien zu identifizieren und mit therapeutischen Versuchen dort anzusetzen, wo die Krankheit ursächlich beeinflusst wird. Alles deutet darauf hin, dass wir nur mit einer Kombinationstherapie weiter kommen. In zehn Jahren kann ich mir einen substanziellen Fortschritt sehr gut vorstellen, da wir sehr gute Chancen haben, neue Mechanismen zu entdecken. Auf der anderen Seite muss man ganz klar feststellen: Wir können es nicht sicher zusagen, weil die Erkrankung 15 Jahre ohne Symptome bleibt und der Nachweis einer wirkungsvollen Intervention entsprechend lange dauert. Wenn ich heute von einer Hoffnung ausgehe, dass wir in zehn Jahren ein neues Medikament oder eine Kombinationstherapie haben, dann müssten wir dieses binnen der nächsten zwei bis drei Jahre finden. Wir hätten dann fünf Jahre Zeit, um eine klinische Studie durchzuführen und zwei Jahre, um die Substanz an den Markt zu bringen. Somit ist klar, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben.
Interview: Christine Minkewitz
\nFoto: PD Dr. med. Oliver Peters (Foto: privat)
forschen, leben, erkunden, bilden / 04.06.2015
Biotechnologie live“ bei der Langen Nacht der Wissenschaften
Biotechnikum
Ob Medikamente, Kunststoffe, Waschmittel oder Käse: Produkte der Biotechnologie begegnen uns fast überall im Alltag. Ganz selbstverständlich nutzen wir sie – meist ohne zu ahnen, dass oft jahrelange wissenschaftliche Arbeit und nicht selten auch bahnbrechende Entdeckungen dahinterstecken. Wer wissen will, was man unter Biotechnologie überhaupt versteht, in welchen Branchen dieser Forschungsbereich eine wichtige Rolle spielt und in welchen Produkten und Anwendungen die Technik zum Einsatz kommt, kann sich am Samstag, 13. Juni 2015, bei der Langen Nacht der Wissenschaften in Berlin informieren.
Denn dann steht das mobile Labor der Initiative „BIOTechnikum: Erlebnis Forschung – Gesundheit, Ernährung, Umwelt“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) allen Neu- und Wissbegierigen offen. Standort ist das Freigelände des Campus Berlin-Buch vor dem Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (Gebäude C81, Robert-Rössle-Straße 10, erreichbar via S2 bis S-Bahnhof Buch und anschließenden Bus-Shuttles). Anschaulich und interaktiv erfahren Besucherinnen und Besucher im Inneren des auffälligen Ausstellungsfahrzeugs, wie groß die Bedeutung der Lebenswissenschaften schon heute ist, welche Chancen die Forschung für die Zukunft verspricht und wo sich insbesondere für Jugendliche interessante Karrierewege auftun.
Wissen zum Mitnehmen: Die Offene Tür im BIOTechnikum
Interessierte Forschernaturen sind während der „Offenen Tür“ von 16.00 bis 23.00 Uhr eingeladen, sich im BIOTechnikum über Themen wie Gesundheitsforschung, Gesundheitswirtschaft und Bioökonomie zu informieren. Die begleitenden Wissenschaftler Dr. Anne Wiekenberg und Dr. Tim Fechtner führen dabei gerne durch die Ausstellung und stehen für Gespräche bereit. Bei dieser Gelegenheit beantworten die beiden Diplom-Biologen auch individuelle Fragen rund um diese vielseitigen Forschungs- und Anwendungsgebiete.
Informationen zum Programm und zu den Tickets zur Langen Nacht der Wissenschaften finden Sie unter: www.langenachtderwissenschaften.de
Foto: Im Mittelpunkt der BMBF-Initiative „BIOTechnikum: Erlebnis Forschung – Gesundheit, Ernährung, Umwelt“ steht die mobile Erlebniswelt BIOTechnikum: ein doppelstöckiger Truck, der Raum eröffnet für Wissenschaft zum Anfassen und den Dialog über die Biotechnologie. © Initiative „BIOTechnikum: Erlebnis Forschung – Gesundheit, Ernährung, Umwelt“
Quelle: FLAD & FLAD Communication GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
forschen / 02.06.2015
Georg Forster-Forschungsstipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung für Immunologin aus Mexiko – Zusammenarbeit mit dem MDC
Dr. García-Gómez studierte Biologie an der Universidad Autónoma de Mexico (UNAM) in Mexiko-Stadt. Von 1996 - 2000 machte sie ihren Bachelor in Immunologie an der Universität Stockholm, Schweden. Danach kehrte sie nach Mexiko zurück und promovierte 2009 an der UNAM-Universität. Anschließend ging sie an das Mexikanische Institut für Kardiologie, wo sie heute noch forscht. Von September 2012 - Dezember 2014 war sie Gastwissenschaftlerin am William Harvey Institute der Queen Mary University, London, England sowie am MDC bei Prof. Bader.
Foto: Von Mexiko-Stadt nach Berlin (Photo: Uwe Eising/Copyright: MDC)
heilen / 02.06.2015
Herzlich Willkommen: Kindertag im Kreißsaal
Marlene kam um 1.20 Uhr zur Welt und wog bei der Größe von 50 Zentimetern 3.020 Gramm. Malou war um 4.22 Uhr mit 45 Zentimetern und 2.550 Gramm im Quartett bis zum frühen Nachmittag die Leichteste. Um 4.44 Uhr kam Aaliyah: 3.090 Gramm bei 51 Zentimetern. Die kleine Mila wird an diesem Internationalen Kindertag um 13.13 Uhr geboren und schafft es bei 48 Zentimetern auf 3.255 Gramm. Gegen 14.30 Uhr wird ein Zwillingspärchen per Kaiserschnitt geboren und am Abend noch ein Mädchen.\n
„Heute war für mich und mein Team mit der Betreuung von 6 Geburten eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag. Aber wie jeder Moment an jedem Tag in der Geburtshilfe war er für alle hier wie immer auch etwas Besonderes“, meint Susann Knöfel, leitende Hebamme im Klinikum. Sie ist bereits seit 30 Jahren in diesem Beruf tätig und selbst Mutter von drei Kindern, die natürlich alle in Berlin-Buch zur Welt kamen. Und sie ist stolz auf Ihr Team, das sie seit Anfang des Jahres leitet und das jeden 1., 2. und 3. Dienstag im Monat um 17.30 Uhr Informationsabende für alle Interessierten durchführt.
Dr. Sebastian Heumüller, Geschäftsführer des HELIOS Klinikums Berlin-Buch, sagt: „Über das große Vertrauen der werdenden Eltern in die Kompetenz unserer Geburtshilfe freue ich mich sehr. Ich wünsche den Kindern und ihren Familien weiterhin alles Gute“, und ergänzt: „Ich bedanke mich herzlich beim gesamten Kreißsaal- und Stationsteam, bei den Hebammen, Ärzten, Kranken- und Kinderkrankenschwestern für die engagierte Arbeit.“
Komplettiert wird das Geburtshilfeangebot durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Frühgeborenenstation sowie dem Sozialpädiatrischen Zentrum im Perinatalzentrum Level 1. Es ermöglicht die umfassende Betreuung und Behandlung sowie den nahtlosen Übergang in die ambulante Versorgung u.a. von Neu- und Frühgeborenen. Das ist vor allem für Frauen mit Mehrlings- und Risikoschwangerschaften von großem Vorteil, da sie und das Kind bzw. die Kinder umfassend und optimal betreut werden.
Klinikkontakt:
HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
Chefarzt und Leiter Brustzentrum: Prof. Dr. med. Michael Untch
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Chefarzt und Leiter Perinatalzentrum: Prof. Dr. med. Lothar Schweigerer
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
Geburtsanmeldung:
Tel. (030) 94 01-533 45
Bildunterschrift:
Foto: (v.l.n.r) Vier der 25 Bucher Hebammen und „Ihre“ Babys: Konstanze Lindt (43), seit 20 Jahren Hebamme, mit Malou; Anke Reichardt (50), seit 30 Jahren Hebamme, mit Mila; Susann Knöfel (49), seit 30 Jahren Hebamme, mit Marlene; Birgit Wittig (52) seit 30 Jahren Hebamme, mit Aaliyah. (Foto: HELIOS/Thomas Oberländer)
forschen, produzieren, leben, bilden / 02.06.2015
Forscherferien auf dem Campus Buch
Hier ein Blick auf drei ausgewählte Programmpunkte:
20. Juli, ab 8 Jahre
Schnecken checken
Erfahre, was Schnecken so interessant macht! Wie können diese ohne Beine laufen? Und können sie riechen, schmecken, fühlen und sehen? Welche Schnecke ist die Schnellste?
\n
22. Juli, ab 10 Jahre
Die bunte Seite der Chemie
Tauche ein in die faszinierende Farbchemie von heute. Stelle farbige Bilder her, indem du dafür Farben selber herstellst. Färbe einen Beutel zum Mitnehmen. Wie wurde früher gefärbt?
\n
21. August, 6 bis 8 Jahre
Einszweidrei im Sauseschritt, Läuft die Zeit; wir laufen mit. (v. Goethe)
Jeder hat gleich viel davon, aber die meisten zu wenig. Wie funktioniert das mit der Zeit und warum vergeht diese auch mal gaaaaanz langsam?
Foto: Im Gläsernen Labor können Kinder und Jugendliche anspruchsvolle Experimente durchführen. Für die Ferien entwickelt das Team jeweils neue, spannende Themen und verknüpft Wissensdurst mit Freizeitvergnügen. (Foto: Peter Himsel/BBB Management GmbH)
produzieren / 01.06.2015
Die Luft ist rein: Hochspezielle Laboranlagen der LAMSYSTEMS GmbH
Die Zusammenarbeit mit der Grundlagenforschung - ein traditioneller Schwerpunkt des Unternehmens - bestimmte weitgehend die Standortwahl zugunsten der Hauptstadt. „Als führender Wissenschafts- und Technologiepark für medizinische Forschung und Entwicklung freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit LAMSYSTEMS GmbH. Seit unserem ersten Austausch auf der Fachmesse Biotechnica entwickelte sich eine vertrauensvolle Partnerschaft mit hohem Synergiepotenzial. Gerade im Bereich spezieller Laborausstattung bietet der Cluster Berlin-Buch vielfältige Anschlussmöglichkeiten für eines der top innovativen Unternehmen Russlands“, kommentierte der Geschäftsführer der BBB Management Campus Berlin-Buch GmbH, Dr. Ulrich Scheller, die Firmenansiedlung des Unternehmens.
Am 4. Juni 2015 präsentiert LAMSYSTEMS die TÜV zertifizierte mikrobiologische Sicherheitswerkbank der Klasse II den Verantwortlichen für die Bereiche mikrobiologische Sicherheit, Technisches Facility Management und zentrale Dienste des Max-Delbrück-Centrums (MDC).
Am gleichen Tag nimmt der Hersteller an der Veranstaltung des MDC Berlin Summer Meeting 2015 teil, die jährlich internationale Wissenschaftler im Bereich der molekularen Mikrobiologie zum lebendigen Fachaustausch einlädt.
Um potenzielle gemeinsame Projekte mit Forschungseinrichtungen und anderen Innovationsunternehmen auszuloten, besuchen die Vertreter der LAMSYSTEMS GmbH den 22. Innovationstag Mittelstand des BMWi am 11. Juni 2015.
Vom 15. bis 19. Juni 2015 stellt das Unternehmen seine Produkte auf der Internationalen Fachmesse für Prozessindustrie ACHEMA in Frankfurt am Main (Stand D41 Halle 4.2.) vor.
Kontakt:
Campus Berlin-Buch, Robert-Rössle-Str. 10 D 79 (Erwin-Negelein-Haus), 13125 Berlin
Tel.: +49 (0)30 9489 2080
Fax: +49 (0)30 9489 2081
info@lamsys-euro.com
\n\n
Foto: © LAMSYSTEMS GmbH
heilen / 01.06.2015
Einladung zur HELIOS Patientenakademie: „Leber- und Gallenwegserkrankungen“
Eine Erkrankung fällt durch erhöhte Leberwerte oder einen Befund bei einer Ultraschalluntersuchung auf. Neben der Lebererkrankung kann auch eine Erkrankung der Gallenwege – die ja zum größten Teil durch die Leber verlaufen – vorliegen. „Viele Lebererkrankungen sind im Frühstadium gut behandelbar und Spätschäden wie eine Leberzirrhose oder ein Leberzellkarzinom werden vermieden“, sagt Prof. Dr. med. Frank Kolligs, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin, und weiter: „Mit der Patientenakademie möchten mein Team und ich Wissenswertes zur Vorsorge, Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten vermitteln.“
\nAnschließend stehen die Medizinexperten für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung nicht erforderlich.
HELIOS Patientenakademie am Dienstag, 9. Juni 2015, 17.00 bis 18.30 Uhr
\n
„Leber- und Gallenwegserkrankungen“
VORTRAGSTHEMEN
Erhöhte Leberwerte – was nun?
Dr. med. Christine Schürmann, Oberärztin
Was tun, wenn die Galle „verrückt“ spielt? Wissenswertes zu Gallensteinen und Gallenkoliken.
Christof Kurz, Leitender Oberarzt
Ein Knoten in der Leber – was kann dahinter stecken, was muss getan werden?
Prof. Dr. med. Frank Kolligs, Chefarzt
\n
Veranstaltungsort:
\nHELIOS Klinikum Berlin-Buch
Konferenzraum K1-EG
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
Klinikkontakt:
HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Chefarzt: Prof. Dr. med. Frank Kolligs
Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie, Leiter der interdisziplinären Endoskopieabteilung
Telefon: (030) 94 01-526 00
E-Mail: frank.kolligs@helios-kliniken.de
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
\n
Foto: Chefarzt Prof. Dr. med. Frank Kolligs (2.v.re.) mit seinen Oberärzten der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie (HELIOS/Thomas Oberländer)
forschen, leben / 29.05.2015
Gedenktafel für Professor Friedrich Jung in Berlin-Buch eingeweiht
Der Text der Gedenktafel lautet:
Friedrich Karl Jung, 1915-1997, Arzt, Pharmakologe, Gesundheits- und Arzneimittelpolitiker, Mitbegründer der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin, wohnte hier von 1949-1997 und begründete am Akademieinstitut für Medizin und Biologie in Berlin-Buch die extrauniversitäre Pharmakologie und baute die im 2. Weltkrieg zerstörte Pharmakologie der Humboldt-Universität wieder auf.
An der Veranstaltung nahmen etwa 40 Personen teil, darunter Verwandte, Freunde und Bekannte von Friedrich Jung, Mitglieder der Leibniz-Sozietät zu Berlin, Wissenschaftler aus Berlin-Buch und der Charité sowie ehemalige Doktoranden und Studenten von Friedrich Jung. Besonders herzlich wurde Professor Werner Scheler begrüßt, Präsident der Akademie der Wissenschaften der DDR von 1979 bis 1990, der es sich trotz seiner 91 Jahre nicht nehmen ließ, an dieser Ehrung seines Lehrers teilzunehmen. Die offizielle Ehrung von Professor Friedrich Jung aus Anlass seines 100. Geburtstages erfolgte in einem Ehrenkolloquium der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin am 12. März.
Herr Banse würdigte in seiner Ansprache die Leistungen von Friedrich Jung als Arzt, Wissenschaftler und Politiker über mehrere Jahrzehnte. Jung wirkte unter anderem von 1949 bis 1972 als Professor an der Medizinischen Fakultät (Charité) der Humboldt-Universität zu Berlin und von 1956 bis 1980 als Direktor verschiedener Forschungsinstitute der Akademie der Wissenschaften der DDR, darunter von 1972 bis 1980 des Zentralinstituts für Molekularbiologie in Berlin-Buch.
In drei kurzen Ansprachen, gehalten von Professor Volker Haucke, Direktor des Leibniz-Instituts für Molekulare Pharmakologie (FMP), Professorin Jewgenow, stellvertretende Direktorin des Leibniz-Institutes für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) Berlin, und Professor Peter Oehme, Gründungsdirektor des ehemaligen Akademieinstitutes für Wirkstoffforschung Berlin, wurde das Wirken und Leben von Professor Jung dargestellt. Volker Haucke verwies auf die Forschungen am FMP zu den molekularen Ursachen von Krankheiten und der Suche nach Wirkstoffen für die Grundlagen der Medizin der Zukunft, wobei die Wurzeln des FMP bis hin zu Friedrich Jung reichen. Katarina Jewgenow sagte in sehr persönlichen Worten, dass ihr Vater sicherlich seine Freude gehabt hätte; erstens an der Entwicklung des Wissenschafts-Standortes Berlin-Buch, zweitens an der symmetrischen Anordnung der Gedenktafel zu der für Professor Nikolai Wladimirovich Timoféeff-Ressovsky, einem hervorragenden russischen Wissenschaftler, der von 1931 bis 1945 am Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung in Berlin-Buch arbeitete und die Grundlagen der modernen Genetik schuf, und drittens an den jungen Wissenschaftlern, die täglich durch das Tor zu ihrer Arbeit gehen und symbolisch Ideen und Anregungen mitnehmen. Friedrich Jung wohnte damals im Torhaus und sein Arbeitszimmer befand sich in der heute wieder geöffneten Durchfahrt.
Im Namen der Schüler von Professor Jung richtete Herr Oehme Dankesworte an die BBB Management GmbH Campus Berlin-Buch, insbesondere an Herrn Dr. Ulrich Scheller, das Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie, die Stiftung der Freunde der Leibniz-Sozietät, die Familie Jung und die Leibniz-Sozietät, die zusammen die Würdigung der Leistungen von Professor Jung an historischer Stelle ermöglichten.\n
Quelle: Johann Gross
Foto: Vor der Gedenktafel im Torhaus (v.l.n.r.): Dr. Ulrich Scheller, Prof. Dr. Volker Haucke, Prof. Dr. Katarina Jewgenow, Prof. Peter Oehme und Prof. Banse (Foto: BBB Management GmbH Campus Berlin-Buch)
leben, heilen / 27.05.2015
Kinder, Kunst und Medizin
In Anwesenheit der kleinen Künstler eröffnete Klinikgeschäftsführer Dr. Sebastian Heumüller gemeinsam mit Prof. Dr. med. Henning Baberg, Chefarzt der Klinik und Poliklinik für Kardiologie und Nephrologie, die neue Ausstellung im Foyer des HELIOS Klinikums Berlin-Buch. „Es freut mich, dass wir diese farbenfrohen Bilder nun einer breiten Öffentlichkeit zeigen können. Ich bedanke mich bei allen, die solche Projekte ermöglichen“, sagt Dr. Heumüller.\n
Entstanden waren die Bilder Anfang des Schuljahres gemeinsam mit den Lehrerinnen Annegret Schansker und Annika Steinhöfel in der Evangelischen Schule Frohnau. Initiator ist Dr. Helmut Hoffmann, vor seiner Pensionierung stellvertretender Leiter des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes in Berlin-Reinickendorf. Der Arzt und Diplompädagoge arbeitet seit 1995 mit Kindern und Jugendlichen, um ihnen auf künstlerische Weise medizinisches Wissen über die Funktionsweise des Körpers zu vermitteln.
\nIm Anschluss an die Ausstellungseröffnung besuchten die 21 Sechstklässler kardiologische Diagnostikbereiche im Bucher Klinikum. Das Team vom Kardio-MRT und Herz-Ultraschall demonstrierte moderne Medizintechnik und beantwortete alle neugierigen Fragen der Kinder. „Es war spannend zu hören, was die Kinder nach diesem Projekt alles über die Herzfunktion wissen“, ergänzt Prof. Dr. med. Henning Baberg. Sichtlich beeindruckt von den diagnostischen Möglichkeiten, mit neuem Wissen und unter dem Motto „Denken macht hungrig“ ließen die 21 Schüler der Klasse 6 gemeinsam mit den Lehrerinnen und Dr. Hofmann den Projekttag beim Mittagessen in der Cafeteria ausklingen.
Klinikkontakt:
HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Klinik für Kardiologie und Nephrologie
Chefarzt: Prof. Dr. med. Henning Baberg
E-Mail: henning.baberg@helios-kliniken.de
Tel. (030) 94 01-529 00
Foto: Grundschüler der Evangelischen Schule Frohnau mit Projektleiter Dr. Helmut Hoffmann und den Lehrerinnen Annegret Schansker und Annika Steinhöfel sowie Chefarzt Prof. Henning Baberg und Klinikgeschäftsführer Dr. Sebastian Heumüller im Foyer HELIOS Klinikum Berlin-Buch (v.l.) (HELIOS/Thomas Oberländer)
forschen / 26.05.2015
Eine Bremse gegen epileptische Anfälle in Nervenzellen
Mit jedem elektrischen Impuls schüttet eine Nervenzelle Neurotransmitter in den synaptischen Spalt aus und trägt so das Signal weiter. Sie hält dafür einen Vorrat an Neurotransmittern bereit, die in winzige Membranbläschen (Vesikel) verpackt sind und auf Kommando mit der äußeren Membran verschmelzen. Um aber Sinneswahrnehmungen und kognitive Vorgänge in ihrer ganzen Bandbreite zu ermöglichen, werden die einzelnen Nervenzellen von Hunderten Stromstößen pro Sekunde durchpulst. Sie müssen daher nicht nur in hohem Tempo Neutransmitter ausschütten, sondern die Vesikel auch genauso schnell wieder recyceln. Wie dieser Vorgang so unglaublich schnell und präzise gelingt, wird von Neurowissenschaftlern und Zellbiologen seit Jahren intensiv erforscht.
Die Gruppe um Volker Haucke fand nun heraus, dass Wirbeltiere im Lauf der Evolution dafür ein Recyclingsystem entwickelt haben, bei dem unabhängig voneinander funktionierende Proteine den lebenswichtigen Prozess absichern. Die Wissenschaftler entwickelten dafür verschiedene Mausmodelle, denen die Sortierproteine (Stonin2 und SV2A/B) fehlten. Erst als alle drei Proteine ausgefallen waren, funktionierte das Recycling nur noch sehr eingeschränkt und Nervenreize wurden nur stark abgeschwächt weitergeleitet. Die Mäuse hatten motorische Störungen und epileptische Anfälle, weil die Funktion der häufig feuernden hemmenden Synapsen durch das gestörte Recycling besonders stark beeinträchtigt wird und damit die "Bremse" im Nervensystem verloren geht, die im gesunden Tier und auch beim Menschen epileptische Anfälle verhindert.
„Selbst geringe Störungen in der Signalübertragung können zu einem Ungleichgewicht im Gehirn und damit zu neurologischen Störungen führen“, erklärt die Erstautorin Natalie Kaempf. Mit der doppelten Sicherung könnten die Nervenzellen sich dagegen absichern. Eines der in der Arbeit untersuchten Proteine (SV2A) ist auch der Angriffspunkt für ein bekanntes Epilepsie-Medikament, dessen Wirkmechanismus bislang noch kaum verstanden ist. Eine andere Arbeit weist zudem darauf hin, dass es auch an der Entstehung der Alzheimer-Erkrankung beteiligt ist. Die Erforschung des Vesikel-Recyclings könnte somit helfen, die Entstehung neurologischer Erkrankungen besser zu verstehen.
Kaempf, N., Kochlamazashvili, G., Puchkov, D., Maritzen, T., Bajjalieh, S.
M., Kononenko, N. L. and Haucke, V. (2015) Overlapping functions of stonin
2 and SV2 in sorting of the calcium sensor synaptotagmin 1 to synaptic vesicles. Proc Natl Acad Sci, MS# 2015-01627R
Das Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) gehört zum Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB), einem Zusammenschluss von acht natur-, lebens- und umweltwissenschaftlichen Instituten in Berlin. In ihnen arbeiten mehr als 1.500 Mitarbeiter. Die vielfach ausgezeichneten Einrichtungen sind Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft. Entstanden ist der Forschungsverbund 1992 in einer einzigartigen historischen Situation aus der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR.
Text: Birgit Herden
Abbildung: Die Synapse ist die Verbindung zwischen zwei Nervenzellen und beinhaltet Vesikel gefüllt mit Neurotransmittern, die essentiell für die Signalweitergabe sind. Sie verschmelzen schnell mit der Zelloberfläche, entlassen die Neurotransmitter und müssen schnell und präzise recycelt werden, um ein Ungleichgewicht und neurologische Störungen zu verhindern.
produzieren / 26.05.2015
Wirkstoff mit Potenzial
Derzeit leiden allein in der EU fünf bis zehn Millionen Menschen unter Vorhofflimmern, der häufigsten Form einer Herzrhythmusstörung. Die Zahl der Betroffenen wird durch die alternde Gesellschaft jährlich steigen. Entsprechend hoch ist der medizinische Bedarf an einem wirksamen Medikament – und damit auch dessen kommerzielles Potenzial. Jetzt hat sich ein Investorensyndikat mit 5,7 Millionen Euro an OMEICOS beteiligt und damit die präklinische Entwicklung des Wirkstoffs gesichert. „Mit dieser Finanzierung können wir in den nächsten zwei Jahren fokussiert an der Entwicklung der Substanz arbeiten“, so COO Dr. Karen Uhlmann.
Aus der Grundlagenforschung in die medizinische Anwendung
Der Ansatz für den neuen Wirkstoff ist aus einer systematisch vergleichenden Forschung am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) entstanden: „Seit mehr als zehn Jahren erforschen wir Enzyme aus der Cytochrom-P450-Familie, die Fettsäuren zu biologisch aktiven Verbindungen umsetzen können. Dabei sind wir auf ein unbekanntes Stoffwechselprodukt von Omega-3-Fettsäuren gestoßen“, so Arbeitsgruppenleiter Dr. Wolf-Hagen Schunck. „Ausgehend von der theoretischen Feststellung, dass dort ein neuartiges Molekül entsteht, haben wir uns gefragt, ob dieses Stoffwechselprodukt, Metabolit genannt, für die besondere herzschützende Wirkung von Omega-3-Fettsäuren verantwortlich sein könnte. In der Zellkultur konnten wir dann beobachten, dass diese natürliche Verbindung die Kontraktionsfähigkeit von Herzzellen positiv beeinflusst.“ Dr. Robert Fischer, spezialisiert auf die Behandlung von Herzrhythmusstörungen, regte an, den neuen Wirkmechanismus für die Behandlung von Vorhofflimmern einzusetzen.
Die nächsten dafür notwendigen Schritte konnten die Entdecker dank der PreGoBio Förderung vom MDC gehen. „Insbesondere hat uns diese Förderung ermöglicht, in Kooperation mit Dr. John Russel Falck vom Medical Center der University of Texas Southwestern synthetische Moleküle mit vergleichbarer chemischer Struktur und Funktion zu entwickeln. Die ‚Kopie‘ der natürlichen Metaboliten ist ein notwendiger Schritt, da die natürlichen Moleküle als Basis für ein Medikament nicht geeignet sind. Nach zahlreichen Versuchen erhielten wir schließlich einen zuverlässig stabilen Wirkstoff“, erklärt Wolf-Hagen Schunck. „Wir konnten zeigen, dass dieser Wirkstoff Rhythmusstörungen in erkrankten Herzen signifikant reduziert. Somit hatten wir einen hervorragenden Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Medikaments“, so Dr. Fischer.
Spin-off des Max-Delbrück-Centrums
Um den Wirkstoff bis zur klinischen Anwendung zu entwickeln, hat das Team im Juni 2013 OMEICOS Therapeutics als Spin-off des MDC auf dem Biotech-Campus Berlin-Buch gegründet. In der Vorgründungsphase fanden die Gründer Unterstützung durch Technologietransfer-Manager des MDC und der Ascenion GmbH und konnten Mittel der Ausgründungsförderung der Helmholtz-Gemeinschaft (Helmholtz-Enterprise) einwerben. Durch die Beteiligung des High-Tech Gründerfonds und eine ProFIT-Förderung des Landes Berlin startete OMEICOS schließlich mit einem Kapital von 500.000 Euro.
Auf dem Campus kooperiert OMEICOS weiterhin eng mit den Arbeitsgruppen der Mitgründer Dr. Wolf-Hagen Schunck (MDC) und Dr. Dominik N. Müller (ECRC). Mit dem Biotech-Unternehmen Lipidomix wurde eine Diagnostik für die Metaboliten entwickelt. „Der Austausch mit Campus-Unternehmen ist sehr hilfreich. Dank der räumlichen Nähe lässt sich vieles im persönlichen Dialog schneller und tiefgehender klären“, so Dr. Uhlmann. „Hervorzuheben ist auch die flexible Unterstützung der BBB
Management GmbH.“
Foto: Gründerteam (v.l.n.r.): Dr. Wolf-Hagen Schunck, Dr. med. Robert Fischer, Dr. Karen Uhlmann und Dr. Dominik N. Müller\n
Text und Foto: Christine Minkewitz
\n
leben, heilen / 20.05.2015
IQM-Qualitätsergebnisse für Evangelische Lungenklinik veröffentlicht
Ab heute sind die Qualitätsergebnisse von sechs Krankenhäusern der Paul Gerhardt Diakonie auf der Webseite verfügbar. Die Evangelische Elisabeth Klinik, die Evangelische Lungenklinik Berlin, das Evangelische Krankenhaus Hubertus, das Martin-Luther-Krankenhaus, das Evangelische Waldkrankenhaus Spandau sowie das Evangelische Krankenhaus Paul Gerhardt Stift Wittenberg stellen ihre aus Routinedaten berechneten Qualitätsergebnisse für alle relevanten Krankheitsbilder des Hauses dar.
Die Ergebnisse der sechs Krankenhäuser stammen aus der IQM-Gruppenauswertung von 327 Kliniken in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich der Initiative Qualitätsmedizin (IQM) angeschlossen haben. Insgesamt umfasst der IQM-Indikatorensatz 252 Qualitätskennzahlen für 50 relevante Krankheitsbilder und Behandlungsverfahren.
Die Paul Gerhardt Diakonie nutzt das IQM-Verfahren für ihr aktives Qualitätsmanagement, das durch die Optimierung der Behandlungsprozesse und -ergebnisse zu besserer Behandlungsqualität und mehr Patientensicherheit führt.
Zu den IQM-Qualitätsergebnissen:
Evangelische Elisabeth Klinik
Evangelische Lungenklinik Berlin
Evangelisches Krankenhaus Hubertus
Martin-Luther-Krankenhaus
Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau
Evangelisches Krankenhaus Paul Gerhardt Stift Wittenberg
Die Initiative Qualitätsmedizin (IQM)
Führende Krankenhausträger haben sich 2008 zur „Initiative Qualitätsmedizin“ (IQM) zusammengeschlossen. Die trägerübergreifende Initiative mit Sitz in Berlin ist offen für alle Krankenhäuser aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Vorhandenes Verbesserungspotenzial in der Medizin sichtbar zu machen und zum Wohle der Patienten durch aktives Fehlermanagement zu heben, ist das Ziel von IQM. Dafür stellt IQM den medizinischen Fachexperten aus den teilnehmenden Krankenhäusern innovative und anwenderfreundliche Instrumente zur Verfügung. Die Mitglieder der Initiative verpflichten sich drei Grundsätze anzuwenden: Qualitätsmessung mit Routinedaten, Veröffentlichung der Ergebnisse und die Durchführung von Peer Review Verfahren. In derzeit 327 Krankenhäusern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz versorgen die IQM-Mitglieder jährlich rund 5 Mio. Patienten stationär. In Deutschland liegt ihr Anteil an der stationären Versorgung bei rund 22 %, in Österreich bei 13 % und in der Schweiz bei ca. 19 %.
Kontakt:
IQM Initiative Qualitätsmedizin e.V.
Friedrichstraße 166
D-10117 Berlin
www.initiative-qualitaetsmedizin.de
forschen / 20.05.2015
BIH fördert Transferprojekte zu neuen Wirkstoffen und Diagnosemethoden
Der Weg von der Grundlagenforschung zum wirksamen Medikament ist oft lang – und kostenintensiv. Hier setzt der BIH-Technologietransferfonds Pharma an: Vielversprechende BIH-Forschungsvorhaben werden gefördert, die ein kommerzielles oder klinisches Innovationspotenzial haben und bei denen Belege für eine wirtschaftliche Verwertung noch fehlen. Die Förderung der vier Projekte, die jetzt ausgewählt wurden, soll einer entsprechenden Validierung dienen.
In jeweils einem Projekt entwickeln BIH-Forscherinnen und -Forscher neue Wirkstoffe, die zur Behandlung von Krebs und Alzheimer eingesetzt werden könnten. Erich Wanker (Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin, MDC) wird bei der Suche nach einem Wirkstoff im Kampf gegen Alzheimer unterstützt. Der Wirkstoff zum Einsatz gegen Krebs, an dem Claus Scheidereit (MDC) in seinem vom BIH geförderten Projekt arbeitet, soll insbesondere dabei helfen, die Wirksamkeit von Chemo- und Bestrahlungstherapien zu verbessern. Diese Therapien aktivieren bestimmte zelluläre Signalwege, was im Rahmen der Krebsbehandlung unerwünscht ist, da dies den erwünschten Zelltod verhindert. Ziel ist es, weitere Wirkstoffkandidaten zu charakterisieren, die diese Signalwege selektiv blockieren können.
Zwei weitere Projekte, die mit dieser auf den Transfer wissenschaftlicher Innovationen in anwendbare Medizinprodukte ausgerichteten Förderlinie unterstützt werden, zielen auf neue Diagnosemethoden ab und beschäftigen sich mit Wegen, zirkulären RNAs sowie Autoantikörpern bei chronischer Herzmuskelschwäche auf die Spur zu kommen.
Zirkuläre RNAs sind u. a. an der Regulation der Genexpression beteiligt. Über das medizinische Potenzial von zirkulären RNAs gibt es zurzeit noch wenig Wissen; möglich wäre, sie als diagnostische Biomarker bei der Detektion verschiedener Krankheiten zu nutzen. So wird auch das vom BIH geförderte Projekt unter der Leitung von Nikolaus Rajewsky und Sebastian Memczak (MDC) eine mögliche diagnostische Anwendung von zirkulären RNAs testen. Autoantikörper werden bei Autoimmunerkrankungen gebildet. Bindet ein Autoantikörper an einen Rezeptor einer Zelle, kann dieser dauerhaft aktiviert und die Zelle – zum Beispiel eine Muskelzelle – auf lange Sicht geschädigt werden. Beim Herzmuskel führt dies zu einer dauerhaft reduzierten Herzfunktion. Lutz Schomburg (Charité) sucht in seinem geförderten Projekt nach Wegen, um diese Autoantikörper spezifisch nachzuweisen und dadurch die Diagnostik und Therapie zu verbessern.
Die vier vom BIH-Technologietransferfonds Pharma 2015 geförderten Projekte wurden Ende April 2015 von einer externen Expertenkommission in Rahmen eines zweistufigen Verfahrens ausgewählt. Das Ziel dieser Fördermaßnahme: dazu beizutragen, dass Ergebnisse der translational und systemmedizinisch orientierten Forschung des BIH schneller in diagnostische und therapeutische Methoden überführt werden können. Antragsberechtigt waren Forscherinnen und Forscher der Charité - Universitätsmedizin Berlin und des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin (MDC).
Über das Berliner Institut für Gesundheitsforschung I Berlin Institute of Health (BIH)
Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung|Berlin Institute of Health (BIH) wurde 2013 gegründet. Es ist ein Zusammenschluss der Charité - Universitätsmedizin Berlin und des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin (MDC) mit dem Ziel, translationale Medizin basierend auf einem systemmedizinischen Ansatz voranzubringen und durch die beschleunigte Übertragung von Forschungserkenntnissen in die Klinik sowie die Rückkoppelung klinischer Befunde in die Grundlagenforschung. Seit April 2015 ist das BIH selbstständige Körperschaft des öffentlichen Rechts, Charité und MDC sind darin eigenständige Gliedkörperschaften. Das Institut wird mit neuen wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen in der Biomedizin neue diagnostische, therapeutische und präventive Ansätze in der Medizin und damit für die Gesundheit der Menschen schaffen.
investieren, produzieren / 19.05.2015
IPSEN erwirbt sämtliche Anteile an Octreopharm Sciences GmbH
EZR besitzt rund ein Drittel der Anteile der OPS und würde beim Inkrafttreten des Vertrages einen Sonderertrag aus Anteilsverkäufen erzielen. Genauere Angaben zur Gewinnauswirkung wird Eckert & Ziegler spätestens in ihrem Quartalsbericht nach dem Inkrafttreten der Vereinbarung veröffentlichen.
“Unser Einstieg bei OPS vor drei Jahren zielte darauf ab, das Unternehmen zu stabilisieren und EZR als Partner für die Lohnmarkierung von Radiopharmazeutika zu positionieren“, erklärte Dr. André Heß, Mitglied des Vorstands der Eckert & Ziegler AG und verantwortlich für das Segment Radiopharma. „Nachdem OPS sich gut entwickelt hat, freuen wir uns, die Verantwortung für das Unternehmen an einen Partner zu übergeben, der über eine hervorragende Expertise im Bereich neuroendokriner Tumore (NET) verfügt. Da das Vertragspaket eine Vereinbarung über eine langfristige strategische Zusammenarbeit zwischen dem Käufer und EZR enthält, wird EZR weiterhin eine wesentliche Rolle als Zulieferer und Lohnmarkierer spielen“.
OPS konzentriert sich auf die klinische Entwicklung von neuen Medikamenten gegen neuroendokrine Tumore und konnte vor Kurzem erfolgreiche klinische Zwischenergebnisse für seinen Entwicklungskandidaten OPS202 vermelden. Das Unternehmen wurde 2009 von Branchenkennern in Süddeutschland gegründet, zog aufgrund der Nähe zu nuklearmedizinischen Industriepartnern allerdings 2011 nach Berlin. Hier konnte es seine erste Finanzierungsrunde weitgehend mit öffentlichen Geldern schließen. Als privater Spiegelgeldgeber für den VC Fonds Technologie Berlin (IBB Beteiligungsgesellschaft) und als Leitinvestor für die KfW Mittelstandsbank fungierte dabei der Pankower Frühphasenfinanzierer ELSA Eckert Life Science Accelerator. In einer weiteren Finanzierungsrunde beteiligten sich die chinesische Shaanxi Xinyida Invstment Co. Ltd. und die Eckert & Ziegler AG an dem Unternehmen.
Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:
Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations
Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de
leben / 19.05.2015
Albert Schweitzer Stiftung: Ambulanter Pflegedienst mit hoher Kundenzufriedenheit
wurde der Ambulante Pflegedienst der Albert Schweitzer Stiftung – Wohnen & Betreuen mit der
Gesamtnote 1,1 ausgezeichnet. Zusätzlich kann sich der Pflegedienstleister über eine glatte 1,0 bei
der Kundenzufriedenheit freuen. Diese erheben die Prüfer des MDK in Vieraugengesprächen mit den
Kunden, und sie fließt nicht in die Gesamtnote mit ein. „Dieses Ergebnis gefällt uns natürlich ganz
besonders, denn es zeigt, dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind und spornt uns
weiter an“, so Fachbereichsleiterin Ilona Kolbe begeistert.\n
In Zukunft möchte der Ambulante Pflegedienst der Albert Schweitzer Stiftung – Wohnen & Betreuen
seinen Personalbestand und seine individuellen Angebote weiter ausbauen. So sollen neben den
bisherigen Pflegeangeboten auch zusätzliche Betreuungsleistungen wie Begleitdienste und
hauswirtschaftsnahe Tätigkeiten angeboten werden.
Kontakt:
Ambulanter Pflegedienst der Albert Schweitzer Stiftung –Wohnen & Betreuen
Natalia Handke
Tel.: 030.474 77 333
Email: ambulanterpflegedienst@ass-berlin.org
investieren, produzieren, leben / 12.05.2015
Zukunftsort Berlin-Buch auf der Messe „Metropolitan Solutions“
Für die intelligente und nachhaltige Stadt der Zukunft
Die Metropolitan Solutions diskutiert und präsentiert Strategien und Lösungen für den Auf- und Ausbau urbaner Infrastrukturen. Zu den Kernthemen zählen Energie- und Wasserversorgung, Klimaschutz und Umwelt, Kommunikation und Sicherheit sowie mögliche Wege zur "intelligenten Stadt". Die Messe richtet sich unter anderem an Stadtplaner, Verantwortliche aus Städten und Kommunen, Ingenieure, Investoren und Technologieexperten.
Mit den Berliner Zukunftsorten präsentieren sich städtische Entwicklungsräume mit hohem gewerblichem Wertschöpfungspotenzial, die sich u.a. durch die enge Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft und ein jeweils abgrenzbares Profil auszeichnen. Branchenspezifische Netzwerke, Technologie- und Gründerzentren und Gewerbeflächen bieten Start-ups ausgezeichnete Bedingungen. Moderne Industrie und Zukunftstechnologien sind jedoch nur eine Seite der Standortentwicklung. Zunehmend rückt in den Fokus, die Standorte als integrierte moderne Arbeits-, Wohn- und Freizeitorte zu entwickeln. Intelligente, innovative Stadtentwicklung, die auf Nachhaltigkeit setzt, ist eine der wichtigsten Komponenten für die künftige Attraktivität.
Der gemeinsame Messeauftritt der Zukunftsorte bei der Metropolitan Solutions bildet den Auftakt für eine langfristige und nutzbringende Zusammenarbeit dieser Standorte.
Mehr über den Wissenschafts- und Gesundheitsstandort Berlin-Buch:
www.berlin-buch.com\n
\n
Foto: Hervorragende Kliniken und exzellente biomedizinische Grundlagenforschung haben Tradition in Berlin-Buch. Klar fokussiert auf Biomedizin, bietet der international renommierte Gesundheitsstandort Life-Science-Unternehmen und Forschungseinrichtungen einzigartige Bedingungen für Synergien und wertschöpfende Vernetzung. (Foto: Norbert Michalke)
\n
heilen / 11.05.2015
Erfolgreiche Rezertifizierung: Thoraxzentrum – Kompetenzzentrum für Thoraxchirurgie
Der von der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie erarbeitete Anforderungskatalog für ein „Thoraxzentrum – Kompetenzzentrum für Thoraxchirurgie“ wurde 2008 erstmalig an drei Pilotkliniken in Deutschland, darunter an der Evangelischen Lungenklinik Berlin, evaluiert. Bei der Zertifizierung zum Thoraxzentrum werden an die Fallzahlen der thoraxchirurgischen Abteilungen deutlich höhere Maßstäbe angelegt als bei der Zertifizierung zum Lungenkrebszentrum. Dies geschieht aus dem Grund, dass hierfür alle Erkrankungen, die thoraxchirurgischer Intervention bedürfen, also gutartige Veränderungen (z.B. Pneumothorax, Empyem, Abklärung interstitieller Lungenerkrankungen) ebenso wie Malignome, die nicht in der Lunge entspringen (z.B. Metastasen oder Thymuskarzinome etc.), einbezogen werden und nicht alleine die Operationen und Behandlungsverfahren bei Lungenkrebspatienten beurteilt werden.
Neben der Überprüfung der Strukturqualität (Anzahl und Qualifizierung der Fachärzte für Thoraxchirurgie, ausreichende Verfügbarkeit von OP- und Intensivkapazitäten, Qualifizierung und Fortbildung sowohl der ärztlichen als auch der pflegerischen Mitarbeiter), kommt der Ergebnisqualität mit den Überlebenszeiten oder der Anzahl parenchymsparender Operationen oder der Rate von R0-Resektionen entscheidende Bedeutung bei.
So liegt in der Evangelischen Lungenklinik Berlin die Quote der Pneumonektomien bei den anatomischen Resektionen lediglich bei 4,2 % und damit deutlich geringer als allgemein in der Literatur angegeben (< 25 %). Die R0-Rate im Stadium I bzw. II eines Lungenkarzinoms betragen 98,8 % bzw. 97,6 % (die Anforderungen liegen bei </= 95 %), im Stadium IIIA 90,0 % (Anforderung </= 85 %). In zertifizierten Zentren müssen klinische Studien angeboten werden: Hier wurden im Beobachtungszeitraum 193 Patienten für Studien rekrutiert, für die ein Ethikvotum vorliegt.
Überprüft werden darüber hinaus, ob Handlungsanweisungen (SOPs = Standard Operating Procedures) für wichtige Abläufe (z. B. Therapieplanung, präoperatives Management, Schmerztherapie etc.) bzw. für postoperative Komplikationen (intraoperative Blutungen, postoperative Stumpfinsuffizienz, schwere postoperative Infektionen etc.) vorliegen.
„Sich einer Zertifizierung zu unterziehen, zwingt uns in der Klinik, unsere gewohnten Abläufe kritisch zu überdenken und im Interesse der Patienten an die Forderungen der Fachgesellschaften anzugleichen. Wir sehen Zertifizierungen als wichtiges Element, unsere eigenen Handlungsweisen kritisch zu hinterfragen und uns durch Anregungen von außen stetig weiter zu entwickeln“, so Dr. med. Gunda Leschber, Chefärztin der Klinik für Thoraxchirurgie.
Seit der erstmaligen Zertifizierung der Evangelischen Lungenklinik Berlin zum Lungenkrebszentrum im Jahr 2009 ist die Anzahl der Patienten, die in der Tumorkonferenz vorgestellt werden, so angestiegen, dass mittlerweile viermal wöchentlich eine Tumorkonferenz durchgeführt wird. 2014 wurden mehr als 1.600 Patienten in der Tumorkonferenz vorgestellt und es wurde für sie ein Behandlungskonzept beschlossen.
Bundesweit sind mittlerweile 44 Zentren als „Lungenkrebszentrum“ und 14 Zentren als „Thoraxzentrum – Qualitätszentrum für Thoraxchirurgie“ zertifiziert. Die Evangelische Lungenklinik Berlin ist die einzige Klinik in Deutschland, die diese Auditierung bereits zum dritten Mal erfolgreich bestanden hat.
Weitere Informationen zur Klinik für Thoraxchirurgie:\n
http://www.pgdiakonie.de/evangelische-lungenklinik-berlin/kliniken-einrichtungen/klinik-fuer-thoraxchirurgie/
Über die Evangelische Lungenklinik Berlin
Die Evangelische Lungenklinik Berlin, ein Unternehmen der Paul Gerhardt Diakonie, ist seit ihrer Gründung im Jahr 1952 eine weithin anerkannte Spezialklinik für akute und chronische Erkrankungen der Lunge sowie des Brustkorbs und seiner Organe.
leben, heilen, bilden / 10.05.2015
Neuer Studiengang und neue Berufe: Akademie erweitert Bildungsspektrum
„Wir freuen uns, dass wir die renommierte Landesrettungsschule übernehmen konnten“, so Jens Reinwardt, Geschäftsführer und Leiter der Akademie der Gesundheit. Feuerwehren und Landkreise sind als Träger des Rettungsdienstes neue Bildungspartner der Akademie. Hintergrund ist ein neues Gesetz, welches die Ausbildung bisheriger Rettungsassistenten professionalisiert und im Berufsbild „Notfallsanitäter“ zusammenführt. „Notfallsanitäter erlangen deutlich mehr medizinische Kompetenzen, weshalb das Lehrpersonal akademisch ausgebildet sein muss“, erklärt Jens Reinwardt. Diese Voraussetzung bietet die Akademie der Gesundheit.\n
Bachelor of Science Interdisziplinäre Gesundheitsversorgung
Für Abiturienten hat die Akademie in Kooperation mit der Steinbeis-Hochschule ein ausbildungsintegriertes Studium „Bachelor of Science Interdisziplinäre Gesundheitsversorgung“ etabliert. Damit ist es möglich, in 3,5 Jahren einen Berufsabschluss in den Bereichen Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie, Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege und einen akademischen Grad zu erwerben. An den international anerkannten Bachelor-Abschluss lassen sich ein Masterstudium und die Promotion anschließen.
Wer bereits in den genannten Berufen arbeitet, kann den Bachelor in zweieinhalb Jahren berufsbegleitend erwerben. „Unseren Absolventen erkennen wir einen Teil der Ausbildung für das Studium an“, so Reinwardt. „Wir verzeichnen derzeit ein wachsendes Interesse der Kliniken, ein solches Studium mitzufinanzieren, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein.“
Modularisierung der Ausbildung
Im Bereich Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege bereitet sich die Akademie auf den Übergang zu einem neuen Pflegeberuf vor. Die Ausbildung wird in Module gegliedert. „Der Trend geht zu einer dreijährigen fachübergreifenden Grundausbildung, die Ausgangspunkt für eine weitere Spezialisierung sein wird“, erklärt der Geschäftsführer, „Um mit Europa Schritt zu halten, benötigen wir einen Pflegeberuf mit einer ‚generalistischen’ Ausbildung, die nicht einseitig an Kliniken oder Pflegeheime geknüpft ist.“
Flugsimulationscenter für Ärztefortbildung
Prinzipiell will die Akademie die Fort- und Weiterbildung für Gesundheitsberufe ausbauen. In enger Kooperation mit den Kliniken sind darüber hinaus Fortbildungen für Ärzte geplant. „Unser erstes Vorhaben ist in Flugsimulationscenter in Bad Saarow, in dem die medizinische Notfallrettung im Hubschrauber trainiert werden kann. Die fachliche Leitung wird Prof. Dr. med. Olaf Schedler vom HELIOS Klinikum Bad Saarow übernehmen. Gemeinsam mit der Ärztekammer planen wir auch eine Fortbildung im Bereich Palliative Care“, so Reinwardt.
Bildungzentrum in Vietnam eröffnet
Mit Blick auf die Zukunft hat die Akademie der Gesundheit Ende Februar 2015 ein Vietnamesisch-Deutsches Bildungszentrum in Ho-Chi-Minh-Stadt eröffnet. Dort werden junge Vietnamesen im Pflegeberuf ausgebildet und für den Einsatz in Deutschland vorbereitet. „Wir erleben hoch motivierte, empathische und respektvolle Persönlichkeiten, die den hiesigen Kliniken sehr willkommen sind.“
Text: Christine Minkewitz
heilen / 06.05.2015
HELIOS Klinikum Berlin-Buch erhält das Zertifikat „Klinik für Diabetiker geeignet (DDG)“
An Diabetes erkrankte Patienten, die sich operativ behandeln lassen müssen, benötigen eine besonders auf sie abgestimmte medizinische und pflegerische Betreuung. Dazu gehört beispielsweise, dass der Blutzuckerspiegel bedarfsgerecht überwacht wird und dass die Narkose entsprechend der Diabeteserkrankung abgestimmt ist. Als erstes Krankenhaus der Maximalversorgung in Deutschland erhielt jetzt das HELIOS Klinikum Berlin-Buch diese Auszeichnung der Deutschen Diabetes Gesellschaft. „Die Bestätigung, dass Patienten mit der Diagnose Diabetes bei uns besonders kompetent betreut werden, macht uns sehr stolz“, sagt Dr. Sebastian Heumüller, Klinikgeschäftsführer des Klinikums mit über 1000 Betten, zur offiziellen Übergabe des Zertifikates „Klinik für Diabetiker geeignet (DDG)“ durch den Geschäftsführer der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Dr. Dietrich Garlichs, am 29. April 2015.
„Bei einem Klinikaufenthalt ist es von größter Bedeutung, bei jedem Patienten Begleiterkrankungen und Risikofaktoren zu diagnostizieren“, ergänzt Prof. Dr. med. Henning Baberg, Chefarzt der Klinik und Poliklinik für Kardiologie und Nephrologie. „Nur so können wir die Therapie optimal und sicher für den Patienten durchführen.“
Im HELIOS Klinikum Berlin-Buch wird auf jeder Station speziell für Diabetes ausgebildetes Pflegepersonal vorgehalten, um alle aufgenommenen Patienten auf diese Erkrankung zu untersuchen. Diabetiker werden hinsichtlich möglicher Komplikationen erfasst und entsprechend individuell betreut. „Innerhalb der letzten sechs Monate haben wir unser Pflegepersonal auf allen Stationen speziell geschult“, berichtet Prof. Dr. med. Michael Ritter, Leiter des Bereichs Diabetologie und Endokrinologie im Bucher Klinikum, gemeinsam mit Pflegedienstleiterin Sylvia Lehmann anlässlich der Auszeichnung. Damit erfüllt das HELIOS Klinikum Berlin-Buch alle Kriterien, um die Qualität der Behandlung für Patienten mit der Nebendiagnose Diabetes zu verbessern: Ein diabetologisch versierter Arzt steht zur Verfügung, Pflegekräfte sind diabetologisch geschult und es ist gewährleistet, dass die Blutzuckerwerte bei jedem Patienten geprüft werden.
\n
Foto: Dr. Dietrich Garlichs (Geschäftsführer der DDG; 2.v.r.) überreicht Prof. Michael Ritter (Leiter Bereich Diabetologie; Bildmitte) in Anwesenheit der Krankenhausleitung und des Diabetesteams aus dem HELIOS Klinikum Berlin-Buch das Zertifikat. (HELIOS/Thomas Oberländer)
\ninvestieren, produzieren / 05.05.2015
Eckert & Ziegler startet gut ins Jahr 2015
Der Umsatz stieg vor allem währungsbedingt um 11% auf 34,0 Mio. Euro. Das EBIT stieg überproportional um 1,8 Mio. Euro oder 59% auf 4,8 Mio. Euro. Daraus resultiert ein um 68% gestiegenes Periodenergebnis von 2,7 Mio. Euro oder 0,51 EUR/Aktie.
Das Segment Isotope Products profitierte am stärksten vom schwächeren Euro und verzeichnete zudem einen Akquisitionseffekt. Somit stiegen die Umsätze um 10% auf 16,0 Mio. Euro. Aus diesen Effekten entsteht jedoch kein Ergebniszuwachs. Somit bleibt das Segment-EBIT konstant bei 3,7 Mio. Euro.
Das Segment Strahlentherapie zeigte im vergangenen Jahr eine unterdurchschnittliche Entwicklung. Die Situation verbesserte sich im ersten Quartal 2015. Die Umsätze mit Implantaten stiegen über den Währungseffekt hinaus auch organisch. Im Bereich Afterloader waren die Umsätze zwar rückläufig, jedoch wird aus der jüngst erfolgten Zulassung des neuen Geräts SagiNova® eine deutliche Umsatzsteigerung erwartet. Das EBIT lag aufgrund der Restrukturierungsmaßnahmen und eines positiven Währungseffekts im Bereich der für 2015 angestrebten schwarzen Null.
Das Segment Radiopharma glänzte mit weiter gestiegenen Umsätzen der Gerätesparte und der neuen Gallium-Generatoren und profitierte zudem ebenfalls vom Währungseffekt. Das überdurchschnittlich starke Q1/2014 wurde mit einer EBIT-Steigerung von 21% auf 1,4 Mio. Euro deutlich übertroffen.
Das Segment Sonstige konnte den Verlust im Entsorgungsbereich aufgrund von Preiserhöhungen reduzieren und in der Holding dank gestiegener Umlagen an die anderen Segmente ein ausgeglichenes Ergebnis vorweisen. Insgesamt halbierte sich der Verlust des Segments gegenüber dem Vorjahresquartal. Das EBIT verbesserte sich um 0,4 Mio. Euro auf -0,5 Mio. Euro.
Der Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit liegt mit 0,6 Mio. Euro deutlich besser als im ersten Quartal des Vorjahres, in welchem 1,7 Mio. Euro abflossen. Dennoch fällt der operative Kapitalfluss geringer aus, als das gute Periodenergebnis vermuten lässt. Hauptgründe sind der Abbau von Verbindlichkeiten und Rückstellungen sowie die Abarbeitung von Anzahlungen. Zudem enthält das Periodenergebnis zu den Abschreibungen gegenläufige nicht zahlungswirksame Erträge von 1,5 Mio. Euro, im wesentlichen Kurseffekte.
Für das Gesamtjahr 2015 soll der Umsatz auf über 133 Mio. Euro steigen und der Gewinn über 1,71 EUR/Aktie liegen.
Den vollständigen Quartalsbericht finden Sie hier:
http://www.ezag.com/fileadmin/ezag/user-uploads/pdf/financial-reports/deutsch/euz115d.pdf
Über Eckert & Ziegler.
Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN DE0005659700), gehört mit rund 700 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin.
Wir helfen zu heilen.
forschen, heilen / 29.04.2015
Größte Gesundheitsstudie Deutschlands lädt Wandlitzer zur Teilnahme ein
Die Briefaktion ist nötig, weil an der Studie nur teilnehmen kann, wer ein Einladungsschreiben von einem der bundesweit 18 NAKO-Studienzentren erhält. Die Auswahl der Angeschriebenen erfolgt nach dem Zufallsprinzip anhand von Adressen, die die Forscher von den Einwohnermeldeämtern bekommen haben. Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Die Untersuchungen können nur mit Einwilligung der Studienteilnehmer erfolgen, die ihre Einwilligung jederzeit zurückziehen können.
Über einen Zeitraum von fünf Jahren werden im Rahmen der NAKO bundesweit 200 000 Menschen zwischen 20-69 Jahren untersucht und bis zu 30 Jahre nachbeobachtet. 30 000 Menschen sollen in Berlin und den angrenzenden Regionen Brandenburgs in den drei Berliner Studienzentren untersucht werden. Davon sollen allein vom Studienzentrum Berlin-Nord auf dem Campus Berlin-Buch 10 000 Teilnehmer aus dem Nordberliner Raum und Brandenburg für eine Teilnahme gewonnen werden.
Das Studienzentrum Berlin-Nord auf dem Campus Berlin-Buch ist außerdem eines von bundesweit insgesamt fünf Studienzentren der NAKO mit einem Magnetresonanz-Tomographen (MRT). Der MRT befindet sich in der Berlin Ultrahigh Field Facility am MDC in Berlin-Buch, die von Prof. Thoralf Niendorf geleitet wird. Radiologinnen vor Ort sind Dr. Beate Endemann und Dr. Andrea Hasselbach. In Berlin-Buch sollen 6 000 der 30 000 Berliner und Brandenburger Studienteilnehmer eine Ganzkörper-MRT-Untersuchung erhalten. Bundesweit sollen insgesamt 30 000 der 200 000 Studienteilnehmer eine MRT-Untersuchung bekommen.
Generell werden die Teilnehmer dieser Bevölkerungsstudie nach ihren Lebensgewohnheiten wie körperliche Aktivität, Rauchen, Ernährung, Beruf, befragt und dann medizinisch untersucht. Ihnen werden unter anderem Blutproben entnommen, die zur späteren Beantwortung der Forschungsfragen der NAKO anonymisiert in Biobanken gelagert werden. Weiter werden Körpergröße, Körpergewicht, Körperfettverteilung, Blutdruck und Herzfrequenz gemessen. Diese Basisuntersuchung dauert etwa 3 Stunden. Ein Teil der Studienteilnehmer erhält darüber hinaus zusätzliche Untersuchungen, wie EKG, Echokardiographie oder Netzhautuntersuchung. Diese Untersuchungen dauern etwa 1,5 Stunden. Hinzu kommt eine MRT-Untersuchung.
Fünf Jahre nach der ersten Untersuchung werden die Probanden zur Nachuntersuchung gebeten. Die Forscher erfassen dann bei den Studienteilnehmern eventuell aufgetretene Erkrankungen und vergleichen die Untersuchungsergebnisse mit den bereits erhobenen Daten. Die Forscher erwarten auf diese Weise mehr über Ursachen und Risikofaktoren für die in Deutschland häufigen chronischen Krankheiten – Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes, Lungenerkrankungen, Krebs, neurodegenerative und psychiatrische Erkrankungen sowie Infektionskrankheiten – herauszufinden.
Initiiert haben die NAKO die Helmholtz-Gemeinschaft, zu der das MDC gehört, Universitäten, die Leibniz-Gemeinschaft sowie Einrichtungen der Ressortforschung. Finanziert wird die Langzeitbevölkerungsstudie vom Bundesforschungsministerium, den 14 beteiligten Bundesländern und der Helmholtz-Gemeinschaft. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 210 Millionen Euro.
Kontakt:
Prof. Tobias Pischon
Leiter des Studienzentrums Berlin-Nord der Nationalen Kohorte und Sprecher des Clusters Berlin-Brandenburg
Tel.: 030/ 9406 – 4570
E-Mail Sekretariat: marit.schneidereit@mdc-berlin.de
heilen / 28.04.2015
Schnelle und interdisziplinäre Behandlung des Schlaganfalls im HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Pro Jahr trifft in Deutschland rund 270.000 Menschen der Schlaganfall und hinterlässt bei einem Drittel der Betroffenen eine bleibende Behinderung. In der Region Berlin-Brandenburg geht man von circa 20.000 Betroffenen pro Jahr aus. Der Schlaganfall ist ein Notfall und erfordert schnelle Hilfe in einer auf die Diagnostik und Behandlung des Schlaganfalls spezialisierten Stroke Unit, um die routinierte und zeitnahe interdisziplinäre Behandlung der Patienten zu gewährleisten. \n
Bei einem ischämischen Schlaganfall wird das Gehirn plötzlich nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Schon nach Minuten sterben unwiderruflich Nervenzellen ab, so dass frühes und schnelles Handeln entscheidend ist. „Die Ursache kann eine Durchblutungsstörung durch verengte oder ganz verschlossene Hirnarterien sein, manchmal auch eine Hirnblutung aus einem gerissenen Gefäß“, sagt Prof. Dr. med. Georg Hagemann, Chefarzt der Klinik für Neurologie.
\nDas vordringliche Ziel ist es, die Blutversorgung zum Gehirn möglichst schnell wieder zu normalisieren. Bei einer Mangeldurchblutung erfolgt die Behandlung mit dem etablierten Verfahren der sogenannten Thrombolyse („Lyse“). Hierbei erhält der Patient innerhalb der ersten Stunden nach dem Schlaganfall Medikamente, um das Blutgerinnsel aufzulösen.
\nEin weiteres modernes Behandlungsverfahren ist die frühe mechanische Wiedereröffnung des verstopften oder verengten Gefäßes durch Mikrokatheter. Dieses Verfahren, dessen Wirksamkeit internationale Studien aktuell belegen, wird im HELIOS Klinikum Berlin-Buch einem der wenigen hochspezialisierten Zentren rund um die Uhr angeboten. „Wir sind sehr froh, dass wir durch die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Klinik für Neuroradiologie unter Chefarzt Professor Dr. med. Marius Hartmann dieses moderne Therapieverfahren einsetzen können und so bei vielen Patienten mit einer individuell abgestimmten Therapie und Rehabilitation die größtmögliche Selbständigkeit nach einem Schlaganfall wiederherstellen können“, sagt Chefarzt Hagemann.
\nDas HELIOS Klinikum Berlin-Buch verfügt seit 2001 über eine zertifizierte Schlaganfallspezialstation in der Klinik für Neurologie. Damit stellt die Klinik die einzige überregionale Stroke Unit im Nordosten Berlins. Bei der Rezertifizierung wurde erneut durch eine unabhängige Prüfstelle bestätigt, dass alle Abläufe in der Klinik, den von der Deutschen Schlaganfallgesellschaft vorgegeben Kriterien und Qualitätsstandards entsprechen. Diese Prüfung erfolgt alle drei Jahre. Im Bucher Klinikum arbeitet ein interdisziplinäres Team aus Internisten, spezialisierten Neuroradiologen, Neuro- und Gefäßchirurgen, Krankengymnasten und Sprachtherapeuten eng mit erfahrenen Ärzten des Notfallzentrums und der Rettungsstelle zusammen.
Klinikkontakt:
HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Klinik für Neurologie, Überregional zertifizierte Stroke-Unit
Chefarzt: Prof. Dr. med. Georg Hagemann
Telefon: (030) 94 01-54 200
E-Mail: georg.hagemann@helios-kliniken.de
www.helios-kliniken.de/berlin-buch
Foto: Thomas Oberländer/ HELIOS Kliniken GmbH
\n\n
investieren, leben, erkunden / 27.04.2015
Rundgang in Buch zum Tag der Städtebauförderung
Am Samstag, dem 9. Mai 2015 findet zum ersten Mal der ab sofort jährlich wiederkehrende, bundesweite „Tag der Städtebauförderung“ statt. Der Aktionstag ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern, Deutschem Städtetag sowie Deutschem Städte- und Gemeindebund. Ziel ist es, die Bürgerbeteiligung zu stärken. An dem Tag finden in Berlin mehr als 30 Veranstaltungen in zehn Bezirken statt.
Mit der Städtebauförderung gestaltet Berlin lebendige Quartiere. Rund 1.000.000 Berlinerinnen und Berliner leben in den derzeit 64 Gebieten der Städtebauförderung auf einer Fläche von rund 9.000 ha. In der Hauptstadt stehen im Jahr 2015 rund 107 Millionen Euro Städtebaufördermittel inkl. der europäischen Mittel des Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung. Davon sind rund 66 Millionen Euro Mittel des Landes Berlin.
Im Stadtumbaugebiet Buch bietet das Stadtentwicklungsamt, vertreten durch den Fachbereich Stadterneuerung, an diesem Tag zusammen mit dem Gebietsbeauftragten „Planergemeinschaft“ einen geführten Rundgang durch den Ortsteil an. Aus den Fördermitteln des Stadtumbaus wurden in Buch bisher über 11 Millionen Euro in die Sanierung von sozialer und kultureller Infrastruktur sowie in Spielplätze und Grünanlagen investiert. Der Rundgang führt durch die sanierten Kindertagesstätten, Jugendfreizeiteinrichtungen sowie das Bucher Bürgerhaus und bietet einen Ausblick auf künftige Maßnahmen, die stärker auf die Gestaltung der Wegeverbindungen ausgerichtet sind.
Treffpunkt ist um 16 Uhr vor dem S-Bahnhofsgebäude Buch (Ausgang Nord-West). Der Rundgang wird zwei Stunden dauern. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
Das vollständige Berliner Programm in Netz unter: www.berlin.de/tag-der-staedtebaufoerderung.
Foto: Feierliche Wiedereröffnung des Spielplatzes im Wohngebiet an der Walter-Friedrich-Straße, der mit Stadtumbau-Mitteln neu gestaltet wurde. (Foto: Bezirksamt Pankow)
forschen / 24.04.2015
Rasterfahndung in Biobanken: MDC-Neurobiologen entdecken Protein, das vor Chorea Huntington schützt
Chorea Huntington, auch Veitstanz genannt, wurde 1872 von dem amerikanischen Arzt George Huntington entdeckt. Es ist ein seltenes, aber unheilbares Erbleiden (6:100 000), das meist in mittleren Lebensjahren ausbricht. Die Betroffenen leiden an unkontrollierbaren Zuckungen, Demenz und psychischen Störungen. Die Erkrankung führt rund 15 Jahre nach Ausbruch zum Tod. Für Kinder eines betroffenen Elternteils beträgt das Risiko, ebenfalls an Chorea Huntington zu erkranken, 50 Prozent. Das Gen für das HTT liegt auf Chromosom 4. Ist es mutiert, ist auch das Protein verändert. Charakteristisch für das giftige Protein HTT ist eine überlange Kette von 40 Glutaminbausteinen (Glutamin ist ein Baustein für Proteine) und mehr. Diese überlangen Glutaminabschnitte von HTT gelten als Antreiber für den Ausbruch von Chorea Huntington.
\nWie der Datenflut Herr werden?
Zielstellung des Forschungsprojekts von Prof. Wanker und seinen Mitarbeitern war, Proteine zu finden, die mit dem Protein Huntingtin (HTT) wechselwirken und verhindern, dass es sich falsch faltet, verklumpt, Nervenzellen in ihrer Funktion beeinträchtigt und vergiftet. „Aber wie können wir aus den verschiedenen Gen- und Proteindatenbanken brauchbare Informationen herausfischen und unter den tausenden von Proteinen und tausenden von Protein-Protein Wechselwirkungen, diejenigen herausfiltern, die mit dem mutierten Protein HTT interagieren und vor allem mit dem überlangen Glutaminabschnitt“, diese Frage stand am Anfang der Überlegungen.
Bei einer Suchmaschine gibt man einen bestimmten Begriff ein und das System spukt dazu unzählige Daten aus. Aber im Fall der MDC-Forscher ging das nicht, wollten sie nicht in der Datenflut aus den verschiedenen Biodatenbanken ertrinken. Da kam die Idee der Rasterfahndung auf, bei der Informationen aus verschiedenen Bereichen miteinander in einem abgestuften Verfahren verknüpft werden.
\nUm ihr Untersuchungsgebiet zu begrenzen, machten sich Dr. Martin Stroedicke, Dr. Yacine Bounab, Dr. Gautam Chaurasia, Dr. Matthias Futschik und Prof. Wanker die bisher in der Forschung gewonnenen Erkenntnisse über Chorea Huntington zunutze. Bei dieser Erkrankung sind hauptsächlich solche Hirnregionen betroffen, die mit Bewegung (Motorik) sowie Stimmungen und Gefühle zu tun haben. Vor allem eine Region, die Forscher Nucleus caudatus (Schwanzkern) nennen, ist bei Chorea Huntington massiv betroffen und von ihr gehen die meisten und schwersten Bewegungsstörungen aus.
\nDie Überlegung war dann, zuerst ein Proteinnetzwerk um das Protein HTT herum aufzubauen, um direkte und indirekte „Kooperationspartner“ von ihm zu identifizieren. Dazu durchkämmten die MDC-Forscher bereits veröffentlichte Gen- und Proteindaten der in Frage kommenden Hirnregionen und zwar sowohl von Huntington-Patienten als auch von gesunden Kontrollgruppen. Dabei identifizierten sie 1319 Proteinwechselwirkungen und entdeckten darunter über 500 Proteine, die direkt oder indirekt mit dem Protein HTT interagieren.
\nIn einem zweiten Schritt suchten sie nach HTT-Interaktionspartnern in gesunden Gehirnen und in anderem Körpergewebe, um nur die Proteine herauszufiltern, die für das Gehirn relevant sind. Dann engten sie die Suche im dritten Schritt auf die bei Chorea Huntington am stärksten betroffene Schwanzkern-Region ein. Sie verglichen dazu die Daten von 38 Chorea Huntington-Patienten mit Daten von 32 Gesunden. Dabei stießen sie auf 13 Proteine, die mit dem HTT-Protein direkt oder indirekt wechselwirken. Auffällig dabei: bei Chorea Huntington Patienten sind diese 13 Proteine in geringeren Mengen vorhanden als bei der Kontrollgruppe.
\nZu wenig Schutzprotein CMRP1 bei Erkrankten
Im dritten Schritt gelang es den MDC-Forschern, unter diesen 13 Eiweißen ein Protein herauszufiltern, das direkt auf die überlange Glutaminkette des HTT-Proteins zielt. Dieses Protein, kurz CRMP1 genannt (die Abkürzung steht für collapsin response mediator protein 1), spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Nervenzellen und ihrer Kommunikation. An Hand der Daten konnten die Forscher sehen, dass auch dieses Schutzprotein CRMP1 bei Chorea Huntington-Patienten in zu geringen Mengen vorkommt.
Erkenntnisse im Labor überprüft
Ihre beim Filtern der Datenbanken gewonnenen Erkenntnisse überprüften die Forscher anschließend in der Zellkultur im Labor sowie mit transgenen Mäusen – sie tragen zusätzlich das Gen für Chorea Huntington in ihrem Genom – und gesunden Mäusen. Dabei bestätigte sich, worauf die Befunde der Datenbanken bereits hingedeutet hatten, dass nämlich die Menge an CRMP1-Protein in den transgenen Tieren im Vergleich zu den gesunden Mäusen in der Tat sehr gering war. Unklar ist jedoch, weshalb das so ist.
Die nächste Frage war dann, ob das Protein CRMP1 Einfluss auf das mutierte HTT-Protein hat? Da es zu wenig von diesem Protein bei Chorea Huntington gibt, kurbelten die Forscher mit einem genetischen Trick die Produktion des Proteins CRMP1 in transgenen Chorea Huntington Taufliegen (Drosophila melanogaster) an. Kletterversuche zeigten, dass CRMP1 die Bewegungsstörungen der Tiere tatsächlich verbesserte.
\nNoch keine Therapie
Mit diesen Untersuchungen an Tieren konnten die MDC-Forscher experimentell nachweisen, dass CRMP1 in größeren Mengen die Fehlfunktion von HTT aufhebt. Es verhindert die Verklumpung von HTT und verbessert damit die Funktion von Nervenzellen bei Chorea Huntington. „Mit der molekularen Rasterfahndung haben wir eine einfache aber durchschlagende Methode entwickelt, solche Proteine zu identifizieren, die mit dem krankmachenden Protein HTT direkt wechselwirken“, erklärt Prof. Wanker. Neben diesem jetzt neu entdeckten Protein gibt es bereits andere Eiweiße, die Angriffspunkte für künftige Therapien bieten könnten und die die Forscher in ihr Netzwerk mit aufnehmen. Die Forscher hoffen, dass ihre Erkenntnisse helfen, eine Therapie gegen Chorea Huntington zu entwickeln. „Aber das wird noch viele Jahre dauern“, gibt Prof. Wanker zu bedenken.
*Systematic interaction network filtering identifies CRMP1 as a novel suppressor of huntingtin misfolding and neurotoxicity
produzieren / 23.04.2015
Tumorbestrahlungsgerät SagiNova® von Eckert & Ziegler erhält FDA-Zulassung
„Eckert & Ziegler BEBIG und das in 2013 akquirierte US-Unternehmen Mick Radio-Nuclear Instruments verfügen über jahrzehntelange Erfahrungen in der HDR-Technologie. Wir schätzen das jährliche Marktvolumen für Tumorbestrahlungssysteme in den USA auf knapp 50 Mio. EUR und freuen uns, an diesem Markt zunehmend zu partizipieren“, erklärt Dr. Edgar Löffler, Mitglied des Vorstands der Eckert & Ziegler AG und verantwortlich für das Segment Strahlentherapie.
SagiNova® ist das einzige in den USA zugelassene Tumorbestrahlungsgerät für die Brachytherapie, das sowohl mit einer in den USA zugelassenen Co-60 als auch Ir-192 Quelle angeboten wird.
Die HDR-Brachytherapie, bei der eine miniaturisierte Strahlenquelle kurzzeitig in den Tumor eingeführt wird, ist ein integraler Bestandteil bei der Krebsbehandlung. Patienten erhalten diese Behandlung häufig einzeln oder als begleitende Option zu externer Strahlentherapie oder Chemotherapie. Legt man die Anzahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) zugrunde, erkranken in den USA 25% mehr Menschen an Krebs als in Europa.
SagiNova® wird erstmalig auf der ESTRO, dem Jahreskongress der europäischen Radioonkologen vom 24.-28. April 2015 in Barcelona vorgestellt.
Das CE-Zeichen für SagiNova® wurde bereits Ende 2014 erteilt.
Über Eckert & Ziegler.
Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN DE0005659700), gehört mit über 700 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin.
Wir helfen zu heilen.
forschen / 23.04.2015
Neue Rechtsform für das MDC jetzt in Kraft – Neuer Name
„Wir freuen uns sehr, dass hiermit ein wichtiger Schritt für die Vertiefung und Stabilisierung der Zusammenarbeit zwischen MDC und Charité erfolgt ist und somit eine verlässliche und zukunftsfähige Struktur für translationale Forschung geschaffen wurde“, betonen MDC-Vorstand (komm.) Prof. Thomas Sommer und Dr. Heike Wolke (administrativer Vorstand des MDC).
Namensänderung des MDC
Mit der Umwandlung des MDC von einer Stiftung in eine Körperschaft des öffentlichen Rechts sind verschiedene administrative Änderungen verbunden. Auch der Name des MDC wurde geändert in „Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft“ und heißt nicht mehr „Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) Berlin-Buch“. Der neue Name verdeutlicht, dass das MDC Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft ist, der mit nahezu 36 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Etat von rund 3,8 Milliarden Euro größten Forschungsorganisation in Deutschland.
Weiter ändern sich mit dem Rechtsform-Wechsel auch die Strukturen der Organe, also der Leitungsgremien, des MDC. So ist das oberste Gremium des MDC, das Kuratorium, in einen Aufsichtsrat mit leicht veränderter Besetzung überführt worden. Ihm gehören jetzt höchstens 12 (bisher 19) Mitglieder an, davon zwei (statt bisher 4) vom Bund und ein Mitglied (statt 2) vom Land, wie bisher zwei Mitglieder des MDC, die nicht dem Vorstand angehören, die beiden Präsidenten der Humboldt-Universität zu Berlin, bzw. der Freien Universität Berlin, sowie bis zu vier (statt acht) Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Zivilgesellschaft. Der bisherige Stiftungsvorstand ist jetzt der Vorstand, der sich aber wie bisher aus einem oder mehreren wissenschaftlichen Mitgliedern sowie einem administrativen Mitglied zusammensetzt.
Der Wissenschaftliche Ausschuss des Kuratoriums ist jetzt der Wissenschaftliche Beirat. Ihm gehören bis zu 12 anerkannte Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler aus dem In- und Ausland an.
BIG ebenfalls Körperschaft des öffentlichen Rechts
Mit dem Inkrafttreten des Berliner Gesetzes ist jetzt auch BIG eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und damit eigenständig und rechtsfähig. Gleichzeitig umfasst das Gesetz auch eine formale Anpassung an das Berliner Universitätsmedizingesetz. Nach dem Gesetz ist das BIG eine außeruniversitäre Wissenschaftseinrichtung des Landes Berlin im Bereich der Biomedizin. Mitglieder des BIG sind die hauptamtlich bei der Charité beschäftigten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer (Professorinnen und Professoren, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren) sowie die leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MDC. Ihre Zugehörigkeit zu den Personal- und Dienststellen von Charité und MDC ist hiervon unberührt.
Aufgabe des BIG ist es, einen gemeinsamen Forschungsraum zwischen MDC und Charité aufzubauen mit dem Ziel, Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung rasch in neue Therapien und Diagnoseverfahren zu überführen.
Bis Ende 2014 finanzierte der Bund das BIG über die Helmholtz-Gemeinschaft. Seit 2015 wird das BIG zu 90 Prozent vom Bund und zu 10 Prozent vom Land Berlin getragen. Bis 2018 wird das BIG mit rund 300 Millionen Euro gefördert. Über die „Private Exzellenzinitiative“ von Johanna Quandt werden durch die Stiftung Charité zusätzlich 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Bereits zu Beginn des Jahres 2014 sind die ersten Forschungsprojekte des BIG gestartet, weitere Vorhaben haben Anfang 2015 ihre Arbeit aufgenommen.
Das MDC wurde im Januar 1992 auf Empfehlung des Wissenschaftsrats gegründet, um molekulare Grundlagenforschung mit klinischer Forschung zu verbinden. Es ist aus drei Zentralinstituten der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin-Buch hervorgegangen und wurde nach dem Physiker, Biologen und Nobelpreisträger (1969) Max Delbrück (4. 9. 1906 Berlin – 10. 3. 1981 Pasadena, USA) benannt. Das MDC hat derzeit 1 609 Beschäftigte, darunter 801 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Doktorandinnen und Doktoranden, die aus 57 Ländern der Erde kommen. Das Budget des MDC beträgt über 80 Millionen Euro, hinzukommen von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eingeworbene Drittmittel in zweistelliger Millionenhöhe. Das MDC wird, wie alle Helmholtz-Einrichtungen, zu 90 Prozent vom Bund und zu zehn Prozent von dem Land, in dem es seinen Sitz hat, beim MDC ist es Berlin, finanziert. \n
forschen / 22.04.2015
Leibniz-Wirkstoff des Jahres: Hoffnung für Hautkranke
Bei Menschen mit angeborener Ichthyose ist in der Haut das natürliche Gleichgewicht aus Zellwachstum und Verhornung gestört, die Patienten leiden unter einer extremen Verdickung der obersten Hautschicht, sichtbar als dunkle, lamellenartige Schuppen. Die Betroffenen müssen nicht nur täglich Stunden für die Hautpflege aufwenden – sie haben mit starkem Wasserverlust, Entzündungen und Infektionen zu kämpfen, und werden oft schon als Kinder sozial ausgrenzt. Ichthyose, auch „Fischschuppenkrankheit“ genannt, ist dabei nur ein Sammelbegriff, denn die Krankheit wird von verschiedenen, zum Teil äußerst seltenen genetischen Defekten verursacht. Bei manchen Patienten fehlt das Enzym Transglutaminase 1 (TG1), das als Klebstoff der Natur dafür sorgt, dass in den oberen Hautschichten Proteine quervernetzt werden und so ein Wasserverlust und eine Austrocknung des Körpers verhindert wird. – hier setzt die nun ausgezeichnete Wirkstoffentwicklung an.
Heiko Traupe und Karin Aufenvenne, Experten für Ichthyosen der Klinik für Hautkrankheiten des Universitätsklinikums Münster, suchten vor einigen Jahren nach einem neuen Therapieansatz, einer Möglichkeit, den Patienten das fehlende Enzym zu verabreichen. Sie kontaktierten Margitta Dathe, Leiterin der Arbeitsgruppe „Peptid-Lipid Interaction“ am FMP, die dann zusammen mit ihren Mitarbeitern Transportvehikel entwickelte in denen biotechnologisch hergestellte humane TG1 verpackt werden kann. Die Herausforderung bestand darin, das Enzym an seinen Wirkort innerhalb bestimmter Hautzellen, den Keratinozyten, zu transportieren. Bei den Transportvehikeln handelt es sich um Liposomen, die mit einem speziellen Peptid versehen sind, das die kleinen, fettähnlichen Tröpfchen mit dem eingebauten Enzym über die Haut und durch die Zellmembran der Keratinozyten transportiert und die TG1 im Zellinneren verfügbar macht.
Die generelle Wirksamkeit einer solchen Enzymersatztherapie wurde inzwischen in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe um Fernando Larcher am Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas in Madrid sowie Ingrid Hausser-Siller am Universitätsklinikum Heidelberg bestätigt. 2013 wurde der Therapie von der Europäischen Kommission der „Orphan-Drug-Status“ zugesprochen. Durch diesen Status wird in der EU die Entwicklung von Medikamenten für seltene Krankheiten mit einem vereinfachten und günstigeren Zulassungsverfahren gefördert, verbunden mit Exklusivrechten für 10 Jahre ab Marktzulassung.
Derzeit gibt es Gespräche mit einem Unternehmen der Pierre Fabre Laboratory (Pierre Fabre Orphan Dermatology), um die weitere präklinische Entwicklung der Therapie und erste klinische Studien zu initiieren.
Die liposomale Formulierung des Wirkstoffs für die Enzymersatztherapie von Ichthyose-Patienten wurde vom Leibniz-Forschungsverbund Wirkstoffe und Biotechnologie zum Leibniz-Wirkstoff des Jahres gewählt. Der Verbund bündelt mit 17 beteiligten Leibniz-Instituten die innerhalb der Gemeinschaft breit angelegte Forschung zu Molekülen mit biologischer Wirkung. Ausgezeichnet werden Margitta Dathe und ihre Mitarbeiter Heiko Nikolenko und Katrin Jordan. Der mit 2000 Euro dotierte Preis wird am 27. April anlässlich der Leibniz-Wirkstofftage in Hamburg verliehen.
Originalveröffentlichungen:
Apolipoprotein E peptide-modified colloidal carriers: the design determines the mechanism of uptake in vascular endothelial cells.
Leupold E, Nikolenko H, Dathe M.
Biochim Biophys Acta. 2009 Feb;1788(2):442-9.
Topical enzyme-replacement therapy restores transglutaminase 1 activity and corrects architecture of transglutaminase-1-deficient skin grafts.
Aufenvenne K, Larcher F, Hausser I, Duarte B, Oji V, Nikolenko H, Del Rio M, Dathe M, Traupe H.
Am J Hum Genet. 2013 Oct 3;93(4):620-30.
Über das Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP)
Das Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) gehört zum Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB), einem Zusammenschluss von acht natur-, lebens- und umweltwissenschaftlichen Instituten in Berlin. In ihnen arbeiten mehr als 1.500 Mitarbeiter. Die vielfach ausgezeichneten Einrichtungen sind Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft. Entstanden ist der Forschungsverbund 1992 in einer einzigartigen historischen Situation aus der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR.
Kontakt
Dr. Maritta Dathe
Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP)
Tel.: 030 94793 274
E-Mail: dathe@fmp-berlin.de
forschen / 22.04.2015
Neuer Wirkstoff hemmt die Migration von Krebszellen
Die meisten der heutigen Medikamente zielen auf leicht erreichbare Strukturen ab – oft imitieren sie kleine körpereigene Moleküle und binden zum Beispiel an Proteine, die aus Zellen herausragen. Weniger erforscht und unzugänglicher sind dagegen die unzähligen Wechselwirkungen, die Proteine untereinander ausbilden. Gelänge es hier gezielt einzugreifen, könnte man die Entwicklung innovativer Medikamente enorm voranbringen.\n
Ein Durchbruch auf diesem Gebiet ist der Gruppe um Ronald Kühne am FMP mit der Entwicklung sogenannter Proteo-Mimetika (ProM) gelungen. Die Moleküle imitieren ein weitverbreitetes Strukturmotiv in Proteinen, in dem die Aminosäure Prolin besonders häufig vorkommt. Sie haben dabei sogar eine höhere Affinität als ihre natürlichen Vorbilder.
\nDie Entwicklung der ProMs begann am Computer: In Simulationen können die FMP-Wissenschaftler vorausberechnen, welche Gestalt ein hypothetisches Molekül haben wird und wie es mit einem Protein interagieren wird. Inzwischen verfügt Kühne über eine ganze Reihe von ProM-Molekülen, die sich wie Bausteine kombinieren lassen. Die Synthese gelang in der Gruppe um Hans-Günther Schmalz an der Universität zu Köln.
\nWas sich mit den ProM-Bausteinen bewirken lässt, dafür haben Ronald Kühne und seine Mitarbeiter nun einen ersten Beweis geliefert. Sie entwickelten daraus einen Wirkstoff, der die Zellwanderung hemmt und damit die Ausbreitung aggressiver Brustkrebszellen in Kulturgefäßen verhinderte. Der Wirkstoff namens „compound 4b“, blockiert dabei die Ausbildung von Aktinfilamenten, die bei Zellen eine ähnliche Funktion wie die Muskeln und Knochen des menschlichen Bewegungsapparates übernehmen. Am FMP werden inzwischen Tierversuche vorbereitet, um die Wirkung der Substanz auf die Tumormetastasierung zu testen.
Text: Birgit Herden
Opitz R, Müller M, Reuter C, Barone M, Soicke A, Roske Y, Piotukh K, Huy P, Beerbaum M, Wiesner B, Beyermann M, Schmieder P, Freund C, Volkmer R, Oschkinat H, Schmalz HG, Kühne R. A modular toolkit to inhibit proline-rich motif–mediated protein–protein interactions. PNAS 2015 112 (16) 5011-5016. doi:10.1073/pnas.1422054112
\n
Über das Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP)
\nDas Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) gehört zum Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB), einem Zusammenschluss von acht natur-, lebens- und umweltwissenschaftlichen Instituten in Berlin. In ihnen arbeiten mehr als 1.500 Mitarbeiter. Die vielfach ausgezeichneten Einrichtungen sind Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft. Entstanden ist der Forschungsverbund 1992 in einer einzigartigen historischen Situation aus der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR.
Kontakt
Dr. Ronald Kühne
Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP)
Tel.: 030 94793 229
E-Mail: kuehne@fmp-berlin.de
heilen / 22.04.2015
Experte aus der Hamburger ENDO-Klinik gewonnen: Prof. Dr. med. Daniel Kendoff wird Chefarzt am HELIOS Klinikum Berlin-Buch
„Wir freuen uns sehr, die chefärztliche Nachfolge mit einem so erfahrenen und erfolgreichen orthopädischen Chirurgen besetzen zu können. Professor Dr. med. Daniel Kendoff war die letzten sechs Jahre als Oberarzt und wissenschaftlicher Leiter in der Hamburger ENDO-Klinik tätig, die seit 2012 zu HELIOS gehört“, sagt Klinikgeschäftsführer Dr. Sebastian Heumüller.
\nDer 39jährige Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie ist nach beruflichen Stationen an der Medizinischen Hochschule Hannover und am Hospital for Special Surgery in New York seit 2009 in der ENDO-Klinik in Hamburg tätig, zuletzt als Oberarzt und wissenschaftlicher Leiter.
\nSeine klinischen Schwerpunkte sind die Endoprothetik und Revisions-Endoprothetik von Hüft- und Kniegelenk sowie die operative Rekonstruktion der unteren Extremitäten. Forschungsschwerpunkte sind die klinische und experimentelle Forschung im Bereich der Primär-und Revisionsendoprothetik, der septischen Endoprothetik sowie der computerassistierten orthopädischen Chirurgie und der medizinischen Robotik.
\nProfessor Kendoff ist Mitglied zahlreicher nationaler und internationaler Fachgesellschaften, unter anderem der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie und der American Academy of Orthopeadic Surgeons, zudem ist er als wissenschaftlicher Gutachter tätig.
\nIn der HELIOS ENDO-Klinik haben sich die Ärzte auf die Behandlung von Gelenk- und Knochenerkrankungen spezialisiert. Ein Schwerpunkt bildet dabei die Versorgung mit künstlichem Gelenkersatz. Jährlich werden in Hamburg mehr als 6.000 gelenkchirurgische Eingriffe vorgenommen, seit 1976 wurden fast 140.000 Gelenkprothesen eingesetzt.
\nDas Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie in Berlin-Buch verfügt über rund 120 stationäre Betten, operiert wird in fünf Operationssälen. Jährlich werden hier ca. 4.500 Patienten stationär und ca. 15.000 Patienten ambulant behandelt.
Medizinische Schwerpunkte sind neben der Endoprothetik aller Gelenke die Versorgung von Unfallverletzungen bis hin zum Polytrauma (Schwerstverletztenbehandlung), die Behandlung von Berufsunfällen, Operationen bei Erkrankungen der Gelenke bei Kindern und Erwachsenen einschließlich der entzündlich-rheumatischen Gelenkerkrankungen, Operationen an der Wirbelsäule, die Behandlung von akuten und chronischen Sportverletzungen, die arthroskopische Chirurgie, die Handchirurgie und Plastische Chirurgie, die Fußchirurgie sowie die operative Tumorbehandlung an Extremitäten und Becken.
Das Zentrum wird unter der Gesamtleitung von Professor Dr. med. Kendoff auch weiterhin in Departments gegliedert sein: Department Orthopädie (Leitung: Prof. Dr. med. Daniel Kendoff), Department Unfallchirurgie (Leitung: Dr. med. Uwe-Jens Teßmann), Department Handchirurgie und Plastische Chirurgie (Leitung: Priv.-Doz. Dr. med. Andreas D. Niederbichler), Department Tumororthopädie (Leitung Priv.-Doz. Dr. med. Per-Ulf Tunn). Das Department Tumororthopädie ist Bestandteil des Sarkomzentrums Berlin-Brandenburg (Leiter: Priv.-Doz. Dr. med. Peter Reichardt). Zusätzlich bestehen Funktionsbereiche für Kinderorthopädie (Leitung: Dr. med. Matthias Rogalski) mit der Spezialisierung auf kinderneuroorthopädische Erkrankungen und für Orthopädische Rheumatologie (Leitung: Dr. med. Angelika Gursche).
\nProfessor Dr. med. Josef Zacher gratuliert seinem Nachfolger: „Ich wünsche Professor Kendoff einen guten Start in Berlin-Buch und viel Freude, Erfolg und gutes Gelingen bei seiner neuen Tätigkeit. Er findet hier am Standort ein hochkompetentes und sehr engagiertes Team vor, auf das ich sehr stolz bin.“
Foto: (v.l.) Klinikgeschäftsführer Dr. Sebastian Heumüller, Chefarzt Prof. Dr. med. Daniel Kendoff und der Ärztliche Direktor des HELIOS Klinikums Berlin-Buch, Prof. Dr. med. Josef Zacher (HELIOS Kliniken, Thomas Oberländer)
22.04.2015
Drei altersgerechte Konzepte unter einem Dach
Der lichtdurchflutete und liebevoll dekorierte Wintergarten der Tagespflege war bis auf den letzten Stuhl besetzt, als der Geschäftsführer, Jörg Schwarzer, mit der Eröffnungsrede begann und die besondere Ausgangslage bei diesem Projekt hervorhob: „Von Beginn an war klar, das neue Haus soll vor allem den Bedürfnissen der zukünftigen Nutzer gerecht werden – deshalb saßen sie von Anfang an mit am Tisch. Ich finde, genau darum passt das Haus Prag so gut in unsere Stiftung.“ Auch die Vorstandsvorsitzende der Stiftung Lioba Zürn-Kasztantowicz gab sich begeistert von dem neuen „Wunschkind.“ „Ich habe von vielen Bürgern in Blankenburg gehört, dass unser neues Haus sehr gut gelungen ist und genau diese Gegend optisch erheblich aufwertet. Darauf können wir stolz sein.“
\nEin Gedicht, vorgetragen von Gästen der Tagespflege, zeichnete auf äußerst humorvolle Weise den Tagesablauf in ihrer Einrichtung nach und sorgte für Erheiterung bei den Zuschauern. Bei einem leckeren Imbiss und musikalischer Begleitung der Sängerin Claudia Himmel konnten sich die Besucher selbst ein Bild von den Räumlichkeiten machen.
\nIm Erdgeschoss steht die Tagespflege Goldener Herbst der Stiftung Sinnvolle Lebensgestaltung im Alter GmbH bis zu 26 pflegebedürftigen Gästen zur Verfügung. In ihrer Rede zeigte sich die Geschäftsführerin Petra Hoffmann begeistert: „Die hellen und freundlichen Räume sind von einer inneren Harmonie getragen. Sie bieten viel Platz für die verschiedenen gruppenspezifischen Angebote. Der schöne Blick ins Grüne kann bei einer Ruhepause genossen werden.“
\nDie ambulant betreute Wohngemeinschaft „Schäferstege“ im Obergeschoss gibt acht Menschen mit Demenz ein neues Zuhause. In diesem Zusammenhang begrüßte Ilona Kolbe, Fachbereichsleiterin für Menschen mit Pflegebedarf, nun ganz offiziell die erste Bewohnerin der neuen Wohngemeinschaft, die sich schon sehr über neue Mitbewohner freut. Der Umzug des 2009 gegründeten Ambulanten Pflegedienstes der Albert Schweitzer Stiftung – Wohnen & Betreuen macht die Hausgemeinschaft komplett.
\n
Bei weiteren Fragen zu den einzelnen Einrichtungen wenden Sie sich bitte an:
Tagespflege Goldener Herbst
Ina Miller
Tel.: 030.499 06-650
Email: pdl@seniorenbetreuung-berlin.de/ www.seniorenbetreuung-berlin.de
Wohngemeinschaft Schäferstege
Laura Kuhl
Tel.: 030.474 77-425
Email: Demenz-WG@schaeferstege.de
Ambulanter Pflegedienst der Albert Schweitzer Stiftung –Wohnen & Betreuen
Natalia Handke
Tel.: 030.474 77-333
Email: ambulanterpflegedienst@ass-berlin.org
investieren, produzieren, leben / 15.04.2015
OMEICOS Therapeutics erhält 6,2 Millionen Euro in Serie-A-Finanzierung, um seinen Wirkstoffkandidaten zur Behandlung von Vorhofflimmern voranzubringen
"Die wachsende Anzahl von Patienten mit Vorhofflimmern sieht sich sehr eingeschränkten medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten gegenüber. Aktuelle Behandlungen verfügen über eingeschränkte Wirksamkeit, bergen das Risiko schwerwiegender Nebenwirkungen und sind nicht in der Lage, die Sterblichkeit der Patienten zu verringern," so Dr. Robert Fischer, Chief Scientific Officer bei OMEICOS Therapeutics. "Wir sind hocherfreut über die Entscheidung unserer Investoren und sehen ihre Beteiligung als Bestätigung des Potenzials von OMEICOS, innovative Medikamente für die Prävention und Behandlung schwerer kardiovaskulärer Erkrankungen wie dem Vorhofflimmern zu entwickeln."
Der innovative therapeutische Ansatz des Unternehmens basiert auf synthetischen Derivaten natürlicher Stoffwechselprodukte der Omega-3-Fettsäuren, welche eine starke antiarrhythmische Wirkung besitzen. Bislang waren die Versuche, die Omega-3-Fettsäuren therapeutisch wirksam zu nutzen, aufgrund der Instabilität ihrer bioaktiven Stoffwechselprodukte nicht sonderlich erfolgreich. OMEICOS ist es gelungen, diese Hürde durch die Entwicklung synthetischer Moleküle zu überwinden, die ebenso effektiv, jedoch wesentlich stabiler sind als die natürliche Metaboliten und sich dadurch als oral verfügbare Therapeutika eignen.
Im Gegensatz zu anderen Antiarrhythmika aktivieren die OMEICOS-Wirkstoffe einen endogenen, kardioprotektiven Signalweg, der den Herzrhythmus stabilisiert. Zudem geht man davon aus, dass der Wirkstoff eine heilende Wirkung auf das erkrankte Herz haben kann, indem er dessen elektrischen und strukturellen Umbau verhindert - eine häufige Ursache für Herzerkrankungen und den plötzlichen Herztod. Die unternehmenseigene Substanz-Plattform von OMEICOS verfügt über ein hohes Potenzial für weitere Entwicklungen in zusätzlichen Indikationen, wie z.B. für weitere kardiovaskuläre als auch chronisch entzündliche Erkrankungen.
"Wir glauben, dass OMEICOS mit seiner einzigartigen Technologie und dem eingespielten Expertenteam die bestehende Lücke in der Behandlung des Vorhofflimmerns schließen wird," ergänzt Dr. Christian Schneider von Vesalius Biocapital Partners. "In unserer Rolle als Lead-Investor freuen wir uns, OMEICOS in dieser starken Interessengemeinschaft aus privaten und öffentlichen Investoren zu unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, um die Entwicklung des Wirkstoffkandidaten durch die Phase der prä-klinischen bis zur klinischen Entwicklung voranzubringen."
Nach Abschluss der Finanzierungsrunde traten Christian Schneider und Gaston Matthyssens von Vesalius Biocapital Partners, Peter Seiler von der SMS Group, Ute Mercker von VC Fonds Technologie Berlin, Martin Pfister von der Hightech Gründerfonds II GmbH & Co. KG sowie Mitgründer Wolf-Hagen Schunck dem Aufsichtsrat von OMEICOS bei.
Über Vorhofflimmern
Vorhofflimmern (VF) ist die häufigste Herzrhythmusstörung beim Menschen. Charakteristisch für VF ist ein unregelmäßiger Herzrhythmus, der seinen Ursprung in den beiden Vorhofkammern nimmt und eine verminderte Pumpfunktion des Herzens zur Folge hat. VF führt zu einer deutlichen Verringerung der Lebensqualität, erhöht das Risiko für Schlaganfall und Herzversagen und verdoppelt das Sterberisiko.
Über OMEICOS
OMEICOS Therapeutics GmbH ist ein Spin-off-Unternehmen des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin (MDC) in Berlin, mitbegründet und geleitet von Dr. Robert Fischer (Geschäftsführer) und Dr. Karen Uhlmann. Das Unternehmen entwickelt für die orale Anwendung geeignete niedrigmolekulare Verbindungen mit einem innovativen Wirkmechanismus zur Behandlung verschiedener kardiovaskulärer Erkrankungen, zunächst mit Fokus auf VF. Die neuartige VF-Therapie des Unternehmens basiert auf synthetischen Analoga natürlicher Stoffwechselprodukte von Omega-3-Fettsäuren. Entdeckt und entwickelt wurde die Technik ursprünglich von einem Forscherteam unter der Leitung von Dr. Wolf Schunck und Dr. Dominik Müller vom MDC und Dr. John R. Falck vom University of Texas Southwestern Medical Center. Der Wirkstoffkandidat von OMEICOS ist für die orale, tägliche Behandlung von Patienten mit paroxysmalem und persistierendem Vorhofflimmern, mit und ohne strukturelle Herzerkrankung, zur Erhaltung des Sinusrhythmus vorgesehen. www.omeicos.com
Kontakt:
OMEICOS Therapeutics GmbH
Dr. Robert Fischer, Chief Scientific Officer and Managing Director
Robert-Rössle-Straße 10
13125 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 9489 4810
E-Mail: r.fischer@omeicos.com
www.omeicos.com
forschen, investieren, heilen / 02.04.2015
Neues Medikament - basierend auf einem Patent des MDC - zur Zulassung eingereicht
Der Arzneimittelkandidat berührt ein US-Patent, das aus den Arbeiten von Prof. Michael Bader und Dr. Diego Walter am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin Berlin-Buch (MDC) hervorgegangen ist. Die Wissenschaftler haben Serotonin-modulierende Wirkstoffe untersucht, u. a. VWF, die zur Behandlung primärer Blutgerinnungsstörungen eingesetzt werden können. Im Jahr 2010 hat Ascenion einen Lizenzvertrag zwischen Baxter und dem MDC verhandelt, mit dem das Unternehmen die exklusiven Rechte erhält, den Faktor zur Therapie von Blutgerinnungsstörungen zu nutzen. Im Gegenzug erhält das MDC Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren. Über die Lizenzierung des Stoffpatentes hinaus ist das MDC nicht in die Entwicklung des BAX111-Programms eingebunden.
„Nach der Zulassung von Amgens Krebsmedikament Blincyto durch die FDA ist dies das zweite Medikament auf Basis von MDC-Patenten, das kürzlich einen wichtigen Meilenstein erreicht hat“, sagt Dr. Elisabeth von Weizsäcker, Direktorin Technologiemanagement bei Ascenion. „Dies zeigt deutlich, dass die Forschung am MDC letztlich Patienten in aller Welt zugutekommt.“
forschen / 27.03.2015
BIH-Vorstand: „Berliner Institut für Gesundheitsforschung erhält gesetzliche Grundlage“
BIH-Vorstand: „Berliner Institut für Gesundheitsforschung erhält gesetzliche Grundlage“
Der Vorstand des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung/Berlin Institute of Health (BIH) dankt dem Berliner Abgeordnetenhaus für die Verabschiedung des Gesetzes über das Berliner Institut für Gesundheitsforschung, mit dem der letzte Schritt im Gesetzgebungsverfahren erfolgt ist. Damit wird das BIH jetzt in eine Körperschaft des öffentlichen Rechts überführt. Das Gesetz wurde gestern, am 27. März 2015, mit breiter Zustimmung der Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus beschlossen. Rechtskräftig wird dieser Beschluss innerhalb der kommenden 14 Tage.
„Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung ist nun eigenständig und rechtsfähig. Auf diesem festen Grund können wir die gemeinsame Forschung von Charité und MDC und damit die translationale und systemmedizinisch ausgerichtete Forschung in Berlin weiter ausbauen.“ Das erklärten der BIH-Vorstandsvorsitzende Prof. Ernst Th. Rietschel und die BIH-Vorstandsmitglieder Prof. Karl Max Einhäupl (Vorstandsvorsitzender der Charité - Universitätsmedizin Berlin) und Prof. Axel Radlach Pries (Dekan der Charité) sowie Prof. Thomas Sommer (wissenschaftlicher Vorstand, komm., des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin, MDC, Berlin-Buch).
Der Gesetzesbeschluss ist ein wichtiger Meilenstein für den Wissenschafts- und Gesundheitsstandort Berlin. Bereits seit Gründung des MDC 1992 arbeiten MDC und Charité erfolgreich in Einzel- oder Verbundprojekten zusammen. 2011 begannen die Einrichtungen sowie Bund und Land erste Gespräche über eine gemeinsame neue Institution der biomedizinischen Forschung. „Wir sind voller Freude, dass Bund und Land die stärkere Verbindung von Grundlagenforschung und klinischer Forschung, wie wir sie im BIH etablieren, seitdem konsequent vorangetrieben und alle notwendigen Schritte zur Institutionalisierung immer unterstützt haben“, erklärt der BIH-Vorstand. „Unser Forschungsansatz und die Bündelung der exzellenten Bereiche von MDC und Charité unter einem Dach werden langfristig dazu beitragen, entscheidende Fortschritte für die Gesundheit der Menschen zu erreichen“, sagt der Vorstand.
Dem beschlossenen Gesetz zufolge ist das BIH eine außeruniversitäre Wissenschaftsein¬richtung des Landes Berlin im Bereich der Biomedizin. Mitglieder des BIH sind die hauptamtlich bei der Charité beschäftigten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer (Professorinnen und Professoren, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren) sowie die leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MDC. Ihre Zugehörigkeit zu den Personal- und Dienststellen von Charité und MDC ist hiervon unberührt.
Aufgabe des BIH ist es, einen gemeinsamen Forschungsraum zwischen MDC und Charité zu etablieren. Das Besondere daran: MDC und Charité bleiben voll rechtsfähige Gliedkörperschaften, also selbstständig. Die Einrichtungen können über eigene Belange – am MDC etwa die Forschung im Rahmenprogramm der Helmholtz-Gemeinschaft oder an der Charité Lehre, Forschung und Krankenversorgung – weiterhin unabhängig bestimmen.
Das Gesetz über das Berliner Institut für Gesundheitsforschung umfasst auch das Gesetz über die Körperschaft des öffentlichen Rechts „Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft“ sowie Änderungen des Berliner Universitätsmedizingesetzes, die im Rahmen der Gründung des BIH nötig sind. Das MDC wird damit seine Rechtsform ändern und von einer Stiftung des öffentlichen Rechts in eine Körperschaft des öffentlichen Rechts umgewandelt.
Weitere Informationen:
www.bihealth.org
www.charite.de
www.mdc-berlin.de
forschen / 25.03.2015
MDC-Forscher steigern Effizienz des Redigierens im Erbgut – „Innovatives Forschungsgebiet“
„Wofür früher Jahre benötigt wurden, genügen jetzt Monate“, hebt der Genforscher und Immunologe Prof. Rajewsky die Bedeutung der CRISP-Cas9-Technik zur Modifizierung des Genoms hervor. Das CRISP-Cas9-Verfahren macht Forschung nicht nur erheblich schneller, sondern ist zugleich auch effizienter und preiswerter als bisherige Verfahren und zudem leichter zu handhaben.
Die CRISPR-Cas9-Technik ermöglicht es an ausgewählten Positionen im Genom von Zellen oder Modellorganismen gezielte DNA-Doppelstrangbrüche zu erzeugen. An solchen künstlich herbeigeführten Bruchstellen können Forscher Gene einfügen, herausschneiden oder den genetischen Code nach Wunsch verändern.
Säugetierzellen verfügen über zwei verschiedene natürliche Mechanismen, um entstandene DNA-Doppelstrangbrüche zu reparieren. Der HDR (homology-directed repair) Reparaturweg ermöglicht das Einfügen (Insertion) vorgeplanter Genmodifikationen mit von außen zugeführten DNA-Molekülen, die Sequenzidentität mit dem Zielgen besitzen und als Reparaturmatrize dienen. Die HDR Reparatur ist sehr präzise aber nur wenig effizient.
Der andere Reparaturmechanismus, NHEJ (non-homologous end joining), ist in der Natur wesentlich häufiger und effizienter, da hierbei die DNA-Stränge ohne Reparaturmatrize einfach wieder neu verbunden werden, wobei häufig aber kurze Sequenzbereiche verloren werden. Die NHEJ Reparatur ermöglicht somit nur die Erzeugung kurzer, unpräziser Deletionen, also der Entfernung von DNA-Bausteinen, aber nicht von Insertionen und vorgeplanter Sequenzmodifikationen im Genom.
Viele Forscher arbeiten im Labor daran, die Reparaturverfahren für präzisere Modifizierungen des Genoms ohne Redigierfehler zu optimieren, so auch Dr. Van Trung, Prof. Rajewsky und Dr. Kühn. Ihnen gelang es jetzt, die Effizienz des präziser arbeitenden Reparaturverfahrens HDR zu erhöhen, indem sie den in Zellen dominanten Reparaturgehilfen von NHEJ, das Enzym DNA Ligase IV, vorübergehend ausschalteten. Dazu setzen sie unter anderem Proteine und „small molecules“ ein.
„Wir nutzen die Trickkiste der Natur, indem wir mit Hilfe von Proteinen von Adenoviren die Ligase IV blockierten und so die Effizienz des Verfahrens bis um das Achtfache erhöhen konnten“, sagt Dr. Kühn. So gelang es den Forschern in über 60 Prozent aller manipulierten Mauszellen ein Gen an einer bestimmten Stelle ins Genom einzufügen (Knock-In). Dr. Kühn leitet am MDC seit kurzem die Forschungsgruppe „iPS zellbasierte Krankheitsmodellierung“ und war zuvor am Helmholtz Zentrum München tätig. „Die Expertise von Ralf Kühn ist für die Genforschung am MDC und für unsere Forschungsgruppe von enormer Bedeutung“, betont Prof. Rajewsky.
Zeitgleich mit der Arbeit der MDC-Forscher ist eine weitere, ähnliche Publikation zur CRISPR-Cas9-Technologie ebenfalls in Nature Biotechnology erschienen. Sie stammt aus dem Labor von Hidde Ploegh am Whitehead Institut in Cambridge, MA, USA.
Ziel: Somatische Gentherapie von Krankheiten mit der CRISP-Cas9-Technik
Forscher setzen die erst 2012 entwickelte CRISP-Cas9-Technik bereits zur Korrektur von Gendefekten bei Mäusen im Labor ein. Eine weitere Einsatzmöglichkeit sind im Labor erstellte induzierte pluripotente Stammzellen (iPS), die in bestimmte menschliche Zellen oder Gewebe weiterentwickelt werden können. Mit den neuen Werkzeugen der CRISPR-Cas9 Technik können jetzt in Patienten identifizierte, krankheitsassoziierte Mutationen in iPS-Zellen eingeführt werden und ermöglichen die Erforschung von Krankheitsmechanismen direkt in menschlichen Zellen. „Langfristiges Ziel ist ebenfalls, die CRISPR-Cas9-Technik auch für die somatische Gentherapie beim Menschen zur Behandlung schwerer Erkrankungen einzusetzen“, erklärt Prof. Rajewsky.
Prof. Rajewsky: „Eines der aktuellsten Gebiete in den Lebenswissenschaften und ein innovatives Feld“
„Die Anwendung der CRISPR-Cas9-Technik ist derzeit eines der aktuellsten Themen in den Lebenswissenschaften und ein innovatives Feld“, erklärt Prof. Rajewsky. Er weist darauf hin, dass die neuen Möglichkeiten eines gezielten Redigierens des Erbguts in den USA zurzeit eine intensive Debatte ausgelöst haben, weil die neuen Präzisionswerkzeuge theoretisch auch gezielte Veränderungen der Keimbahn des Menschen ermöglichen. Letztere sind zwar in vielen Ländern, so auch Deutschland, gesetzlich verboten, aber ein weltweites Verbot gibt es nicht. Die MDC-Forscher sind zwar von den durch die CRISPR-Cas9-Technologie eröffneten neuen Chancen für die Grundlagenforschung und Biomedizin fasziniert, lehnen aber gentechnische Manipulation der menschlichen Keimbahn strikt ab.
**Increasing the efficiency of homology-directed repair for CRISPR/Cas9-induced precise gene editing in mammalian cells
produzieren, heilen / 20.03.2015
Inforadio zu Gast: Medizintechnik gegen Krebs von 'Eckert & Ziegler'
Für die Krebsbehandlungen erwarten Ärzte in einer Klinik in Manchester dringend ein Teil für ein Bestrahlungsgerät. In Berlin-Buch ist alles bereits für den Versand vorbereitet. Seit mehr als 20 Jahren stellen die Mitarbeiter der "Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG" Arzneien und Geräte für die Krebsbehandlung her. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit 700 Mitarbeiter. Am Standort Berlin-Buch sind es rund 220. Die Geschäfte des Unternehmens laufen gut. Der Absatz steigt. Das Jahresvolumen beträgt rund 117 Millionen Euro.\n
Kopf des Unternehmens ist Andreas Eckert. Der Firmengründer ist von Haus aus Journalist. Vor seiner Zeit als Gesundheits-Unternehmer schrieb Andreas Ziegler Theaterkritiken und verfasste Businesspläne. Die unternehmerische Bescheidenheit in allen Ehren - im Fall von "Eckert & Ziegler" ist das dann doch etwas untertrieben. Denn im Bereich der hart umkämpften Nuklearmedizin wird nichts dem Zufall überlassen. Das Kerngeschäft des Strahlen- und Medizintechnikunternehmens ist die Verwendung von radioaktiven Materialien für Arzneien sowie die Entwicklung und Herstellung von Analyse- und Behandlungsgeräten.
Neuentwicklung im Bereich der Krebsdiagnose
Eine der neuesten Apparaturen der Entwickler aus Berlin-Buch ist ein Generator zur kostengünstigen Krebsdiagnose. Äußerlich ähnelt das Gerät mehreren Metallwürfeln, die miteinander verbunden sind. Im Versuchslabor steht es neben einem Laptop, mit dem es verbunden ist. Die dreidimensionale Darstellung erleichtert Fachärzten die Entscheidung bei der Krebsbehandlung. Sie können quasi schauen, was sich hinter einer Krebszelle befindet, ob sich bereits weitere bösartige Zellen gebildet haben oder nicht. Das war früher so nicht möglich. Durch das Diagnosegerät von "Eckert & Ziegler" ist heutzutage eine viel genauere Beurteilung des Krankheitsverlaufes bei Krebspatienten möglich.
Die Nachfrage nach neuesten Methoden zur Krebsbehandlung steigt weltweit. An vorderer Stelle rangieren dabei die USA. Die Vereinigten Staaten sind immerhin der weltgrößte Absatzmarkt für Gesundheitsprodukte. Inzwischen investieren auch wieder mehr Unternehmenskunden in Europa. Natürlich schauen die Abnehmer verstärkt auf den Preis. Daher wird bei dem Strahlen- und Medizintechnikhersteller "Eckert & Ziegler" genau durchgerechnet, welche Entwicklung nicht nur medizinisch, sondern auch finanziell einen Erfolg verspricht, räumt Sven Beerheide ein. Er ist Entwicklungsleiter im Unternehmensbereich Strahlentherapie.
Gerät zur Tumorbestrahlung
Wie gut sich moderne Entwicklung und wirtschaftlicher Erfolg miteinander verbinden, zeigt das von dem Berliner Gesundheitsunternehmen hergestellte Gerät zur Tumorbestrahlung. Es ist nicht viel größer als ein üblicher Reisekoffer. Bis zu 20 sehr kleine Injektionsnadeln können angeschlossen werden. Diese werden im Körper des Patienten ganz nah am Tumor platziert. So werden bei der Krebsbestrahlung gesunde Organe besser vor Verletzungen geschützt. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die Miniaturisierung der Bestrahlungstechnik das Gerät im Vergleich zu Therapiegeräten der Konkurrenz länger genutzt werden kann.
Gerät zur Tumorbestrahlung
Wie gut sich moderne Entwicklung und wirtschaftlicher Erfolg miteinander verbinden, zeigt das von dem Berliner Gesundheitsunternehmen hergestellte Gerät zur Tumorbestrahlung. Es ist nicht viel größer als ein üblicher Reisekoffer. Bis zu 20 sehr kleine Injektionsnadeln können angeschlossen werden. Diese werden im Körper des Patienten ganz nah am Tumor platziert. So werden bei der Krebsbestrahlung gesunde Organe besser vor Verletzungen geschützt. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die Miniaturisierung der Bestrahlungstechnik das Gerät im Vergleich zu Therapiegeräten der Konkurrenz länger genutzt werden kann.
Das Gläserne Labor des Campus Buch begeistert Kinder für Naturwissenschaften
Ein Aushängeschild des Campus Buch ist das Gläserne Labor. Hier veranstalten Schulklassen Forschercamps und führen chemische und physikalische Experimente durch. Seit einigen Jahren fahren Wissenschaftler aus Buch auch in die Kindergärten unserer Region. Das war die Ideen von Andreas Ziegler und seiner Frau. Beide regten an, bereits Vorschulkinder an die Welt der Naturwissenschaften heranzuführen. Darum kümmert sich im Gläsernen Labor die Chemikerin Bärbel Görhardt. Da geht es dann zum Beispiel um die Ausbreitung von Schallwellen. Das Experiment kann man sehr anschaulich darstellen: Mit einem einfachen Drahtbügel, der mit einem Bindfaden verknotet ist.
Teamgeist wird groß geschrieben
Viel Wert wird bei "Eckert & Ziegler" darauf gelegt, dass sich Job und Familie nicht widersprechen. Mitarbeiter können sich um ihren Nachwuchs kümmern und individuell Elternzeit nehmen.
Wichtig für eine erfolgreiche Firma ist der Teamgeist. Das klappt sehr gut über den Sport meint die Vertriebsinnendienstleiterin Karin Antonenko. Die aktive Marathonläuferin organisiert seit mehreren Jahren die Teilnahme ihres Unternehmens an Laufwettbewerben. In diesem Jahr wetteifern nicht nur Staffeln aus Berlin-Buch. Mit an den Start im Frühjahr gehen in diesem Jahr auch Kollegen der Niederlassung aus Braunschweig.
Stand vom 14.03.2015
Autor: André Tonn, Wirtschaftsredakteur, Inforadio des rbb
\nSendung zum Nachhören:
http://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/apropos_wirtschaft/201503/217715.html
\n
Quelle: Inforadio rbb
forschen / 19.03.2015
MDC-Forscher entschlüsseln regulatorisches Netzwerk in der Niere
Im Mittelpunkt ihrer Untersuchungen steht der Transkriptionsfaktor grainyhead-like 2 (GRHL2). Er steuert die Entstehung und den Zusammenhalt der Zellen, die die inneren und äußeren Körperflächen auskleiden (Epithelzellen), wie die Forschungsgruppe von Prof. Schmidt-Ott vor wenigen Jahren herausgefunden hatte. Jetzt haben die Forscher gezeigt, dass dieser Genregulator auch in den Nieren eine Rolle spielt.
Die Untersuchungen, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Stiftung Urologische Forschung gefördert wurden, ergaben, dass GRHL2 vor allem in den Sammelrohren der Niere und in deren embryologischen Vorläufern, den Ur-Nierengängen und der Ureterknospe (Harnleiterknospe), gebildet wird. Die Sammelrohre bilden besonders dichte, undurchlässige Abschnitte des Nephrons. Das Nephron ist das „Herzstück“ der Nieren. Es filtert die Schadstoffe aus rund 1 700 Litern Blut pro Tag heraus. Dabei werden zunächst zirka 180 Liter Primärharn gebildet, am Ende jedoch nur etwa 1-2 Liter ausgeschieden. Die Sammelrohre gewährleisten die Feineinstellung der Harnzusammensetzung.
In Zellkulturen von Sammelrohrzellen und in Ur-Nierengängen von Mausembryonen schalteten die Forscher den Transkriptionsfaktor aus, um zu sehen, welche Funktion er für die Nieren hat. Das Ergebnis: Fehlt er, verändert sich die Barrierefunktion der auskleidenden Epithelzellen und es verringert sich die Weite des Hohlraums (Lumens) der Nierenkanälchen.
Doch arbeitet der Transkriptionsfaktor GRHL2 nicht alleine, wie die MDC-Forscher weiter herausfanden. Er tut sich zusammen mit einem weiteren Transkriptionsfaktor, ovo-like 2 (OVOL2), den er aber auch reguliert. Dieses Tandem steuert sowohl ein Gen, das wichtig für die Abdichtung von Epithelzellverbänden ist (Claudin 4) und damit eine undurchlässige Barriere gewährleistet, als auch ein weiteres Gen (Rab 25), welches das innere Milieu des Lumens steuert. Claudin 4 und Rab 25 steuern gemeinsam die Aufweitung des Lumens. Damit haben Annekatrin Aue, Dr. Hinze und Prof. Schmidt-Ott einen neuen Signalweg in der Niere entdeckt.
Die Steuerung von Barrierefunktion und Lumenbildung in den Nierenkanälchen ist wichtig für die normale Nierenentwicklung und für die Nierenfunktion, spielt aber auch eine Rolle für die Entstehung von Nierenzysten, bei denen sich die Hohlräume der Nierenkanälchen krankhaft aufweiten und damit auch das umliegende Nierengewebe schädigen. Inwieweit die Erkenntnisse der MDC-Forscher klinisch relevant sind, müssen weitere Forschungen zeigen.
*A Grainyhead-Like 2/Ovo-Like 2 Pathway Regulates Renal Epithelial Barrier Function and Lumen Expansion
Abb.: Niere eines Mausembryos. Die Zellkerne sind grün und der Transkriptionsfaktor Grhl2 ist rot angefärbt. (Photo: Katharina Walentin/ Copyright: MDC)
investieren, leben / 19.03.2015
Neue Themen im Stadtumbau in Buch ab 2016
Zu dem vermeintlich "trockenen" Thema kamen - wie schon bei der Vorgängerveranstaltung im Juni 2014 - mehr als Hundert Interessierte. Verständlich, geht es doch laut Übersetzung des zuständigen Bezirksstadtrats Jens-Holger Kirchner schlicht darum, was in Buch in den nächsten Jahren passieren soll.
Seit 2011 wurden mit den Fördermitteln aus dem Stadtumbau-Programm zahlreiche Kitas, Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen saniert. Unverzichtbar geworden ist das Bucher Bürgerhaus, das mit Stadtumbau-Mitteln aus einem Kitagebäude entstand.
Nach diesen erfolgreichen Sanierungsschritten an der sozialen Infrastruktur des Stadtteils möchte das Bezirksamt neue Schwerpunkte setzen. Zu den nach dem 1. Bürgerforum im Juni 2014 sowie der anschließenden Online-Beteiligung entwickelten Ideen und Vorschlägen wurde in der "Festen Scheune" an fünf Thementischen diskutiert. Dabei ging es um: \n
- \n
- die neue Mitte \n
- das Bahnhofsumfeld \n
- Buch Süd \n
- den Schlosspark und Alt-Buch sowie \n
- das vom Bezirksamt angestrebte Erweiterungsgebiet von der Straße am Sandhaus bis zu den Regierungskrankenhäusern \n
\n
In den Gesprächsrunden war viel Konsens zu verzeichnen und auch diesmal brachten die Bucherinnen und Bucher wieder wertvolles Expertenwissen ein. Kritisch stehen viele dem Plan eines Naturschutzgebietes im Schlosspark gegenüber. Stattdessen wollen sie die in den letzten Jahrzehnten immer größer gewordene Moorlinse geschützt wissen.
Nach den Worten von Stadtrat Kirchner gehören zu den Prioritäten des Bezirks für die nächste Förderperiode voraussichtlich:
- \n
- das Bildungszentrum mit Bibliothek und Musikschule \n
- die Verbesserung der Wegeverbindungen für Fußgänger und Radfahrer, zum Beispiel mit der Entwicklung der alten Industriebahn, sowie die Barrierefreiheit und ein Wegeleitsystem \n
- die Entwicklung von Wohnungsbau, unter anderem in Buch Süd und an der Straße am Sandhaus \n
- Konzepte zur Neuordnung des ruhenden Verkehrs \n
- der Schlosspark und der Pankepark mit dem geplanten Gesundheitsparcours sowie \n
- ein Energiekonzept für den Stadtteil. \n
\n
Im Aktualisierungsprozess des ISEK ist man beinahe auf der Zielgeraden: Ende April wird der Entwurf des Konzepts im Pankower Stadtentwicklungsausschuss beraten, danach folgt ein formeller Beschluss des Bezirksamts und der Antrag an den Senat zur Weiterführung der Förderung. Die Erweiterung des Fördergebiets erfordert einen Senatsbeschluss.
Jens-Holger Kirchner bedankte sich bei den Anwesenden für die konstruktive Mitarbeit und riet zur weiteren aktiven Teilnahme. Darum braucht er sich in Buch sicher keine großen Sorgen zu machen.
\n
Beitrag von Anka Stahl, Redaktion Stadtumbau Berlin (siehe Link unten)
Foto: Was kann in Berlin-Buch getan werden? Die Diskussionen waren konkret und die Planer notierten mit. (Foto: Anka Stahl)
forschen, leben, heilen / 17.03.2015
Familienbüro mit Kinderzimmer im ECRC von MDC und Charité eröffnet
Wie PD Dr. Il-Kang Na, die das Projekt Familienbüro zusammen mit Franziska Peter in die Tat umgesetzt hat, erläuterte, steht das Familienbüro nicht nur für Eltern und ihre Kinder aus dem Sonderforschungsbereich zur Verfügung, sondern auch für ECRC-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weiter kann es auch während einer Tagung oder eines Kongresses genutzt werden. Es ist ausgestattet mit einem Bettchen, Kinderstühlchen, Tischchen und Spielzeug sowie einem Wickeltisch und vielen weiteren Utensilien, die für die Betreuung von Babys und Kleinkindern benötigt werden. Aber auch größere Kinder finden Beschäftigung und können sich beispielsweise in einer Leseecke in Bücher vertiefen, basteln oder einen Film anschauen.
Der Campus Charité-Mitte verfügt bereits seit einiger Zeit über ein Familienzimmer.
Weitere Informationen:
Priv.-Doz. Dr. med Il-Kang Na
Tel.: 030/ 450 540 155
E-Mail: il-kang.na@charite.de
http://www.sfb-tr36.com/
http://www.franziska-peter.de
http://www.wandmalereiberlin.blogspot.de/
http://familienbuero.charite.de/service/charite_und_kind/kinderzimmer/\n
Foto: Das Familienbüro im Experimental and Clinical Research Center (ECRC) des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin (MDC) und der Charité – Universitätsmedizin Berlin. (Photos/Copyright: Franziska Peter)
\n
investieren, produzieren / 17.03.2015
Eckert & Ziegler mit Dividendenvorschlag
Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 3. Juni 2015 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,60 EUR pro dividendenberechtigter Aktie vorschlagen (Vorjahr: 0,60 EUR). Die vollständigen Zahlen werden am 26.03.2015 veröffentlicht.\n
Ihre Ansprechpartnerin:
Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations
Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Germany
Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de
forschen / 16.03.2015
MDC- und Charité-Forscher schärfen das Immunsystem gegen Krebs
Das Selbstverteidigungssystem des Körpers ist darauf trainiert, zwischen fremd und eigen zu unterscheiden und körperfremde Strukturen zu erkennen und zu zerstören. Bei Krebserkrankungen jedoch ist das Immunsystem offenbar sehr zurückhaltend. So könnte es zwar Krebszellen erkennen, denn sie tragen häufig Merkmale (Antigene) auf ihrer Oberfläche, die sie als krankhaft veränderte Zellen ausweisen. Aber meist attackiert das Immunsystem sie nicht, sondern toleriert sie, weil Krebszellen körpereigene Zellen sind, die Immunzellen nicht als fremd erkennen. Diese Toleranz möchten die Forscher für die Entwicklung von Therapien gegen den Krebs gezielt durchbrechen.
Dreh- und Angelpunkt bei der Attacke des Immunsystems sind die sogenannten T-Zellen. Sie tragen auf ihrer Oberfläche Ankermoleküle (Rezeptoren), mit denen sie die fremden Strukturen, die Antigene von Bakterien oder Viren, erkennen und so die Eindringlinge gezielt zerstören können. Diese Eigenschaft der T-Zellen versuchen Krebsforscher und Immunologen auch im Kampf gegen Krebs zu mobilisieren. Entscheidend dafür ist, dass die T-Zellen ganz gezielt nur Krebszellen erkennen und angreifen, die anderen Körperzellen aber verschonen.
Jetzt ist es Matthias Obenaus, Prof. Blankenstein und Prof. Schendel gelungen, menschliche T-Zell-Rezeptoren (englische Abkürzung TCRs) zu entwickeln, die keine Toleranz mehr gegenüber menschlichen Krebszellen haben und ganz speziell ein Antigen erkennen, das auf verschiedenen menschlichen Tumorzellen vorkommt, das Antigen MAGE-A1. Dazu gingen sie quasi einen Umweg über Labormäuse.
Zunächst statteten die Forscher die Mäuse mit der genetischen Information für menschliche TCRs aus. Diese bilden daraufhin ein ganzes Arsenal menschlicher TCRs (Nature Medicine, doi: 10.1038/nm.2197). Wenn die T-Zellen der Mäuse mit menschlichen Krebszellen in Kontakt kommen, sind deren Antigene für sie genauso fremd wie die von Viren oder Bakterien und sie können die Tumorzellen gezielt erkennen, angreifen und zerstören.
Jetzt gelang es den Forschern humane T-Zell-Rezeptoren von diesen Mäusen zu isolieren, die speziell gegen das Tumorantigen MAGE-A1 gerichtet sind. Danach transferierten Sie die T-Zell-Rezeptoren in menschliche T-Zellen und brachten ihnen so bei, die Krebszellen als fremd erkennen zu können.
Manche Menschen besitzen T-Zellen, die MAGE-A1 natürlicherweise auf Tumorzellen erkennen, allerdings nur in der Petrischale. Bei Untersuchungen im Tiermodell erwiesen sich nur die aufgerüsteten menschlichen TCRs aus den Mäusen als wirksam gegen den Tumor. Die TCRs aus menschlichen T-Zellen ignorierten den Tumor komplett. Der Vergleich mit den geschärften menschlichen TCRs aus der Maus zeigt, dass die TCRs von Patienten die Tumorantigene nicht gut genug erkennen können, sie sind zu schwach. „Die Tatsache, dass unsere TCRs aus der Maus besser sind, ist ein starker Hinweis darauf, dass die Immunzellen eines Menschen gegenüber MAGE-A1 tolerant sind“, erläutern Matthias Obenaus und Prof. Blankenstein.
Mit den von ihnen entwickelten und geschärften T-Zell-Rezeptoren planen die Forscher eine erste klinische Studie bei Patienten mit Multiplem Myelom, einer bösartigen Erkrankung des Knochenmarks, das das Antigen MAGE-A1 trägt.
*Identification of human T-cell receptors with optimal affinity to cancer antigens using antigen-negative humanized mice
forschen / 15.03.2015
MDC-Krebsforscher: Neue Funktion eines alten Bekannten – Enzym hebelt Zellschutzprogramm Seneszenz aus
Das Enzym, das Forscher kurz Shp2 nennen, gehört zu der Gruppe der sogenannten Tyrosin-Phosphatasen. Diese Enzyme sind wichtige Wachstumsregulatoren. Shp2 spielt dabei unter anderem bei der frühen Embryonalentwicklung eine Rolle sowie bei Krebs. So konnten vor einigen Jahren Forscher zeigen, dass Shp2 bei 70 Prozent der invasiven Formen von Brustkrebs hochreguliert ist. Diese Formen von Brustkrebs sind besonders aggressiv. Kürzlich ergab eine Studie mit menschlichen Brustkrebszellen außerdem, dass Shp2 Überlebenssignale in den Tumorzellen aussendet.
Grund genug für MDC-Krebsforscher Prof. Birchmeier, der sich seit Jahren mit Fragen der Signalübertragung bei Krebs befasst, und seine Mitarbeiter Dr. Linxiang Lan und Dr. Jane Holland, das Enzym genauer zu untersuchen. Sie interessierten auch Hinweise, wonach das Zellschutzprogramm Seneszenz auch Brustkrebs hemmen könnte.
Die MDC-Forscher untersuchten deshalb Mäuse, die das Brustkrebsgen PyMT tragen. Dieses Krebsgen löst rasch wachsenden Brustkrebs aus, der auch metastasiert. Die Forscher stellten fest, dass das Enzym Shp2 bei diesen Mäusen sehr aktiv ist. Sie konnten zeigen, dass Shp2 eine ganze Signalkaskade auslöst. Im Verlauf dieser Kaskade schaltet Shp2 verschiedene Signalmoleküle an, stellt aber tumorhemmende Gene wie die Tumorsuppressorgene p27 und p53 ab. Die Folge davon ist, dass das Seneszenz- Schutzprogramm ebenfalls abgeschaltet wird.
Die Frage war, ist es möglich das Schutzprogramm Seneszenz wieder anzuschalten? Und ist es möglich Shp2 direkt anzugreifen und stillzulegen? Mit einem experimentellen Hemmstoff (small molecule) gelang es Forschern der Berlin-Bucher Biotechfirma Experimental Pharmacology and Oncology (EPO), die wie das MDC auch auf dem Campus Berlin-Buch angesiedelt ist, im Rahmen dieser Studie das Shp2-Gen zu blockieren. Dadurch konnten sie das Schutzprogramm Seneszenz wieder anschalten, das die Krebszellen der Mäuse lahmlegte. Der Hemmstoff ist, wie Prof. Birchmeier erläutert, eine Entwicklung des Leibniz-Instituts für molekulare Pharmakologie (FMP) in Berlin-Buch. Er ist nicht für Patienten zugelassen.
In einem weiteren Schritt ging es darum festzustellen, welche Rolle Shp2 und seine Zielgene bei Patienten mit Brustkrebs spielen. Dr. Balázs Györffy von der Semmelweiss Universität in Budapest (Ungarn), der mit Prof. Birchmeier seit Jahren zusammenarbeitet, durchforstete rückwirkend die Daten von nahezu 4 000 Brustkrebspatientinnen. Dr. Györffy und seine Kollegen in Berlin sind nach der Auswertung der Daten davon überzeugt, dass die Aktivität von Shp2 und seinen Zielgenen Hinweise auf den Verlauf einer Brustkrebserkrankung geben können. Denn je weniger aktiv Shp2 ist, desto höher ist die Chance, dass die betroffenen Frauen nach erfolgreicher Brustkrebstherapie keinen Rückfall erleiden.
„Als Therapie könnte es deshalb sinnvoll sein, das Enzym Shp2 oder die von ihm angeschalteten Zielgene zu blockieren, um dadurch das Seneszenz-Schutzprogramm wieder zu aktivieren und den Brustkrebs zu stoppen“, vermuten die Forscher. Sie weisen darauf hin, dass Krebszellen im Seneszenz-Modus zudem Botenstoffe des Immunsystems (Zytokine) ausschütten, sodass das Abwehrsystem diese stillgelegten Tumorzellen erkennen und zerstören kann.
*Shp2 Signaling is Essential to the Suppression of Senescence in PyMT-induced Mammary Gland Cancer in Mice
Abb.: Hemmung der Tyrosinphosphatase Shp2 in Brustkarzinomen von PyMT Mäusen schaltet das Zellschutzprogramm Seneszenz an. Bei Seneszenz werden Zellen grösser, exprimieren das Enzym beta-Galatosidase (blaue Farbe), was zu permanenter Wachstumshemmung führt. (Graphik: Linxiang Lan/ Copyright: MDC)
forschen / 10.03.2015
Salz bringt das Immunsystem in der Haut gegen Infektionen auf Trab
Seit einiger Zeit ist bekannt, dass die Haut, die äußere Schutzhülle des Körpers, Salz speichert, wenn man zu viel davon isst. Aber welche Rolle spielt dieser Salzspeicher? Vor einigen Jahren konnte Prof. Titze zeigen, dass Kochsalz (Natriumchlorid) die Fresszellen des Immunsystems beeinflusst. Unabhängig davon fand er einige Jahre später mit Forschern der Universität Erlangen-Nürnberg und des MDC heraus, dass Salz die Zahl aggressiver Immunzellen (Th17-Zellen), die Autoimmunerkrankungen triggern, dramatisch erhöht.
Simulation eines Marsflugs gab Hinweise
Zuviel Salz ist schädlich, aber weshalb speichert der Organismus dann überschüssiges Salz in der Haut? Welchen Vorteil hat der Organismus davon? Die jetzige Untersuchung war unter anderem von einer 2013 veröffentlichten Studie (Cell Metabolism, http://dx.doi.org/10.1016/j.cmet.2012.11.013) zur Simulation eines Flugs zum Mars angeregt worden, an der Dr. Natalia Rakova und Prof. Luft vom ECRC beteiligt waren. Dabei hatten sie den Salzhaushalt von jungen Männern in einem simulierten Marsflug über 500 Tage lang untersucht und festgestellt, dass sich Salz in der Haut nach einem bestimmten Rhythmus einlagert.
Jetzt konnten Dr. Jantsch und Valentin Schatz, die beiden Erstautoren der neuen Studie, mit Hilfe modernster technischer Methoden (Magnet-Resonanz-Imaging, MRI) bei Patienten, die eine bakterielle Hautinfektion hatten, sehen, dass diese erhebliche Mengen an Salz in der Haut gespeichert hatten. Bei der Behandlung der Infektion mit Antibiotika ging die Salzmenge zurück. Mit einem Spektroskop konnten sie außerdem auch noch die Salzkonzentration in der Haut messen. Auch bei Mäusen, mit einer bakteriellen Hautinfektion, war um die Wunde herum ungewöhnlich viel Salz gespeichert. Hilft dieser Salzspeicher der Haut, sich gegen Keime von außen besser zu wehren?
Die Forscher und ihre Kollegen in Berlin und Nashville nahmen jetzt die Fresszellen des Immunsystems, die sich um die Wunde der Mäuse scharen, genauer unter die Lupe. Sie kultivierten die Fresszellen in Petrischalen in einer salzhaltigen Nährlösung, die dieselbe Salzkonzentration hatte, wie die Wunde, und in Petrischalen, deren Nährlösung kein Salz enthielt. Sie stellten fest, dass die Fresszellen, die in den Petrischalen mit sehr hoher Salzkonzentration lebten, weit mehr bakterientötende Substanzen ausschütten, als die Fresszellen, die in der salzfreien Nährlösung leben. In einem weiteren Schritt infizierten sie die Fresszellen mit den Bakterien Escherichia coli (E. coli) und Leishmania major (L. Major). 24 Stunden später war mehr als die Hälfte von E. coli in den Schalen mit hoher Salzkonzentration zerstört, und L. Major hatte sich auch verringert.
Anschließend fütterten die Forscher zwei Wochen lang eine Gruppe von Mäusen mit stark gesalzenem Futter, eine andere Gruppe mit salzarmen Futter. Dann infizierten sie bei den Mäusen aus beiden Gruppen eine Fußsohle mit L. Major. Nach 20 Tagen war die Wundheilung bei den Mäusen, die sehr salzhaltiges Futter bekommen hatten, sehr viel besser und auch die Bakterienlast hatte sich verringert im Vergleich zu den Mäusen, die salzarmes Futter bekommen hatten.
Forscher warnen aber vor hohem Salzkonsum
Die Untersuchungen an Patienten und an Mäusen legen nahe, dass hoher Salzkonsum die Fresszellen des Immunsystems verstärkt aktiviert. Die Forscher warnen aber davor, jetzt zu viel Salz zu essen. „Die Risiken überwiegen den Nutzen“, betonen sie. Inwieweit salzhaltige Umschläge eine geeignete Therapie für Wunden sein können, müssen weitere Forschungen zeigen.
*Cutaneous Na+ Storage Strengthens the Antimicrobial Barrier Function of the Skin and Boosts Macrophage-Driven Host Defense
\n
Foto: Salz bringt das Immunsystem auf Trab. Forscher warnen jedoch vor hohem Salzkonsum, da die Risiken den Nutzen überwiegen. (Foto: David Ausserhofer/ Copyright: MDC)
\n
forschen / 10.03.2015
MDC-Forscher entdecken neuen Signalweg der Embryonalentwicklung
Gegenstand der Studie ist der Genregulator grainyhead-like 2 (GRHL2), den die Forschungsgruppe schon seit längerem untersucht. Wie Dr. Walentin und Prof. Schmidt-Ott jetzt zeigen konnten, hat dieser Regulator bei der Entwicklung der Plazenta eine Schlüsselfunktion. In einer früheren Studie fanden Prof. Schmidt-Ott und seine Mitarbeiter heraus, dass er die Differenzierung von Epithelzellen – sie kleiden die inneren und äußeren Körperflächen aus – im Mausembryo steuert.
In der aktuellen Studie fiel den Wissenschaftlern auf, dass GRHL2 in der gesunden Plazenta sehr aktiv ist, insbesondere in den sogenannten Trophoblastzellen, die für die Entwicklung des Labyrinths verantwortlich sind. Das Labyrinth bildet die Schnittstelle zwischen dem Blutkreislauf des Embryos und dem der Mutter. Es gewährleistet den Nährstoff- und Sauerstoffaustausch sowie den Abtransport von embryonalen Stoffwechselendprodukten. Die Trophoblastzellen verzweigen sich baumartig und werden dabei von fetalen Blutgefäßen begleitet, so dass letztlich eine große Oberfläche für den optimalen Stoffaustausch zwischen Fetus und Mutter entsteht.
Schalteten die Forscher bei Mäusen den Genregulator GRHL2 im fetalen Anteil der Plazenta und im Embryo aus, so war die Entwicklung des Labyrinths schwer gestört. Insbesondere war die Verzweigung der Trophoblastzellen und die Einwanderung der fetalen Blutgefäße in die Plazenta beeinträchtigt. Schalteten die Forscher den Genregulator nur außerhalb der Plazenta im Embryo aus, so entwickelte sich das Labyrinth normal. Mit Hilfe genomweiter Analysen fanden die MDC-Forscher heraus, dass GRHL2 ein ganzes Genprogramm reguliert, dessen Komponenten entscheidend an der Entwicklung der Plazenta beteiligt sind.
Bei den Untersuchungen, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Stiftung Urologische Forschung unterstützt wurden, stellten die Forscher zudem fest, dass GRHL2 und seine Zielgene offenbar auch in der menschlichen Plazenta hochaktiv sind. Diese Erkenntnisse könnten, so hoffen die Forscher, für das Verständnis von Entwicklungsstörungen der Plazenta und damit verbundenen Schwangerschaftserkrankungen beim Menschen von Bedeutung sein.
*A Grhl2-dependent gene network controls trophoblast branching morphogenesis\n
\n
Abbildung: Entwicklung der Plazenta einer Maus Zwei Zellschichten des Labyrinths – es bildet die Schnittstelle zwischen dem Blutkreislauf von Embryo (unten) und Muttertier (oben) – sind durch Immunfluoreszenz rot bzw. grün markiert. Links ist das Labyrinth normal entwickelt, rechts ist es deutlich verschmälert und unzureichend verzweigt, da hier der Genregulator Grhl2 fehlt. (Foto: Katharina Walentin/ Copyright: MDC)
leben, heilen / 09.03.2015
Einladung zum Aktionstag "Darmkrebsvorsorge" im HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Dickdarmkrebs gehört immer noch zu den führenden krebsbedingten Erkrankungs- und Todesursachen. Meistens verursacht Darmkrebs erst im fortgeschritten Stadium Beschwerden. Deshalb sind Vorsorge und Früherkennung besonders wichtig: Im Rahmen einer Vorsorgekoloskopie (Darmspiegelung) können Polypen, die eine Vorstufe von Darmkrebs darstellen, entdeckt und entfernt werden. Außerdem ermöglicht die Untersuchung die Diagnose von Darmkrebs in frühen Stadien.
Im Rahmen des Aktionstages können die Besucher mit den Spezialisten des interdisziplinärem Ärzteteams des Bucher Darmzentrums ins Gespräch kommen und erhalten Antworten auf so grundlegende Fragen wie zum Beispiel:
Wie und warum entstehen die Polypen, die sich zum Darmkrebs entwickeln? Wie können sie erkannt und entfernt werden? Wie ist Dickdarmkrebs in welchem Stadium behandelbar?
Ab 10 Uhr können Interessierte gemeinsam mit den Experten das dreidimensionale Darmmodell besichtigen und Fragen zum anatomischen Aufbau ansprechen.
Ab 17 Uhr gibt es Kurzvorträge, eine Podiumsdiskussion und die Möglichkeit, mit den Spezialisten persönlich ins Gespräch zu kommen.
Die Themen im Überblick:\n
- \n
- „Die Darmkrebsvorsorge – für wen, wie und wann sinnvoll“, – erläutert Prof. Dr. med. Frank Kolligs, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie sowie Leiter der interdisziplinären Endoskopieabteilung \n
- „Mit gesundem Lebensstil Darmkrebs vorbeugen?“, dazu spricht Prof. Dr. med. Michel Ritter, Leiter Bereich Diabetologie/Endokrinologie \n
- „Operative Behandlungsmöglichkeiten von Darmkrebs“, stellt Prof. Dr. med. Martin Strik, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Onkologische Chirurgie und Leiter des Darmzentrums vor \n
- „Was bedeutet eine medikamentöse Tumortherapie?“, erklärt Priv.-Doz. Dr. med. Peter Reichardt, Chefarzt der Klinik für Interdisziplinäre Onkologie und Leiter des Onkologischen Zentrums Berlin-Buch. \n
Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung nicht erforderlich.
Kontakt:
HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
Telefon: (030) 9401-0
E-Mail: info.berlin-buch@helios-kliniken.de
www.helios-kliniken.de/berlin-buch
Weitere Informationen finden Sie hier: www.helios-kliniken.de/klinik/berlin-buch/fachabteilungen/allgemein-viszeral-und-onkologische-chirurgie/darmzentrum-berlin-buch.html
forschen / 05.03.2015
Die Hürden der translationalen Forschung überwinden
Translation ist ein Disziplinen-verbindender Prozess, der die Entdeckung von Wirkprinzipien sowie ihre Entwicklung und Erprobung an Patientinnen und Patienten umfasst und darauf ausgerichtet ist, neue Verfahren der Diagnostik, Therapie und Prävention zu finden. Dies geschieht auch mit dem Ziel, etablierte Ansätze in Frage zu stellen, weiterzuentwickeln oder zu revidieren.
Als elementare Hürde für erfolgreiche Translationsforschung sehen die Autorin und die drei Autoren ganz allgemein eine enge Zusammenarbeit aller beteiligten Einrichtungen, seien es Wissenschaftseinrichtungen, Universitäten oder Kliniken. Erfolgsfaktoren dafür sind u. a. eine enge, langfristige Vernetzung und/oder räumliche Nähe. Moderne Strukturen zur Integration von Wissen und ein neues Verständnis der Aus- und Weiterbildung in der translationalen Forschung sind dafür eine wichtige Grundlage.
Hürden in der Translationsforschung zu überwinden bedeutet auch, dass GrundlagenwissenschaftlerInnen, klinische WissenschaftlerInnen und in der Praxis Tätige die Sprache, das Denken und Arbeiten der anderen Disziplinen besser verstehen und sich als Teil eines Teams verstehen. Die Teamarbeit ist essenziell, denn in der translationalen Forschung geht es nicht um individuelle Leistungen.
Für erfolgreiche Translation brauchen diejenigen Ärztinnen und Ärzte, die in Kliniken tätig sind, Zeit. Zeit für Forschung, die nicht vorrangig durch ihr wirtschaftliches Potenzial definiert ist, sondern sich an einem besseren Verständnis grundlegender molekularer Mechanismen von Krankheiten orientiert. Diese Art von Wissen könnte dazu beitragen, dass Diagnosemethoden, Therapien und Wirkstoffe in den Phasen klinischer Erprobung schneller und effizienter in die Praxis gebracht werden und Innovationen in der angewandten Medizin weiter gefördert werden.
Die translationale Forschung steht zudem vor der Herausforderung, neue Erfolgskriterien und -indikatoren zu definieren. Hierzu gibt es national wie international verschiedene Ansätze, die weiterentwickelt werden müssen, insbesondere zur Leistungsbewertung. Zwei weitere zentrale Hürden der translationalen Forschung sind Finanzierungsmöglichkeiten (u. a. Partnerschaften von öffentlichen Fördereinrichtungen und Industrie) und neue Karrierewege für WissenschaftlerInnen in translationalen Forschungsprojekten, die die Translationsforschung attraktiv machen.
* E. T. Rietschel, L. Bruckner-Tuderman, G. Schütte, G. Wess, Moving medicine forward faster, Sci. Transl. Med 4 March 2015: Vol. 7 no. 277 pp. 277ed2
forschen, produzieren, leben, heilen, bilden / 04.03.2015
Noch einige freie Forscherferienplätze in den Osterferien
\n
\n
\n
MITTWOCH, 1. 4. 2015
9.00 - 13.00 Uhr
Cyanographie - die blaue Fotografie (12 - 14 Jahre)
Wie fing das mit der Fotografie an? Was steckt hinter den chemischen Umwandlungen der Fotografie? Probiere eine "blaue" Methode aus. Auch mitgebrachte Fotografien in digitaler Form können "blau" eingefärbt werden.
Mittagspause
14.30 - 17.00 Uhr
Bilderrahmen bauen und gestalten
DONNERSTAG, 9. 4. 2015
9.00 - 13.00 Uhr
Plastiktüte? Nein Danke! (10 - 14 Jahre)
Was ist das Schädliche daran? Und welche Alternativen gibt es? Probiere wes selbst aus und diskutiere mit.
Mittagspause
14.30 - 17.00 Uhr
Die starke Stärke
Details und Anmeldung hier.
leben, bilden / 26.02.2015
Energiewende in Schülerhände - neue Kurse im Gläsernen Labor
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
Interview mit Diplombiologin Claudia Jacob, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Gläsernen Labor (rechts im Bild)
Frau Jacob, seit Anfang 2015 gibt es im Gläsernen Labor einen neuen Kurs: „Energiewende in Schülerhände“. Wie kam es dazu?
Wir führen seit einigen Jahren erfolgreich Kurse zur regenerativen Energie für die fünfte und sechste Klasse durch. Dadurch erreichten uns viele Anfragen von Schulen, ob wir dieses Thema auch für die Oberstufe erarbeiten könnten. Unsere ersten Überlegungen zielten darauf, die technologischen Möglichkeiten der Energiewende zu veranschaulichen. In Berlin und Brandenburg gab es bisher noch keinen Kurs dieser Art, und unsere Schritte in die Richtung wurden sofort positiv aufgenommen. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) hat unseren Förderantrag in kürzester Frist bewilligt und unterstützt uns zwei Jahre lang bei der Realisierung. Im vergangenen Jahr konnten wir eine Projektstelle schaffen und neue Experimente und Kursinhalte entwickeln. Für die Mitarbeit konnten wir Dr. Cornelia Stärkel gewinnen.
Wie sind Sie an das komplexe Thema „Energiewende“ herangegangen?
Uns war wichtig, auch die gesellschaftliche Tragweite des Themas zu verdeutlichen und die Jugendlichen zu inspirieren, sich damit auseinanderzusetzen. „Energiewende in Schülerhände“ gibt einen Überblick über die ökologischen, ökonomischen und sozialen Herausforderungen und zeigt gleichzeitig die spannenden Verfahren auf, die die Energiewende möglich machen. Wir erklären die zugrunde liegenden physikalischen, chemischen oder biologischen Prozesse. Dieses Wissen soll den Schülern helfen, Fragen der Energiewende kompetent beurteilen zu können.
Was erwartet die Schülerinnen und Schüler?
Das Kursprogramm sieht vier Stunden Experimente an verschiedenen Stationen vor, ergänzt durch Vorträge und ein Planspiel zur Energiewende. Für die Stationen haben wir eigene Objekte entworfen, Glas über dem Bunsenbrenner geformt und sogar ein Fahrrad umgebaut. Die Jugendlichen können die Versuche selbst aufbauen und spezielle Messungen durchführen. Im Planspiel steht eine Kommune im Mittelpunkt. Die Schüler versetzen sich in die Rollen von Windparkbesitzern, Unternehmern, Bürgern oder Umweltschützern und sehen sich mit neuen energiepolitischen Vorgaben konfrontiert.
Welche Experimente stehen auf dem Programm?
Unsere Experimente vermitteln Methoden der Energieumwandlung. Dafür steht uns zum Beispiel ein „Gold-Cap“ zur Verfügung. Dieser Superkondensator kann sehr schnell viel Energie speichern, weil er die Eigenschaften einer Batterie und eines Kondensators verbindet. Unter anderem speichern Gold-Caps die Bremsenergie von Rennautos. In unserem Versuch laden die Schüler den Gold-Cap per Fahrraddynamo auf, um Spannung, Stromstärke, Last und Widerstand messen zu können. An einer anderen Station widmen sich die Schüler einem der aussichtsreichsten Energieträger der Zukunft, dem Wasserstoff. Sie verwenden einen Elektrolyseur, um Wasserstoff aus Wasser zu gewinnen und betreiben damit eine Brennstoffzelle, die Wasserstoff verbrennt. Mit der erzeugten Energie wird ein Propeller angetrieben. Bei diesem Versuch vermitteln wir unter anderem, wie sich chemische Energie in Form von Wasserstoff speichern lässt und dass dieser Stoff bei sachgemäßem Umgang ungefährlich ist. Andere Experimente beantworten Fragen wie: Wie ist ein Lithium-Ionen-Akku aufgebaut? Wie funktioniert eine Biobrennstoffzelle? Wieviel Energie lässt sich aus Biomüll gewinnen? Wie wirken sich verschiedene Verbrauchslastwerte auf ein Modellstromnetz aus?
Lässt sich das Thema „Energiewende“ noch weiter ausbauen?
Wir könnten uns vorstellen, mit den Schülerinnen und Schülern zur Leitidee des „Green Campus“ zu arbeiten. Denkbar wäre, die energetische Bilanz der Häuser verschiedener Bauweise anhand der Energiepässe zu untersuchen und zu vergleichen. Für Jugendliche aus Chemie- oder Physikleistungskursen könnten wir das Thema Energiewende noch fundierter anbieten. Nicht zuletzt würde sich das Thema „Energiewende“ auch gut als fünfte Prüfungskomponente eignen.
Das Thema Umwelt spielt auch in einem neuen Kurs zur Wasseranalyse eine Rolle. Wie ist dieser aufgebaut?
Im Mittelpunkt stehen Methoden der biologischen, chemischen und physikalischen Wasseranalyse. Der Kurs richtet sich an Klassen der Oberstufe und beginnt mit Feldforschung an der Panke im Schlosspark. Im Labor werden die Proben auf Plankton und Kleinstlebewesen untersucht, und für die chemische Analyse stehen ein Photometer und ein pH-Meter zur Verfügung. Die Schüler fällen Stoffe aus und bestimmen Gesamtwasserhärte und Eisengehalt durch Titration. Eine Station widmet sich der Mikrobiologie: Auf Agarplatten wird die Reinheit der Wasserproben untersucht. Wir thematisieren darüber hinaus die Verockerung der Spree und deren Folgen, diskutieren die Bedeutung von Wasserhärte und Reinheit des Trinkwassers.
Was macht ein gutes Gewässer aus?
Wasser, in dem Lebewesen gut gedeihen, hat einen hohen Gehalt an biologischem Sauerstoff. Dies können die Schüler im Experiment mit Wasserflöhen, wissenschaftlich Daphnien genannt, gut nachvollziehen. In Verdünnungsreihen beobachten sie, wie sich die kleinen Lebewesen verhalten. Ist am Ende nur noch reines Wasser in der Probe, ist die Umgebung lebensfeindlich. Dann hilft nur noch, die Daphnien schnellstens umzusiedeln.
Ist der Kurs schon im Angebot?
Ab Mai 2015 ist er offiziell im Kursprogramm.
Veranstaltungshinweis:
Gläsernes Labor mit Experimentierstand WASSERLEBEN
Vom 24. bis 27. März 2015 ist das Gläserne Labor bei WASSERLEBEN in der Messe Berlin dabei. Die Veranstaltung richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 2. bis 13. Klasse. Hier kann ausprobiert und experimentiert sowie nachgefragt werden. Das Gläserne Labor ist auf einem 23 Quadratmeter großen Experimentierstand vertreten und stellt seine beiden neuen Themen vor: „Wasser als die Energie von morgen“ und „Wasseranalyse“. Mit dabei sind die Kooperationsschulen Robert-Havemann-Gymnasium und Käthe-Kollwitz-Gymnasium sowie der neue Kooperationspartner Solar Explorer.
Foto: Dr. Cornelia Stärkel (links), Projektkoordinatorin Erneuerbare Energie, und Claudia Jacob, Projektleiterin im MaxLab, vor einem Versuchsaufbau mit Solarmodul, Elektrolyseur und Brennstoffzelle. (BBB Management GmbH Campus Berlin-Buch)
leben, bilden / 24.02.2015
Berufsorientierungsprojekt für Jugendliche "komm auf Tour - meine Stärken, meine Zukunft“
Berufsorientierungsprojekt für 1300 Pankower Jugendliche der 7. Klassen
Mehr als 1300 Pankower Jugendliche der 7. Klassen werden vom 2. – 10. März 2015 die Möglichkeit haben, den 600 m² großen Parcours vom Projekt „komm auf Tour –meine Stärken, meine Zukunft“ in der Black-Box-Music in Pankow-Wilhelmsruh zu durchlaufen. Das Projekt „komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“ (www.komm-auf-tour.de) unterstützt Jugendliche auf individuelle Weise, Fragen zur Berufsorientierung und Lebensplanung zu beantworten.\n
Zur Aktion gehören spielerische und handlungsorientierte Elemente, wie der Erlebnis-Parcours, bei dem die Jugendlichen spannende Situationen, wie die sturmfreie Bude meistern sowie Mut auf der Bühne und Ideenreichtum im Labyrinth beweisen können. Dabei stehen die individuellen Stärken der einzelnen Jugendlichen im Mittelpunkt. So erkennen sie beispielsweise, ob sie Organisationstalente sind, einen grünen Daumen haben, gern mit Kraft und Geschick handwerklich arbeiten oder vor Fantasie sprühen. Außerdem erfahren sie, welche Tätigkeiten und Berufsfelder zu ihren Stärken passen.
\nUnverbindliche erste Kontakte zu den Beschäftigten der Pankower Beratungsstellen, Freizeiteinrichtungen und Behörden können dabei nicht nur von den Jugendlichen, sondern auch von ihren Lehrkräften und - im Rahmen einer Abendveranstaltung am 5. März 2015 - von den Eltern geknüpft werden. Die Anmeldung hierfür organisieren die Schulen.
\nDie Bezirksstadträtin für Jugend und Facility Management, Christine Keil (Die Linke), erklärt dazu: „Die Philosophie des Projektes „komm auf Tour - meine Stärken, meine Zukunft“ ist eng mit dem Pankower Ausbildungstag verknüpft, der dieses Jahr am 20. Mai zum achten Mal stattfinden wird. Die Stärkesymbole aus dem Projekt, wie z.B. „mein tierisch grüner Daumen“, „meine Ordnung“, „meine Hände“, „meine Zahlen“ sind den Anforderungen der Berufe entsprechend zugeordnet und werden sich an den Ständen der Ausstellerinnen und Aussteller wieder finden. So können sich die Jugendlichen gut orientieren und finden passend zu ihren Stärken die jeweiligen Ausbildungsberufe. Das Engagement lohnt sich angesichts der Aussage eines Jugendlichen: „Jetzt weiß ich, was ich werden will.“
\nWeitere Infos bei Jutta Reiter,Tel.: 90295-7119, jutta.reiter@ba-pankow.berlin.de.
forschen / 19.02.2015
Neue Erkenntnisse zum Ablesen der DNA: Startregion weist nur in eine Richtung
Unser Erbgut, die DNA, ist im Zellkern auf kleinstem Raum verpackt. Sie ist eng aufgewickelt zu so genannten Nukleosomen, die durch freie DNA-Abschnitte verbunden sind. Damit ähnelt sie einer Perlenkette. Auf den DNA-Stücken zwischen den einzelnen „Perlen“ befinden sich Erkennungssequenzen, so genannte Promotoren. Hier können Enzyme binden, die das Erbgut ablesen und quasi eine Kopie des Bauplans für die Produktion von Proteinen anfertigen. Dieser Kopiervorgang heißt Transkription.
Ein Promotor gliedert sich in mehrere Teile, die zum Beispiel steuern, in welchen Zellen das nachfolgende Gen abgelesen werden soll. Der Teil, der unmittelbar vor dem abzulesenden Gen liegt, heißt Kernpromotor und ist von besonderer Bedeutung für den Start der Transkription. Prof. Ohler und seine Kollegen zeigten jetzt an menschlichen Zellen, dass dieser Kernpromotor nur in eine Richtung weist. Die Transkriptionsmaschinerie läuft von dort nur in eine Richtung und liest nicht auch noch den gegenläufigen DNA-Strang ab.
Wird auch der zweite Strang kopiert, beruht dies auf einem eigenen Kernpromotor. Dieser befindet sich in der gleichen Region wie der erste, weshalb Forscher bisher davon ausgingen, dass im Promoter die Richtung des Gens gar nicht festgelegt ist
Über die Hälfte der Promotoren ermöglicht nur Ablesen in eine Richtung
Mit Hilfe von Computerprogrammen und verschiedenen Analyseverfahren stellten Prof. Ohler und Kollegen fest, dass in der Tat etwa 40 Prozent der Gene zwei entgegengesetzte Kernpromotoren mit variablem Abstand besitzen. Durch die Kopie des gegenläufigen Stranges entsteht eine lange nicht-codierende RNA (lncRNA), also eine Kopie der DNA, die nicht in ein Protein übersetzt wird und deren Funktion bisher ungeklärt ist. Über die Hälfte der Promotoren weist jedoch nur die Erkennungssequenz für eine Richtung auf, nämlich die, in der das Gen liegt. Ein entgegengesetzter Kernpromotor sowie weitere Erkennungssequenzen für die Gegenseite fehlen hier.
Einfluss auf die Genregulation?
Ein Vergleich der verschiedenen Promotortypen ergab, dass sich die Struktur der „Perlenkette“ um sie herum unterscheidet. In den Nukleosomen ist die DNA auf Verpackungsspulen, so genannte Histone, aufgewickelt. Je nachdem, ob der Promotor eine Transkription in eine oder in beide Richtungen ermöglicht und ob auf der anderen Seite ein weiteres Gen liegt oder nicht, finden sich in den benachbarten Nukleosomen unterschiedliche Histone.
Da entgegengesetzte Kernpromotoren häufig, aber nicht universell vorkommen, vermuten die Forscher, dass diese dazu beitragen, die Transkription des Gens zu regulieren. So ist zum Beispiel denkbar, dass sie die lokale Konzentration an Transkriptionsfaktoren erhöhen. Ein Hinweis darauf ist, dass Gene, deren Promotoren Erkennungssequenzen für beide Richtungen aufweisen, häufiger abgelesen werden.
*Human Promoters Are Intrinsically Directional
investieren, leben, erkunden / 17.02.2015
Große Sportanlage im Ludwig-Hoffmann-Quartier geplant
Künftig wird das Angebot noch wachsen: Bis Ende 2016 entsteht eine attraktive Sportanlage im Ludwig Hoffmann Quartier. Seit Baubeginn im Jahr 2012 sind dort bereits 240 Wohnungen fertig gestellt worden, deren Zahl sich noch verdoppeln wird. Viele der hinzugezogenen Familien haben ihre Kinder bereits in den beiden neuen Schulen oder dem Kindergarten im Quartier untergebracht. Bis zu 2.000 Menschen werden hier leben, lernen und arbeiten.
"Unser Konzept geht über eine Turnhalle und einen Sportplatz für die Schulen hinaus. Wir errichten eine hochmoderne barrierefreie Halle, die auch für den Vereinssport und öffentliche Veranstaltungen konzipiert ist", erläutert Eigentümer und Projektentwickler Andreas Dahlke. Intelligent belüftet und beheizt, vom Tageslicht durchflutet und mit Blick auf den Park, wird die neue Halle auf drei Feldern Platz bieten. Für Wettkämpfe sind Zuschauerplätze geplant. Mit 1.200 Quadratmetern Gesamtfläche soll der Neubau zudem über ein Foyer und ein Bistro verfügen. Neben Umkleide- und Sanitärräumen wird es auch eine Sauna und einen Multifunktionsraum geben.
Im Außenbereich entsteht ein großzügiger Sportplatz mit Rängen für Zuschauer. Zusätzlich werden am Rand zwei Pavillons gebaut. In einem der kleinen Gebäude will sich eine Physiotherapeutin niederlassen.
Das Konzept kommt ganz Buch zugute, weshalb der künftige Name auch 'Bucher Sportanlagen' lautet. "Ich freue mich schon jetzt auf die Atmosphäre, wenn hier Spiele und Turniere stattfinden", so Andreas Dahlke.
Ansprechpartner für nähere Informationen:
Anne Kretschmar
0171 22 3000 5
anne.kretschmar@l-h-q.de
Holger Fritz
0171 28 400 56
info@bpi-immobilien.de
Foto: Die Sanierung im Ludwig Hoffmann Quartier ist weit gediehen, der Park schon an vielen Stellen rekonstruiert. Bereits 240 Wohnungen sind fertiggestellt worden. (Foto: Ludwig Hoffmann Quartier)
leben, heilen / 16.02.2015
Neuer Chefarzt Gefäßchirurgie im HELIOS Klinikum Berlin-Buch
„Ich freue mich, dass wir mit Dr. med. Guido Löhr einen anerkannten und erfahrenen Gefäßchirurgen als neuen Chefarzt gewinnen konnten, der das bestehende hohe Qualitätsniveau unserer gefäßchirurgischen Klinik noch weiter ausbauen wird“, sagt Klinikgeschäftsführer Dr. Sebastian Heumüller.
\nDr. med. Guido Löhr, 48, ist derzeit als Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie – vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie am Vivantes Klinikum Neukölln tätig und dort Sprecher des Zertifizierten Gefäßzentrums. Der gebürtige Westfale absolvierte seine gefäßchirurgische Ausbildung nach dem Studium an der Universität Heidelberg an der Universitätsklinik Köln und der Charité in Berlin. Als Experte für Gefäßchirurgie ist Dr. med. Löhr insbesondere auf die endovaskuläre Aortentherapie sowie die Behandlung chronischer Wunden und diabetischer Füße spezialisiert. Er hat zahlreiche wissenschaftliche Vorträge zu diesen Themen gehalten und ist u.a. Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin, der European Society for Vascular Surgery und im erweiterten Vorstand des Wundnetz Berlin-Brandenburg.
\nSein Vorgänger Dr. med. Zouheir Chaoui hat die Klinik für Gefäßchirurgie seit 1999 als Chefarzt geleitet. In Berlin-Buch tätig war er bereits seit 1990. Unter seiner Führung wurde das Leistungsspektrum der Klinik erfolgreich erweitert und auf die Zukunft ausgerichtet. Besonders hervorzuheben sind die Erfolge seiner Abteilung im Bereich der Venenbypässe bei Verschlüssen der peripheren Arterien, der Operationen an der Halsschlagader in Regionalanästhesie und Operationen der Bauchschlagader ohne Eröffnung der Bauchhöhle.
\n„Ich danke Dr. med. Chaoui für sein langjähriges engagiertes und erfolgreiches Wirken für unser Haus und die menschlich angenehme Zusammenarbeit und wünsche ihm beruflich wie privat alles Gute“, sagt Professor Dr. med. Josef, Ärztlicher Direktor des Klinikums Berlin-Buch.
\n
Klinikkontakt:
HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Klinik für Gefäßchirurgie
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
Tel. (030) 94 01-526 00
Über die HELIOS Kliniken Gruppe
Zur HELIOS Kliniken Gruppe gehören 110 eigene Akut- und Rehabilitationskliniken inklusive sieben Maximalversorger in Berlin-Buch, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Schwerin, Wuppertal und Wiesbaden, 49 Medizinische Versorgungszentren (MVZ), fünf Rehazentren, elf Präventionszentren und 15 Pflegeeinrichtungen. HELIOS ist damit einer der größten Anbieter von stationärer und ambulanter Patientenversorgung in Deutschland und bietet Qualitätsmedizin innerhalb des gesamten Versorgungsspektrums. Sitz der Unternehmenszentrale ist Berlin.
HELIOS versorgt jährlich mehr als 4,2 Millionen Patienten, davon mehr als 1,2 Millionen stationär. Die Klinikgruppe verfügt insgesamt über mehr als 34.000 Betten und beschäftigt rund 69.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2013 erwirtschaftete HELIOS einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro. Die Klinikgruppe gehört zum Gesundheitskonzern Fresenius.
Foto: Dr. med. Guido Löhr, Chefarzt der Klinik für Gefäßmedizin HELIOS Klinikum Berlin-Buch (ab dem 1.5.2015) (Fotocredit: Dr. Guido Löhr)
forschen / 16.02.2015
Krebs: Zuckermoleküle weisen den Weg
Zu den charakteristischen Eigenschaften von Zellen gehören nicht nur Gene und Proteine, sondern auch Glykane – komplexe Zuckerverbindungen, mit denen ihre Oberflächen gespickt sind. Insgesamt neun verschiedene Einzelzucker werden hierfür auf unterschiedlichste Art zu verzweigten Molekülen oder auch längeren Ketten verknüpft und an Proteine und Lipide gehängt. Noch steht die Biologie erst am Anfang, den „Glykan-Code“ zu entschlüsseln – doch schon länger ist bekannt, dass sich mit dem Einsetzen von Krebs oder Entzündungsprozessen auch die Struktur der Glykane auf den Zelloberflächen ändert. So findet man auf Tumorzellen beispielsweise vermehrt Sialinsäuren vor – und je mehr Sialinsäuren eine Krebszelle trägt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für die Bildung von Metastasen.
Die Glykanmuster auf den Zellen zu erforschen, ist allerdings alles andere als einfach. Ein wichtiger Durchbruch bestand darin, bestimmte Glykane mit Fluoreszenzfarbstoffen zu markieren und dann Zellkulturen oder auch kleine durchscheinende Organismen wie Zebrafische mittels Lichtmikroskopie zu untersuchen. Dagegen gab es bislang kaum Möglichkeiten, diese auch im Körper eines Säugetiers zu lokalisieren. „Schon seit Jahren gab es Versuche, mit bestimmten Zuckerbausteinen markierte Glykane auch durch Kontrastmittel im Kernspintomographen sichtbar zu machen, doch mit den herkömmlichen Methoden sind sie nicht aufspürbar, weil sie nicht selektiv genug markiert werden konnten“, sagt Chris Witte, einer der beiden Erstautoren der nun publizierten Arbeit. Mit der nun im renommierten Fachmagazin „Angewandte Chemie“ veröffentlichten Arbeit könnte sich das ändern: Darin gelang es den FMP-Forschern, in einem Modellsystem Zellen anhand markierter Sialinsäuren mittels Kernspintomographie zu lokalisieren. Möglich wurde dies durch die Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen von Christian Hackenberger und Leif Schröder, die beide an dem interdisziplinären Leibniz-Institut forschen.
Schon länger entwickelt der Physiker Leif Schröder dort die potentiell bahnbrechende Xenon-Kernspintomographie. Bei der herkömmlichen Kernspintomographie nutzt man die Eigenschaft von Wasserstoffatomen aus, in starken Magnetfeldern selbst zu winzigen Magneten zu werden, die dann mit Radiowellen in Resonanz treten können und so Signale aussenden. Die Xenon-Kernspintomographie dagegen setzt als Signalgeber hyperpolarisiertes Xenon Edelgas ein, das 100.000-fach stärkere Signale als Wasserstoff aussendet und in Kombination mit Biosensoren zum molekularen Spürhund wird. In einer Reihe von Veröffentlichungen hat Leif Schröder bereits das Potential dieser Methode für klinische Anwendungen demonstriert – Patienten könnten einmal Xenon inhalieren, das ungiftige Edelgas würde sich dann über den Blutkreislauf im Körper verteilen.
Durch die Zusammenarbeit mit dem Chemiker Christian Hackenberger ist nun klargeworden, dass sich die Xenon-Kernspintomographie auch dafür eignet, Glykane im undurchsichtigen größeren Organismus zu erforschen. Hackenberger setzte dafür Methoden der “bioorthogonalen Chemie” ein – damit bezeichnet man chemische Veränderungen an Biomolekülen, die in lebenden Zellen oder sogar in Tieren durchgeführt werden können. In dem Versuch erhielten die Zellen in Kulturschalen zunächst für einige Tage ein besonderes Nährmedium – es enthielt den gewöhnlichen Zucker Mannose, der aber durch eine Azidgruppe chemisch modifiziert war. Die so veränderte Mannose wird von den Zellen ganz normal verstoffwechselt und in Glykane wie Sialinsäuren eingebaut. Nun fügten die Forscher eine zweite Komponente hinzu: „Dieser molekulare Sensor reagiert quasi auf Knopfdruck und geht eine spezifische und feste Verbindung mit der Azidgruppe an der Sialinsäure ein“, erklärt die zweite Erstautorin Vera Martos. An diesen Sensor hatten die Chemiker wiederum ein käfigartiges Molekül geheftet, das Xenon-Atome einfängt. Das Resultat: Die markierten Zellen leuchteten im Xenon-Kernspintomographen auf und es entstanden Aufnahmen, in denen sich markierte Zellen von anderen deutlich im Kontrast abgrenzten – aufgenommen mittels Magnetfeld und Radiowellen. Zwar wurden die Zellen bisher nur in einer eigens gebauten Apparatur lokalisiert, die als Modell für ein Organ oder einen ganzen Organismus dient. Trotzdem zeigt das Experiment deutlich das Potenzial der Methode, die Glykanmuster auch in Versuchstieren wie beispielsweise in Mäusen zu orten. “Denkbar ist, dass wir die Entwicklung entarteter Zellen innerhalb der Tiere verfolgen werden”, spekuliert Leif Schröder. “Auf diese Weise könnte man einmal mehr über die Rolle der Glykane herausfinden.”\n
Über das Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie
Das Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) gehört zum Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB), einem Zusammenschluss von acht natur-, lebens- und umweltwissenschaftlichen Instituten in Berlin. In ihnen arbeiten mehr als 1.500 Mitarbeiter. Die vielfach ausgezeichneten Einrichtungen sind Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft. Entstanden ist der Forschungsverbund 1992 in einer einzigartigen historischen Situation aus der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR.
Grafik: Chemie trifft Physik – Mit der Xenon-Kernspintomographie können Glykane im MR-Tomographen (MRT) erforscht werden: An den Sensor, der mit der Azidgruppe an der Sialinsäure des Glykans reagiert, wurde ein käfigartiges Molekül geheftet, das Xenon-Atome einfängt. Die markierten Zellen leuchteten im Xenon-MRT auf und grenzen sich von anderen deutlich im Kontrast ab.
Visualisierung: Barth van Rossum
Kontakt:
Prof. Dr. Christian Hackenberger
Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP)
hackenbe (at) fmp-berlin.de
Tel.: 0049 30 94793-181
Dr. Leif Schröder
Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP)
lschroeder (at) fmp-berlin.de
Tel.: 0049 30 94793-121
Silke Oßwald
Öffentlichkeitsarbeit
Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP)
osswald (at) fmp-berlin.de
Tel.: 0049 30 94793-104
forschen / 14.02.2015
Forscher am FMP erhalten hochrangige Auszeichnungen des Europäischen Forschungsrates
Großer Erfolg für die Forscher am FMP:
Philipp Selenko erhält Fördermittel von fast zwei Millionen Euro über fünf Jahre für seine Forschung mit hochauflösender In-Cell NMR Spektroskopie. Die Forschungsgruppe untersucht die strukturellen und funktionalen Eigenschaften von Proteinen innerhalb von lebenden Zellen. Dabei ist die Gruppe besonders an den in höheren Eukaryoten stattfindenden biologischen Prozessen interessiert und nutzt dafür Modellsysteme von Xenopus laevis-Oozyten bis hin zu Säugetier-Zellkulturen.
In-Cell-NMR-Spektroskopie ermöglicht eine direkte Beobachtung von Proteinen „in Aktion“, also während sie ihre biologischen Funktionen ausüben. Sie kann mit einem „Mikroskop mit atomarer Auflösung“ verglichen werden. Philipp Selenko nutzt dies beispielsweise für das Studium von frühen Stadien neurodegenerativer Erkrankungen und beginnender Abnorm zellulärer Signalwege, die zu Krebs führen. Dabei gewinnt er neue mechanistische Einblicke in zuvor unbekannte zelluläre Aspekte dieser Krankheiten und eröffnet mit seinen Erkenntnissen neue Wege für die Wirkstoffforschung und therapeutische Interventionen.
Andrew Plested wird für seine Forschungen zum Glutamatrezeptor im Gehirn mit fast zwei Millionen Euro über fünf Jahre gefördert. Diese Rezeptoren sind essenziell für die Funktion unseres Gehirns und spielen eine wichtige Rolle bei Krankheiten wie Epilepsie sowie kognitiven und neurodegenerativen Störungen. Die Forschungsgruppe um Andrew Plested interessiert sich für den dynamischen Aufbau des schnellsten Rezeptors der Welt, des sogenannten AMPAR Receptors.
Plested und seine Mitarbeiter studieren hierbei insbesondere die Zusammensetzung und Eigenschaften der verschiedenen Untereinheiten bei Krankheit und im gesunden Zustand, da diese die synaptische Transmission im Gehirn maßgeblich bestimmen. So untersuchen die Forscher das Öffnen und Schließen einzelner Rezeptormoleküle mit feinsten Aufnahmemethoden durch sogenannte Einzelkanalmessungen. Ergänzend dazu wenden sie Röntgenstrukturanalysen und computergestütze Methoden an, um Erkenntnisse über die blitzschnelle Aktivierung des Rezeptors zu gewinnen.
Der Europäische Forschungsrat (European Research Council - ERC), finanziert durch das EU-Programm "Horizont 2020", fördert grundlagenorientierte Forschung. Bei den geförderten Projekten steht die wissenschaftliche Exzellenz der Person und der Projektidee im Vordergrund.
Über das Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie
Das Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) gehört zum Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB), einem Zusammenschluss von acht natur-, lebens- und umweltwissenschaftlichen Instituten in Berlin. In ihnen arbeiten mehr als 1.500 Mitarbeiter. Die vielfach ausgezeichneten Einrichtungen sind Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft. Entstanden ist der Forschungsverbund 1992 in einer einzigartigen historischen Situation aus der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR.\n
\n
Kontakt:
Dr. Philipp Selenko
Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP)
selenko (at) fmp-berlin.de
Tel.: 0049 30 94793-171
Dr. Andrew Plested
Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP)
plested (at) fmp-berlin.de
Tel.: 0049 30 9406 3071
leben, heilen / 12.02.2015
Eine Ära geht zu Ende - Das HELIOS Klinikum Berlin-Buch sagt danke, Herr Professor Zacher!
Professor Dr. med. Ralf Kuhlen, Geschäftsführer Medizin der HELIOS Kliniken Gruppe, sagt: „Wir zollen diesem Wunsch höchsten Respekt. Umso mehr freuen wir uns, dass Professor Zacher weiterhin, über seine Tätigkeit für Berlin-Buch hinaus, als Sprecher aller HELIOS Fachgruppenleiter tätig sein wird. Er wird den Schwerpunkt seiner weiteren beruflichen Tätigkeit dem Thema Qualitätsmedizin widmen und auch künftig ein wertvoller Berater auf Unternehmensebene für uns sein. Ich freue mich über den ausgezeichneten kollegialen Austausch.“
Enrico Jensch, Regionalgeschäftsführer der HELIOS Region Mitte-Nord, zu der das Bucher Klinikum gehört, würdigt den mittlerweile sechzigjährigen gebürtigen Niederbayern: „Unter Professor Zacher erfolgte 2007 der Umzug des Klinikums in den Neubau. Er führte 2010 die Orthopädie und die Unfallchirurgie erfolgreich zu einem Zentrum zusammen. In seinem Fokus standen und stehen immer unsere Patienten und eine hohe medizinische Qualität unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und medizinischen Weiterentwicklung unserer Klinik zum erfolgreichen und anerkannten Vollversorger in Berlin und dem angrenzenden Brandenburg. Dafür gilt ihm unser größter Dank!“
Als Autor/Coautor fallen mehr als 220 wissenschaftlichen Publikationen und Abstracts, 25 Bücher und 70 Buchbeiträge auf sein Konto. Er ist Hauptherausgeber der Zeitschrift „OrthoTraumaUp2Date“. Mehr als 900 Vorträge auf nationalen und internationalen wissenschaftlichen Veranstaltungen und auf Einladung in mehr als 40 Ländern zeugen von seiner hohen Reputation und von seinem immerwährenden Engagement für die Klinik und für seine berufliche Leidenschaft.
„Wir werden Professor Zacher schmerzlich vermissen! Seine Klarheit, sein strategisches Denken, seine immer ergebnisorientierte Arbeitsweise und sein großes Maß an Integrität waren für das Haus und für unsere Region immer sehr wertvolle und verlässliche Konstanten“, fasst Enrico Jensch zusammen.
Professor Dr. med. Zacher wird die Auswahl einer geeigneten chefärztlichen Nachfolge eng begleiten und ist mit der Wahl des neuen Ärztlichen Direktors der Klinik mehr als einverstanden: Professor Dr. med. Henning Baberg, Chefarzt der Klinik und Poliklinik für Kardiologie und Nephrologie im HELIOS Klinikum Berlin-Buch, übernimmt ab dem 1. Juli 2015 diese Position.
Der Klinikgeschäftsführer des HELIOS Klinikums Berlin-Buch, Dr. Sebastian Heumüller gratuliert: „Ich wünsche Professor Baberg viel Geschick und gutes Gelingen bei dieser wichtigen Aufgabe und freue mich auf die weiterhin erfolgreiche und gute Zusammenarbeit.“
Foto: (v.l.n.r.) Regionalgeschäftsführer Mitte-Nord, Enrico Jensch, Prof. Dr. med. Josef Zacher, Prof. Dr. med. Henning Baberg, Klinikgeschäftsführer Dr. Sebastian Heumüller (Fotocredit: HELIOS Kliniken, Thomas Oberländer)
_____________________________________________
forschen, leben, bilden / 12.02.2015
MINT400 – Das Hauptstadtforum des nationalen Excellence-Schulnetzwerks MINT-EC begeistert 400 junge Schülerinnen und Schüler in Berlin
Prof. Dr. Thomas Sommer, Direktor des Max-Delbrück-Centrums in Berlin begrüßt die Schülerinnen und Schüler und freut sich jetzt schon auf den interessierten MINT-Nachwuchs: "Die Biomedizin von morgen braucht die jungen Köpfe von heute. Wir freuen uns, dass so viele die kommenden zwei Tage am MDC verbringen werden. Ich hoffe, der Aufenthalt bei uns inspiriert sie zur Wahl einer Karriere in der biomedizinischen Forschung."
\nSylvia Löhrmann, nordrhein-westfälische Schulministerin und Vizepräsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) weiß sehr gut um die Bedeutung der MINT-Fächer, denn sie bilden das Fundament für spannende Berufe mit aussichtsreichen Zukunftschancen. Mark Rackles, Staatssekretär für Bildung in Berlin begrüßt die Schülerinnen und Schüler ebenfalls und weist mit einem gewissen Stolz auf insgesamt neun MINT-EC-Schulen im Land Berlin hin. "Mit fast 500 Teilnehmern aus unseren Netzwerkschulen in ganz Deutschland ist das Hauptstadtforum des MINT-EC unsere wichtigste Netzwerkveranstaltung", stellt Wolfgang Gollub, Vorstandsvorsitzender des MINT-EC fest. "Angesicht der sechs Fachvorträge und 35 wissenschaftlichen Exkursionsziele ist es definitiv auch die spannendste", so Gollub weiter.
\nDie MINT400 bietet ein spannendes Programm mit interessanten Fachvorträgen, einen MINT-Bildungsmarkt und eintägige Workshops in mehr als 30 Laboren, Forschungseinrichtungen und Unternehmen in Berlin und Brandenburg. Das Netzwerk, aus derzeit 212 zertifizierten Schulen mit rund 230.000 Schülerinnen und Schülern sowie 18.000 Lehrkräften steht seit 2009 unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK).
\nEin Science Slam, verschiedene Talkrunden und die Siegerehrung des Internationalen Chemiewettbewerbes runden die MINT400 ab. Als Netzwerkveranstaltung bietet die MINT400 die einmalige Chance, mit vielen anderen MINT-Interessierten aus ganz Deutschland, Österreich und der Türkei zusammenzutreffen, sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.
\nÜber den MINT-EC
\nMINT-EC, das nationale Excellence-Schulnetzwerk besteht aus derzeit 212 Schulen mit Sekundarstufe II und ausgeprägtem Profil in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Das Netzwerk – seit 2009 unter der Schirmherrschaft der KMK – fördert die länderübergreifende Zusammenarbeit der Schulen und bietet eine Vielzahl von Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen.
\nWeitere Informationen unter mint-ec.de/mint4002015-das-hauptstadtforum.html
Foto: Am Stand des Gläsernen Labors vom Campus Berlin-Buch auf dem MINT400-Forum. Laborleiterin Claudia Jacob (rechts) beantwortete Fragen zu Berufsbildern, zur Ausbildung und zu den Kursen in den Bereichen Genetik, Neurobiologie, Zellbiologie, Ökologie, Chemie und Physik. Der Campus bietet mit dem Programm "Labor trifft Lehrer" des Max-Delbrück-Centrums auch regelmäßig Fortbildungen für Lehrer. (Foto: Campus Berlin-Buch)
heilen / 10.02.2015
Hyperthermie - mit Wärme gezielt gegen Krebszellen
Das HELIOS Klinikum in Buch ist seit Jahren für seine überregionale Bedeutung in der Tumorbehandlung bekannt. Jetzt hat die Klinik für Strahlentherapie mit dem Interdisziplinären Zentrum für regionale Oberflächen- und Tiefenhyperthermie ihr Leistungsspektrum für die Behandlung von Krebspatienten erweitert und ein Hyperthermie-Behandlungsgerät der modernsten Generation in Betrieb genommen.
Der Begriff Hyperthermie stammt aus dem Griechischen und bedeutet „Überwärmung“. Der Chefarzt der Klinik für Strahlentherapie und Leiter des Interdisziplinären Zentrums für Hyperthermie, Prof. Dr. med. Robert Krempien, erläutert das Verfahren wie folgt: „Bei einer Hyperthermie-Behandlung wird das Krebsgewebe von außen mit Hilfe elektromagnetischer Wellen auf 42 bis 43 Grad Celsius erwärmt. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Krebszellen hitzeempfindlicher als gesunde Zellen sind und dass viele der aggressiven Zellen durch die Erwärmung absterben.“
Außerdem entstehen im Tumorgewebe sogenannte Hitzeschockproteine. Das sind Eiweißproteine, die das Immunsystem aktivieren, sogenannte Fress- und Killerzellen auszusenden, die den Tumor angreifen sollen.
Das Hyperthermie-Verfahren ist eine weitere wichtige Säule der von den Spezialisten der verschiedenen Fachbereiche des Onkologischen Zentrums im Bucher Klinikum durchgeführten komplexen Krebstherapien.
Die wärmebasierte Behandlung wird insbesondere bei lokal fortgeschrittenen, ausgedehnten oder wiedergekommenen Tumoren angewendet, da durch die hohen Temperaturen auch schlecht durchblutete Bereiche eines Tumors erreicht werden. Die Therapie wird bei den Patienten meistens parallel zu einer Chemo- oder Strahlentherapie angewendet, da sich die Wirkung dieser entscheidend verbessert.
„Wir sind stolz darauf, mit dem interdisziplinären Zentrum für regionale Oberflächen- und Tiefenhyperthermie das Behandlungsspektrum für Krebspatienten in unserem Klinikum um einen wesentlichen Baustein zu erweitern und so den Betroffenen eine noch komplexere und spezielle Versorgung zu ermöglichen“, sagt Klinikgeschäftsführer Sebastian Heumüller.
Klinikkontakt:
HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Klinik für Strahlentherapie
Chefarzt: Prof. Dr. med. Robert Krempien
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin
Telefon: (030) 94 01-520 00
E-Mail: robert.krempien@helios-kliniken.de
Foto: Das Team des Zentrums für regionale Oberflächen- und Tiefenhyperthermie im HELIOS Klinikum Berlin-Buch. V.l.n.r.: Dr. med. Julia Vlad, Leitende Oberärztin, Klinik für Strahlentherapie, Priv.-Doz. Dr. med. Peter Reichardt, Leiter Onkologisches Zentrum, Prof. Dr. med. Robert Krempien, Chefarzt der Klinik für Strahlentherapie und Leiter des Interdisziplinären Zentrums für Hyperthermie, Dipl.-Ing. Hubert Michel, Medizinphysiker, Klinik für Strahlentherapie HELIOS Klinikum Berlin-Buch (Foto: Thomas Oberländer/ HELIOS Kliniken GmbH)
leben, bilden / 08.02.2015
Über 13.500 Schüler besuchten das Gläserne Labor in 2014
Der Forschergarten des Gläsernen Labors erreichte 21.857 Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter mit seinen naturwissenschaftlichen Angeboten.\n
Foto: Herstellung eines Nylonfadens beim Kunststoffkurs im ChemLab des Gläsernen Labors. (Peter Himsel / Campus Berlin-Buch)
leben, bilden / 02.02.2015
Teilnehmer für Jugendaustausch Pankow - Tel Aviv gesucht
Die Kosten betragen ca. 150 Euro für Berlin und ca. 350 Euro für die Reise nach Israel sowie Taschengeld.
\nFragen und Anmeldungen bei Bettina Pinzl, Tel. 0173/2608349, Mail: urova@web.de und Tanja Berg, Tel: 030/22396185, E-Mail: taberg@gmx.de.
forschen, produzieren, leben, heilen / 30.01.2015
Campus Berlin-Buch feiert Neujahrsempfang
Weitere Informationen:
Silke Oßwald
Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie
Robert-Rössle-Straße 10 13125 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 94 973 104 E-mail: osswald@fmp-berlin.de www.fmp-berlin.de
Foto: (v.l.n.r.) Dr. Ulrich Scheller, Geschäftsführer der Campusbetreibergesellschaft BBB Management GmbH, Prof. Dr. Helmut Kettenmann, Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) Berlin-Buch, Prof. Dr. Dr. Gerhard Roth, Festredner von der Universität Bremen und Prof. Dr. Volker Haucke, Direktor des Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP). (Peter Himsel/Campus Berlin-Buch)
heilen / 28.01.2015
Neue Ausstellung "Sandwelten"
Bilder gestalten ist seit vielen Jahren ein Hobby des dreiundvierzigjährigen Berliners. Auf die Frage nach dem Material seiner Arbeiten antwortet er: „Es ist Sand! Sand auf Leinwand, den ich mit einem speziellen Bindemittel vermische und modelliere. Nach zwei- bis viertägiger Trockenzeit bemale ich meine Bilder mit Acrylfarbe. Meist gibt es pro Bild zwei bis drei Anstriche, damit die Farben gut decken und das Bild kräftig erstrahlt. Die Farbübergänge erarbeite ich mir ausschließlich mit unterschiedlichen Pinselstärken“.
Der gelernte Offsetdrucker arbeitet seit zehn Jahren mit unterschiedlichsten Techniken und Natur-Materialien, insbesondere mit Sand, aber auch Ton, Holz und Muscheln. Durch gezielt eingesetzte Strukturen entstehen je nach Lichteinfall immer wieder faszinierende Eindrücke. Seine Anregungen sucht er in Geschichtsbüchern. Besonders beeindrucken ihn Schriftzeichen, Symbole und fossile Abdrücke.
Die Ausstellung wird im Foyer des HELIOS Klinikums Berlin-Buch Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin, täglich rund um die Uhr bis April 2015 gezeigt. Weitere Informationen zu Frank Walter unter www.sandwelten.com
\n
Foto: Frank Walter vor seiner Arbeit (Fotocredit: Frank Walter)
\nforschen / 27.01.2015
Baustart für Labor
Vor wenigen Tagen haben die ersten Arbeiten an der Baustelle des In vivo-Pathophysiologielabors (IPL) in Berlin-Buch begonnen. Das IPL ist ein Ersatzneubau für ein älteres Tierhaus des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin (MDC) und wird Platz für bis zu 4.000 Maus- und Rattenkäfige beziehungsweise für etwa 12.000 Tiere bieten. In dem Gebäude werden außerdem Laborräume entstehen. Das Hauptaugenmerk bei den Tierversuchen wird im IPL auf minimal-invasiven, also wenig belastenden Methoden liegen. Dazu zählen zum Beispiel modernste bildgebende Verfahren wie MRT oder PET-Scans.
Derzeit wird das Baufeld auf dem südlichen Teil des Campus Berlin-Buch gerodet. Für die zu fällenden Bäume und für die geplante Bodenversiegelung erhielten der Bezirk Pankow und die Berliner Forsten Ausgleichszahlungen von insgesamt rund 350.000 Euro. Die Fertigstellung des IPL ist für das Jahr 2017 geplant. Die Baukosten betragen insgesamt rund 24 Millionen Euro (netto). Aufgrund des Helmholtz-Finanzierungsschlüssels von 90 Prozent Bundesanteil trägt damit der Bund den Großteil der Kosten.
Zur Notwendigkeit von Tierversuchen sagt Prof. Dr. Thomas Sommer, kommissarischer Vorstandsvorsitzender des MDC: „Bei uns am MDC, wie auch in anderen biomedizinischen Forschungseinrichtungen, arbeiten wir meistens mit Zell- oder Gewebekulturen und einfachen Organismen, etwa Hefen oder Fadenwürmern. Wir wollen damit biochemische Vorgänge, Signalübertragung oder Details der Genaktivität aufklären. Tierversuche haben bei unserer Arbeit aber eine Schlüsselfunktion, denn nur im Tierversuch können wir die Bedeutung dieser Details für den gesamten Organismus erkennen.“
Sommer ist sich mit den führenden Forscherinnen und Forschern weltweit einig, dass Tierversuche unverzichtbar sind, um die Grundlagen des Lebens zu verstehen und Fortschritte in der Medizin zu erreichen. Wichtige Therapien und Biomarker, die eine zentrale Rolle in der Diagnostik spielen, wären ohne Tierversuche nicht entdeckt und entwickelt worden. Das gilt auch in der Krebsmedizin, in der bedeutende Fortschritte erzielt wurden. In den vergangenen Jahrzehnten sind die Heilungsraten bei manchen Krebsformen von 60 auf 80 oder 90 Prozent gestiegen, beispielsweise bei Leukämie bei Kindern.
Bei allen Tierversuchen gilt das „3-R-Prinzip“ als ethische Leitlinie. Die drei R stehen für die englischen Begriffe reduce, refine und replace, zu Deutsch: vermindern, verfeinern, ersetzen. Das heißt, die Forscherinnen und Forscher wenden Methoden an, bei denen sie ein Minimum an Tieren einsetzen, um ihre wissenschaftliche Fragestellung zu klären, sie verbessern ihre Untersuchungsmethoden so, dass die Tiere möglichst wenig belastet werden; und sie verwenden wenn irgend möglich Ersatzmethoden für Tierversuche. Über die Einhaltung der 3-R-Prinzipien und das Wohlergehen der Tiere wachen am MDC fünf Tierschutzbeauftragte.
Das MDC ist eine der größten biomedizinischen Forschungseinrichtungen Berlins. Im Jahr 2013 wurden am MDC 147.985 Versuchstiere verbraucht, davon waren 142.769 Mäuse. 2012 waren es 154.647 Tiere, die genutzt wurden (davon 148.561 Mäuse). Eine genaue Aufschlüsselung der Zahlen und Tierarten findet sich auf den Webseiten des MDC unter
https://www.mdc-berlin.de/37201971/de/about_the_mdc/science_and_society/forschun... Dort ist auch die Entwicklung der Zahlen über die vergangenen vier Jahre dokumentiert.\n
Weiterführende Informationen zu Tierversuchen in Berlin:
https://insights.mdc-berlin.de/de/2014/07/mit-transparenz-gegen-misstrauen/
Das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) auf dem biomedizinischen Campus in Berlin-Buch ist ein Zentrum der Helmholtz-Gemeinschaft. Es beschäftigt derzeit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfügt über einen Gesamtetat von 103 Millionen Euro. Es gibt rund 70 Forschungsgruppen am MDC, die in den Schwerpunkten Krebs, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, neurologische Erkrankungen sowie medizinische Systembiologie arbeiten.
\n
Weitere Informationen:
Weiterführende Informationen zu Tierversuchen in Berlin:
https://insights.mdc-berlin.de/de/2014/07/mit-transparenz-gegen-misstrauen/
Abbildung: Architekturzeichnung des geplanten In vivo-Pathophysiologielabors.
Abb.: MDC
forschen / 26.01.2015
Helmholtz International Fellow Award für britische Zellbiologin Prof. Amanda Fisher – Kooperation mit Max-Delbrück-Centrum
Im Mittelpunkt der Forschungen von Prof. Fisher steht die Genregulation, ein fundamentaler Lebensprozess, der jede biologische Funktion einschließlich der Zellteilung, Zelldifferenzierung und Regeneration steuert. Prof. Fisher, die seit den 1980er Jahren in der Forschung tätig ist, hat sich auf diesem Gebiet international einen Namen gemacht. Dazu gehören ihre grundlegenden Erkenntnisse über den Krankheitsmechanismus des AIDS-Virus HIV und über die Regulation einiger HIV-Gene. Prof. Fisher gilt auch als Expertin für die epigenetische Genregulation, bei der molekularbiologische Informationen, die nicht in der DNA enthalten sind, bestimmen, welche Gene angeschaltet werden und welche stumm bleiben. Sie arbeitet auch über die Entwicklung der T-Zellen des Immunsystems und über embryonale Stammzellen.
Prof. Fisher leitet das MRC (Medical Research Council) Clinical Sciences Centre (CSC), das Teil des Institute for Clinical Sciences (ICS) am Imperial College London ist. Darüber hinaus ist sie Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung/Berlin Institute of Health (BIH), welches das MDC und die Charité – Universitätsmedizin Berlin 2013 gegründet haben. Diese Einrichtungen wollen innovative biomedizinische Forschung in die klinische Forschung übertragen und verfolgen auch einen ganzheitlichen, systemmedizinischen Forschungsansatz.
Für ihre außerordentlichen Verdienste in der biomedizinischen Forschung wurde Prof. Fisher 2014 zum Mitglied der Royal Society gewählt. 2010 erhielt sie den „Women of Outstanding Achievement in SET (Science, Engineering & Technology) Award“, 2003 wurde sie zum Mitglied der Akademie der Medizinischen Wissenschaften von Großbritannien gewählt und 2002 erhielt sie die Goldmedaille der Europäischen Molekularbiologischen Organisation (EMBO).
Zusammen mit den Preisträgern dieser Auswahlrunde haben seit 2012 inzwischen 43 Fellows den Helmholtz International Fellow Award erhalten.
\n
Photo: Prof. Amanda Gay Fisher (Photo/ Copyright: Imperial College, London)
leben, heilen / 21.01.2015
Festlicher Neujahrsempfang auf dem Bucher Stadtgut
Am 18. Januar 2015 fand der traditionelle Neujahrsempfang des HELIOS Klinikums Berlin-Buch in der Feste Scheune des Stadtguts Buch (ehem. Künstlerhof Buch) statt.
Enrico Jensch, Regionalgeschäftsführer der HELIOS Region Mitte-Nord, hob die Bedeutung des Bucher Klinikums als Maximalversorger im Verbund der nun 13 Kliniken umfassenden HELIOS Region Mitte-Nord hervor: „Wir freuen uns sehr, mit Berlin-Buch in unserer Region einen erfolgreichen, engagierten und leistungsstarken Partner zu haben.“ Prof. Dr. med. Josef Zacher, Ärztlicher Direktor des Klinikums, ging in einem Rückblick auf das Erreichte des Jahres 2014 ein. Er hob dabei als wichtige Meilensteine die Zertifizierung des Onkologischen Zentrums sowie die Etablierung der Diabetologie und Endokrinologie hervor.
Dr. med. Sebastian Heumüller, seit dem 1. Januar 2015 Klinikgeschäftsführer des HELIOS Klinikums Berlin-Buch, stellte sich den Gästen vor. Dr. Heumüller, der seit 2009 bei HELIOS arbeitet, war Klinikgeschäftsführer in den HELIOS Kliniken Bad Gandersheim, Northeim und von 2013 bis Ende 2014 in Berlin-Zehlendorf.
Dr. Heumüller begrüßte die neuen Chefärzte der Klinik für Urologie, Professor Dr. med. Mark Schrader, und Professor Dr. med. Frank Kolligs, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie. und gab einen Ausblick auf das Jahr 2015.
„Ich bedanke mich für das dem Klinikum entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die Zusammenarbeit in Berlin-Buch. Die hohe Qualität in der Medizin, Pflege und im Service sowie die bestmögliche Versorgung der Patienten in Berlin und im Brandenburger Umland stehen für mich 2015 ganz besonders im Fokus“, sagte Heumüller.
Musikalisch wurde der festliche Empfang von der Damen-Swing-Band „Le Belle du Swing“ begleitet. Die Kinder der Gäste hatten bei dem speziell für sie gebotenen Programm mit Clowns, lustigen Spielen und Zirkusartistik viel Spaß.
Über die HELIOS Kliniken Gruppe
Zur HELIOS Kliniken Gruppe gehören 110 eigene Akut- und Rehabilitationskliniken inklusive sieben Maximalversorger in Berlin-Buch, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Schwerin, Wuppertal und Wiesbaden, 49 Medizinische Versorgungszentren (MVZ), fünf Rehazentren, elf Präventionszentren und 15 Pflegeeinrichtungen. HELIOS ist damit einer der größten Anbieter von stationärer und ambulanter Patientenversorgung in Deutschland und bietet Qualitätsmedizin innerhalb des gesamten Versorgungsspektrums. Sitz der Unternehmenszentrale ist Berlin.
HELIOS versorgt jährlich mehr als 4,2 Millionen Patienten, davon mehr als 1,2 Millionen stationär. Die Klinikgruppe verfügt insgesamt über mehr als 34.000 Betten und beschäftigt rund 69.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2013 erwirtschaftete HELIOS einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro. Die Klinikgruppe gehört zum Gesundheitskonzern Fresenius.
Foto: (v.l.n.r.) Prof. Dr. med. Josef Zacher, Ärztlicher Direktor HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Dr. Sebastian Heumüller, Klinikgeschäftsführer HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Sylvia Lehmann, Pflegedienstleiterin, HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Volker Wenda, Vorsitzender Bucher Bürgerverein, Dr. Ulrich Scheller, Geschäftsführer BBB Management GmbH Campus Berlin-Buch (Fotocredit: Thomas Oberländer/ HELIOS Kliniken GmbH)
heilen / 20.01.2015
Willkommen Professor Frank Kolligs im HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Er folgt auf Professor Dr. med. Herbert Koop, der nach 20 Jahren in den Ruhestand verabschiedet wurde.
Die fachlichen Schwerpunkte der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie liegen in der Gastroenterologie (Erkrankungen des Magen-Darmtraktes) und der Hepatologie (Erkrankungen von Leber und Gallenwege) einschließlich chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen und chronischer Entzündungen der Leber und der Leberzirrhose. Ein besonderer Fokus der Endoskopieabteilung ist die Früherkennung und die Therapie von Vorstufen und Frühformen von Krebserkrankungen der Verdauungsorgane und die Behandlung von Erkrankungen der Gallenwege.
Besonders wichtig ist die Behandlung gastroenterologischer Krebserkrankungen. In enger Zusammenarbeit mit den anderen Kliniken des HELIOS Klinikums Berlin-Buch erfolgt hier eine individuell auf den Patienten abgestimmte Diagnostik und Therapie.
Professor Dr. med. Kolligs ist insbesondere auf den Gebieten Darmkrebs und Leberkrebs anerkannter Experte. Er arbeitet seit vielen Jahren wissenschaftlich und ist Mitglied der entsprechenden Leitlinienkonferenzen der Fachgesellschaften. „Für mich ist die interdisziplinäre Therapie, also der enge Austausch aller Fachdisziplinen des Onkologischen Zentrums wie zum Beispiel in den gemeinsamen Tumorkonferenzen, ein Garant für die optimale Behandlung unserer Patienten“, sagt der Chefarzt.\n
Professor Dr. med. Frank Kolligs (48) stammt aus dem Ruhrgebiet. Er hatte zuletzt eine Professur am Klinikum der Universität München inne, arbeitete dort Leitender Oberarzt und leitete das interdisziplinäre Darmkrebszentrum. Von 2006 bis 2014 war er stellvertretender Vorsitzender der Projektgruppe „Gastrointestinale Tumore“ des Tumorzentrums München der Ludwig Maximilians Universität und der Technischen Universität München. Davor war er an der Universität Marburg und der University of Michigan, USA, klinisch und wissenschaftlich tätig. Professor Dr. med. Kolligs hat zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, ist Mitherausgeber wissenschaft-licher Fachzeitschriften und ist Mitglied mehrerer Fachgesellschaften, z.B. der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie (DGVS) und der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG).
„Wir freuen uns, mit Professor Kolligs einen ausgewiesenen Spezialisten und erfahrenen Mediziner in unserem Klinikum zu begrüßen, der das bestehende hohe Qualitätsniveau unserer gastroenterologischen Klinik noch weiter ausbauen wird“, sagt Geschäftsführer Dr. Sebastian Heumüller.
Veranstaltungshinweis:
Am Dienstag, den 27. Januar 2015, hält Professor Dr. med. Kolligs im Rahmen der Chefarztvortragsreihe einen Vortrag zum Thema „Vorsorge und Früherkennung von Speiseröhren-, Magen-, Darm- und Lebertumoren - was ist möglich, was sinnvoll?“
Grundsätzlich gilt: Je früher ein Tumor entdeckt wird, desto besser kann er behandelt werden.
So erkranken deutschlandweit jährlich etwa 68.000 Menschen an Darmkrebs. In den meisten Fällen entsteht dieser aus gutartigen Polypen.
Zur Vorsorge dient hier eine Darmspiegelung, bei der diese Polypen festgestellt und entfernt werden, um die Weiterentwicklung zu Darmkrebs zu verhindern. Auch in der Speiseröhre und im Magen können Vorstufen und Frühformen von Krebs endoskopisch entdeckt und entfernt werden. Risikofaktoren für Leberkrebs sind chronische Leberentzündungen und die Leberzirrhose. Mittels Ultraschall können Leberkrebsherde frühzeitig erkannt werden.
In seinem Vortrag gibt er einen Überblick über die heute gültigen Empfehlungen zur Vorsorge und Früherkennung von Tumoren des Verdauungstraktes und der Leber. Darüber hinaus erläutert er, wie bei der Diagnose einer solchen Tumorerkrankung in interdisziplinärer Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbereiche ein individuelles, auf den einzelnen Patienten zugeschnittenes Behandlungskonzept, erstellt wird.
Im Anschluss steht Professor Dr. med. Kolligs für Fragen zur Verfügung.
HELIOS Chefarztvortrag
Dienstag 27. Januar 2015
Beginn um 18 Uhr
Veranstaltungsort:
HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Konferenzraum Cafeteria
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
Eintritt frei /Anmeldung nicht erforderlich
Klinikkontakt:
HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie
Chefarzt: Prof. Dr. med. Frank Kolligs
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
Tel. (030) 94 01-526 00
E-Mail: frank.kolligs@helios-kliniken.de
\n
Foto: Prof. Dr. med. Frank Kolligs, Chefarzt Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie (Thomas Oberländer/ HELIOS Kliniken GmbH)
heilen / 16.01.2015
Priv.-Doz. Dr. med. Christian Wrede, Chefarzt des Interdisziplinären Notfallzentrums im HELIOS Klinikum Berlin-Buch zum Professor ernannt
„Wir gratulieren zur Ernennung und sind stolz darauf, mit Professor Dr. med. Wrede einen erfahrenen Mediziner und ausgewiesenen Spezialisten auf dem Gebiet der Notfallmedizin in unserem Klinikum zu haben“, sagt Dr. Sebastian Heumüller, Geschäftsführer des HELIOS Klinikums Berlin-Buch.
Nach seinem Studium und dem Abschluss der Facharztausbildung mit den Zusatzbezeichnungen Intensivmedizin und Notfallmedizin war Professor Dr. med. Christian Wrede Oberarzt und Leiter der internistischen Intensivstation und Notaufnahme am Universitätsklinikum Regensburg. Er ist Mitglied in vielen Organisationen und Gremien, so unter anderem seit November 2014 Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin (DGINA). Seit 2014 ist Professor Wrede Herausgeber von „Notfall- und Rettungsmedizin“, der führenden deutschsprachigen wissenschaftlichen Fachzeitschrift auf diesem Gebiet.
Professor Dr. med. Wrede ist seit 2009 Chefarzt des interdisziplinären Notfallzentrums mit Rettungsstelle im HELIOS Klinikum Berlin-Buch.
„Dringlich behandlungsbedürftige Patienten werden im Notfallzentrum schnell identifiziert und einer Behandlung nach aktuellen wissenschaftlichen Standards zugeführt“, sagt Prof. Dr. med. Wrede. „Da viele Patienten auch mit Beschwerden kommen, die nicht eindeutig einer bestimmten Fachdisziplin zuzuordnen sind, legen wir größten Wert auf eine fachübergreifende Sichtweise des Patienten und führen regelmäßige Weiterbildungen unserer Mitarbeiter durch“, so der Experte weiter.
Klinikkontakt: \n
HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Interdisziplinäres Notfallzentrum mit Rettungsstelle
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin
Chefarzt: Prof. Dr. med. Christian Wrede
Telefon: (030) 94 01-54700
E-Mail: christian.wrede@helios-kliniken.de
www.helios-kliniken.de/berlin-buch
Foto: Prof. Dr. med. Christian Wrede, Chefarzt Interdisziplinäres Notfallzentrum mit Rettungsstelle HELIOS Klinikum Berlin-Buch (HELIOS/Thomas Oberländer)
forschen / 13.01.2015
Bakterien mit Skelett: Struktur von Bactofilin aufgeklärt
Bakterien galten lange als äußerst primitive Lebensformen – sie sind im Vergleich zu den Zellen höherer Lebewesen viel kleiner und erscheinen unter dem herkömmlichen Lichtmikroskop weitgehend unstrukturiert. Doch seit Zellbiologen mit modernen bildgebenden Verfahren zu immer feineren Strukturen vordringen können, wird klar, dass die Winzlinge in Wahrheit von komplexen Architekturen durchzogen sind. Lange Zeit ging man davon aus, dass Bakterien über keinerlei stabilisierendes Zytoskelett verfügen, wie man es bei den moderneren Zellen der Tiere und Pflanzen findet.
Inzwischen aber hat man nicht nur die analogen Elemente zu den bereits bekannten Zytoskelett-Bausteinen gefunden, sondern sogar Skelettelemente, die exklusiv im Reich der Bakterien vorkommen.
Eines dieser neuen Elemente hat nun Adam Lange mit seinem Team in Zusammenarbeit mit der Gruppe um Martin Thanbichler von der Philipps-Universität Marburg genauer erforscht. Es handelt sich um das Protein Bactofilin, das 2010 von Martin Thanbichler entdeckt wurde und das weit verbreitet in verschiedenen Bakterienarten vorkommt. Beispielsweise bildet Helicobacter pylori mit Hilfe von Bactofilin seine typische schraubenförmige Gestalt aus. Die Bakterien können sich so in die schützende Schleimschicht der Magenschleimhaut bohren – sie sind hier vor der ätzenden Magensäure geschützt und verursachen einen Großteil der Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre beim Menschen.
Generell lagern sich Baktofilin-Moleküle zu Filamenten zusammen, aus denen dann wiederum unterschiedliche höhergeordnete Strukturen entstehen können. Ihre Polymerisierung findet auch im Reagenzglas statt, was die Strukturaufklärung zu einer besonderen Herausforderung macht, denn Proteine, die sich weder in Flüssigkeiten lösen lassen noch Kristalle bilden, sind mit den gängigen Methoden nur schwer zu untersuchen. Für die Strukturaufklärung des Bactofilins wandte Adam Lange daher die noch relativ neue Technik der Festkörper-NMR an, die in den letzten zehn Jahren so weit entwickelt wurde, dass man damit auch komplexe Biomoleküle untersuchen kann. NMR steht für „Nuclear magnetic resonance“, auf Deutsch Kernspinresonanz. Das Besondere an der Festkörper-NMR besteht darin, dass die Probe in einem starken Magnetfeld sehr schnell rotiert werden muss, um die Bewegungen gelöster Moleküle zu simulieren.\n
Mittels der NMR-Technologie fand Langes Team heraus, dass die einzelnen Bactofilin-Moküle sich spiralförmig zu einer sogenannten Beta-Helix aufdrehen und sich dann Molekül für Molekül zu Filamenten aneinanderreihen. Stabilisiert wird dieses Strukturmotiv durch wiederkehrende hydrophobe Bereiche, die in den Bactofilin-Molekülen evolutionär konserviert wurden. Die äußerst feinen Protofilamente können sich dann weiter zu dickeren Bündeln oder auch gewebeartigen Strukturen zusammenlagern. Eine solche Beta-Helix hat man bislang noch bei keinem anderen Zytoskelett-Element gefunden – dafür aber interessanterweise bei dem Prionen-Protein HET-s, das in Pilzen vorkommt.
Mit dieser Arbeit fängt für uns die Erforschung des Bactofilins erst an“, sagt Adam Lange. „Wir wollen nun die Struktur weiter bis ins atomare Detail verfeinern.“ Die Erforschung des bakteriellen Zytoskeletts bietet dabei nicht nur einen spannenden Einblick in die Formenvielfalt der evolutionär gesehen erfolgreichsten Gruppe der Organismen, sondern ist auch medizinisch relevant. Zunehmend werden Antibiotika gegen Krankheitserreger durch Resistenzen wirkungslos – so auch bei Helicobacter pylori, dem Verursacher der Magengeschwüre. „Da Bactofilin ausschließlich in Bakterien vorkommt, ist es ein interessanter Ansatzpunkt für die Entwicklung dringend benötigter neuartiger Wirkstoffe“, sagt Adam Lange.
Vasa S, Lin L, Shi C, Habenstein B, Riedel D, Kühn J, Thanbichler M, Lange A. β-Helical architecture of cytoskeletal bactofilin filaments revealed by solid-state NMR. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Dec 30. pii: 201418450.
Kontakt
Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP)
Prof. Dr. Adam Lange
alange@fmp-berlin.de
Tel.: 0049 30 94793-191
Silke Oßwald (Öffentlichkeitsarbeit)
osswald@fmp-berlin.de
Tel.: 0049 30 94793-104
Foto: Helicobacter pylori bacterium (© royaltystockphoto, Fotolia)
leben, erkunden / 12.01.2015
Portraitabend mit Sebastian Weigle in der Bucher Schlosskirche
am 6. Februar 2015 in der Schlosskirche Berlin-Buch.
Der Förderverein Kirchturm Buch e.V. präsentiert einen Abend mit Professor Sebastian Weigle, Generalmusikdirektor an der Oper Frankfurt/Main im Gespräch mit Cornelia de Reese, freie Musikredakteurin im Kulturradio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Sebastian Weigle ist in Berlin-Buch als Sohn des bekannten Kirchenmusikers Gottfried Weigle geboren und aufgewachsen. Er fühlt sich seinem Geburtsort sehr verbunden und engagiert sich trotz starker beruflicher Belastungen als Mitglied des Kuratoriums des Fördervereines Kirchturm Buch e.V. für den Wiederaufbau des Turmes der kriegszerstörten barocken Schlosskirche in Buch. Zur Zeit leitet er Aufführungen der Opern „Zauberflöte“ und „Freischütz“ an der Berliner Staatsoper.
Am 6. 2. 2015 ist er um 16:10 Gast beim Kulturradio vom RBB. Danach wird Cornelia de Reese im Gespräch mit ihm und an Hand von Musikbeispielen in der Bucher Schlosskirche den bisherigen künstlerischen Lebensweg von Sebastian Weigle nachzeichnen. Dazu singt der Chor der Schlosskirche Choralsätze von J.S.Bach.\n
Der Förderverein lädt herzlich zu dieser Veranstaltung ein. Eintritt frei. Spenden sehr willkommen.
\n\n
Beginn: 19 Uhr, Schlosskirche Berlin-Buch, Alt Buch 36, 13125 Berlin
\n
Foto: GMD Prof.Sebastian Weigle
\n
forschen, leben, heilen / 12.01.2015
Post von der Nationalen Kohorte
Die Briefaktion wird gemacht, weil an der Studie nur teilnehmen kann, wer ein Einladungsschreiben von einem der bundesweit 18 NAKO-Studienzentren erhält. Die Auswahl der Angeschriebenen erfolgt nach dem Zufallsprinzip anhand von Adressen, die die Forscher von den Einwohnermeldeämtern bekommen haben. Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Die Untersuchungen können nur mit Einwilligung der Studienteilnehmer erfolgen, die ihre Teilnahme jederzeit wieder zurückziehen können.
Über einen Zeitraum von fünf Jahren werden im Rahmen der NAKO bundesweit 200 000 Menschen zwischen 20-69 Jahren untersucht und anschließend bis zu 30 Jahre nachbeobachtet. 30 000 Menschen sollen in Berlin und den angrenzenden Regionen Brandenburgs in den drei Berliner Studienzentren untersucht werden. Davon sollen allein vom Studienzentrum Nord auf dem Campus Berlin-Buch 10 000 Teilnehmer aus dem Nordberliner Raum und Brandenburg für eine Teilnahme gewonnen werden.
Das Studienzentrum Berlin-Nord auf dem Campus Berlin-Buch ist außerdem eines von bundesweit insgesamt fünf Studienzentren der NAKO, die über einen Magnetresonanz-Tomographen (MRT) verfügen. Der MRT befindet sich in der Berlin Ultrahigh Field Facility am MDC in Berlin-Buch, die von Prof. Thoralf Niendorf geleitet wird. Radiologinnen vor Ort sind Dr. Beate Endemann und Dr. Andrea Hasselbach. In Berlin-Buch sollen 6 000 der 30 000 Berliner und Brandenburger Studienteilnehmer eine Ganzkörper-MRT-Untersuchung erhalten. Bundesweit sollen insgesamt
30 000 der 200 000 Studienteilnehmer eine MRT-Untersuchung bekommen.
Generell werden die Teilnehmer in allen Studienzentren dieser Bevölkerungsstudie nach ihren Lebensgewohnheiten wie etwa körperliche Aktivität, Rauchen, Ernährung, Beruf, befragt und anschließend medizinisch untersucht. Ihnen werden unter anderem Blutproben entnommen, die zur späteren Beantwortung der Forschungsfragen der NAKO in Biobanken gelagert werden, Körpergröße, Körpergewicht und Körperfettverteilung gemessen sowie Blutdruck und Herzfrequenz. Diese Basisuntersuchung dauert etwa 3 Stunden. Ein Teil der Studienteilnehmer erhält darüber hinaus zusätzliche Untersuchungen, wie EKG, Echokardiographie oder Netzhautuntersuchung. Diese Untersuchungen dauern etwa 1,5 Stunden. Hinzu kommt eine MRT-Untersuchung, deren Daten in einer MRT-Bilddatenbank erfasst werden. Mit diesen Daten wollen die Forscher unter anderem Einblick in klinisch noch nicht erkennbare Erkrankungen gewinnen.
Fünf Jahre nach der ersten Untersuchung werden die Probanden zur Nachuntersuchung gebeten. Die Forscher erfassen dann bei den Studienteilnehmern eventuell aufgetretene Erkrankungen und vergleichen die Untersuchungsergebnisse mit den bereits erhobenen Daten. Die Forscher erwarten sich von dieser Vorgehensweise mehr über Ursachen und Risikofaktoren für die in Deutschland häufigen chronischen Krankheiten – Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes, Lungenerkrankungen, Krebs, neurodegenerative und psychiatrische Erkrankungen sowie Infektionskrankheiten – herauszufinden.
Bisher sind in den drei Studienzentren der NAKO für Berlin und Brandenburg seit Beginn der Studie 2014 bereits 1 473 Studienteilnehmer untersucht worden. Von ihnen erhielten 259 zusätzlich eine MRT-Untersuchung.
Initiiert haben die NAKO die Helmholtz-Gemeinschaft, zu der das MDC gehört, Universitäten, die Leibniz-Gemeinschaft sowie Einrichtungen der Ressortforschung. Finanziert wird die Langzeitbevölkerungsstudie vom Bundesforschungsministerium, den 14 beteiligten Bundesländern und der Helmholtz-Gemeinschaft. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 210 Millionen Euro.\n
Weitere Informationen:
www.nationale-kohorte.de
insights.mdc-berlin.de/de/2014/08/auf-den-zahn-gefuehlt-die-nationale-kohorte
Foto: Messung der Körperfettverteilung im Studienzentrum Berlin-Nord der Nationalen Kohorte auf dem Campus Berlin-Buch. (Foto: David Ausserhofer/Copyright: MDC)
forschen, produzieren, leben, bilden / 08.01.2015
Forscherferien im Februar auf dem Campus Berlin-Buch
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
Der Forschergarten hat noch einige freie Plätze in den Forscherferien auf dem Campus Berlin-Buch:
Montag, den 2. Februar 2014 von 9 - 17 Uhr (ab 11 Jahre)
Der Duft der Welt
Wie kommt man an den Duft der Rosen und anderer Pflanzen? Stelle selbst duftende Öle her. Darauf kannst du dann ein Parfüm kreieren und weitere gut riechende Produkte herstellen.
Mittwoch den 4. Februar 2013 von 9 - 17 Uhr (ab 13 Jahre)
Strom aus Hefe...
...und andere Energietricks. Wir spalten Wasser, speichern Energie mit Hilfe von Lithium, lassen Autos mit Solarkraft fahren und zapfen den Energiestoffwechsel der Hefe an.
Das komplette Programm und die Möglichkeit zum Anmelden finden Sie hier.
heilen, bilden / 08.01.2015
Akademie der Gesundheit übernimmt Landesrettungsschule Brandenburg
Dadurch sind die ab 01. 01. 2015 gesetzlich geregelte 3-jährige Ausbildung von Notfallsanitätern sowie zahlreiche Fort- und Weiterbildungen und auch eine Reihe von Arbeitsplätzen für das Land Brandenburg und für den Standort gesichert. „Für uns ist entscheidend“, so Jens Reinwardt, geschäftsführender Vorstand, „dass wir gemeinsam stärker sind und uns noch besser auf dem Bildungsmarkt im Gesundheitswesen positionieren können.“
Der traditionelle Schulstandort der Akademie, der bereits als Campus Bad Saarow bekannt ist in dem die Ausbildungen Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Gesundheits- und Krankenpflegehilfe ausgebildet werden bleibt erhalten und wird in Zukunft ein erweitertes Aus-, Fort- und Weiterbildungsprogramm den Einrichtungen des Gesundheitswesens in Brandenburg auch auf dem Gebiet Notfall- und Katastrophenschutz anbieten.
Damit hat die Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e.V. mit dem Campus in Berlin-Buch (Foto), dem Campus Eberswalde und dem Campus Bad Saarow von gegenwärtig 26 Einrichtungen Aufgaben der Aus- Fort und Weiterbildung übertragen bekommen.
Die Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e.V. ist mit seinen etwa 2.300 Teilnehmern in Aus-, Fort- und Weiterbildung in den verschiedenen Gesundheitsberufen eine der größten Bildungseinrichtungen des Gesundheitswesens in Deutschland.\n
Foto: Hauptgebäude der Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e.V. in Berlin-Buch. (Foto: BBB Management GmbH Campus Berlin-Buch)
forschen / 07.01.2015
Erneut ERC-Förderung für MDC-Diabetesforscherin Dr. Francesca Spagnoli
Diabetes ist eine Stoffwechselerkrankung, von der weltweit über 350 Millionen Menschen betroffen sind. Bei Patienten mit Typ 1 Diabetes sind die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse – sie produzieren das lebenswichtige Hormon Insulin, das den Blutzucker reguliert und die aufgenommene Nahrung in Energie umsetzt – durch eine fehlgeleitete Immunreaktion zerstört worden. Diese Patienten müssen ihr ganzes Leben Insulin spritzen. Typ-2 Diabetiker hingegen können das von den Beta-Zellen produzierte Insulin nicht ausreichend verwerten. Sie werden mit Diät und Medikamenten behandelt. Doch auch bei Typ-2 Diabetikern können die Beta-Zellen im Laufe der Jahre zugrunde gehen, so dass auch diese Patienten dann unter Umständen Insulin spritzen müssen.
Da die Insulinbehandlung jedoch schwere Nebenwirkungen hat, versuchen Ärzte seit langem, Patienten Beta-Zellen oder eine Bauchspeicheldrüse von Spendern zu verpflanzen, allerdings mit geringem Erfolg. „Zum einen gibt es nicht genügend Spender, zum anderen arbeiten die transplantierten Zellen oder das transplantierte Organ häufig nur sehr eingeschränkt, so dass die Patienten häufig nach fünf Jahren ein neues Transplantat benötigen oder erneut Insulin spritzen müssen“, erläutert Dr. Spagnoli.
Aus diesem Grund richten Forscher ihr Augenmerk auf zellbasierte Therapien. Derzeit werden verschiedene mögliche Quellen für Beta-Zellen erforscht, darunter embryonale Stammzellen und andere Zellarten. „Als besonders vielversprechend“ sieht Dr. Spagnoli die Umprogrammierung von Leberzellen in Bauchspeicheldrüsenzellen an. Leber und Bauchspeicheldrüse haben vieles gemeinsam. „Beide Organe“, so Dr. Spagnoli, „entstehen im Embryo in der gleichen Region. Sie spielen eine wichtige Rolle im Stoffwechsel und regulieren den Blutzuckerspiegel. Auch haben sie eine Reihe von Genen gemeinsam“.
Mit ihrer Forschung ist es Dr. Spagnoli gelungen, einen Faktor zu identifizieren, der Leberzellen der Maus in Bauchspeicheldrüsenzellen umwandelt. Mit ihrer PoC-Förderung will die Forscherin ihre Erkenntnisse auf Leberzellen des Menschen übertragen und herausfinden, ob sich damit eine auf den eigenen Leberzellen eines Patienten gestützte Therapie (autologe zellbasierte Therapie) entwickeln lässt. Ihre Entdeckung ist inzwischen beim Europäischen Patentamt in München zum Patent angemeldet.
\n
Foto: Dr. Francesa Spagnoli (Fotograf: David Ausserhofer/ Copyright: MDC)
leben, heilen / 06.01.2015
2.683 Babys im HELIOS Klinikum Berlin-Buch geboren
„Wir freuen uns über die anhaltende Beliebtheit der Bucher Geburtshilfe. Die werdenden Eltern schätzen die kompetente Betreuung unseres Teams aus Ärzten, Hebammen und Pflegekräften, die familienfreundliche und moderne Atmosphäre in der Geburtshilfe mit den vier Kreißsälen sowie die umfassende Versorgung kranker oder zu früh geborener Neugeborener im Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe“, sagt Professor Dr. med. Michael Untch, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im HELIOS Klinikum Berlin-Buch.
„Im Jahr 2014 haben wir 62 Frühgeborene unter 1.500 Gramm medizinisch versorgt. Neben der exzellenten medizinischen Betreuung der Babys steht unser Expertenteam natürlich auch den Eltern in dieser emotional angespannten Situation zur Seite“, ergänzt Professor Dr. med. Lothar Schweigerer, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und Leiter des Bucher Perinatalzentrums (Level 1).
„Sicher und individuell“ ist das Motto der geburtshilflichen Abteilung im HELIOS Klinikum Berlin-Buch. Neben einer modernen Geburtshilfe bietet das Klinikum auch eine umfassende Versorgung von Risikoschwangerschaften, Mehrlingsgeburten und Frühgeborenen. So arbeiten im Bucher Perinatalzentrum mit der höchsten Versorgungsstufe für Frühgeborene (Level 1), die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und die Klinik für Kinderchirurgie eng mit der Geburtshilfe zusammen. Diese intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit garantiert eine optimale Versorgung von Mutter und Kind vor, während und nach der Geburt und das rund um die Uhr.
Klinikkontakt:
HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Geburtshilfe
Schwanebecker Chaussee 50, in 13125 Berlin, Schwangerenberatung, Risikosprechstunde und Geburtsanmeldung unter (030) 9401-53345.
Jeden 1., 2. und 3. Dienstag im Monat findet um 17.30 Uhr ein Informationsabend statt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Unter www.helios-kliniken.de/berlin finden Sie weitere Informationen zur Geburtshilfe sowie zur HELIOS Elternschule „Haus Kugelrund“.
Foto: Das Team der Geburtshilfe der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe HELIOS Klinikum Berlin-Buch (HELIOS/Thomas Oberländer)\n
produzieren / 05.01.2015
Krebsforschung mit 3D-Zellkulturen
ersparen oder sogar das Leben retten. Die in vitro-Tumormodelle (in vitro: lat. ‚im Glas‘) können die klassischen in vivo-Experimente, die an lebenden Organismen wie beispielsweise Mäusen durchgeführt werden, ergänzen und ersetzen. Derzeit steckt das Projekt von Dr. Christian Regenbrecht und seinem Team noch in einer relativ frühen Entwicklungsphase, doch erste Studien profitieren bereits von der Arbeit des Unternehmens Cellular Phenomics & Oncology Berlin-Buch GmbH (CPO).
Das Verfahren, welches CPO entwickelt, simuliert die individuellen Eigenschaften eines Tumors in vitro: Aus einem etwa 3 x 3 x 3 mm großen Tumorstück, das bei einer OP entnommen wurde, lassen sich Zellkulturen herstellen. Sobald sich die Tumorzellen vermehren, können diese molekularbiologisch und pharmakologisch charakterisiert werden. Anhand der genetischen Signatur des Tumors kann eine Vorauswahl an geeigneten Medikamenten getroffen werden.
Bis zu 18 verschiedene Chemotherapeutika und Medikamente können gleichzeitig getestet werden. Die Ergebnisse der molekularbiologischen Untersuchungen und der Wirkstofftests liefern Hinweise auf die erfolgversprechendsten Therapieansätze. Auf Wunsch des Patienten werden die Zellkulturen eingefroren, um – falls nötig – später weitere Tests durchführen zu können. Dies ist sinnvoll, wenn inzwischen neue, besser passende Wirkstoffe zugelassen wurden.
„Ein Tumor ist wie ein komplexes Mosaik, dessen Zellen miteinander interagieren“, erläutert Regenbrecht. „Ein 3D-Zellkulturmodell ist das perfekte System, um den komplexen Aufbau eines Tumors zu simulieren“, so der promovierte Biologe. Speziell für die Behandlung von Dickdarmkrebs sei dieses Verfahren zunächst entwickelt worden.
Allerdings ist das 3D in vitro-Tumormodell nicht auf ärztliche Verordnung zu bekommen. Patienten müssen für das Analyseverfahren rund 5.000 Euro aus eigener Tasche bezahlen. „Für die Zukunft streben wir eine Querfinanzierung an, die es auch weniger wohlhabenden Kranken ermöglicht, unsere Tumormodelle für die Behandlung zu nutzen“, so Regenbrecht. Dieser Anspruch soll durch lukrative Forschungsarbeit für die Pharmaindustrie realisiert werden. Die großen Pharmaunternehmen werden von CPO momentan als Hauptzielgruppe und somit als Förderer und Finanzierer ausgemacht. Für sie testet CPO Wirkstoffe. Das Angebot: 384 Kombinationen aus Wirkstoffen und Tumoren können in nur einer einzigen Zellkulturplatte getestet werden. Dadurch wäre eine kostengünstige Entdeckung und Entwicklung neuer Wirkstoffe möglich.
Eine weitere Verfeinerung der 3D in vitro-Modelle ist unbestritten notwendig. Aber Christian Regenbrecht vermutet, dass die 3D-Zellkulturen in circa fünf bis zehn Jahren die gleiche Anerkennung haben werden wie heute in vivo-Modelle. „Möglicherweise könnte in Zukunft komplett auf in vivo-Modelle verzichtet werden“, so der Unternehmer.
Die Basis für die weitere Entwicklungsarbeit ist optimal. Seit September 2014 hat die CPO ihren Firmensitz auf dem Campus Buch und arbeitet in hochmodernen Laboren eng mit der Experimentellen Pharmakologie & Onkologie Berlin-Buch GmbH (EPO) zusammen. EPO ist auf individuelle Tumormodelle spezialisiert und unterstützt mit ihren Dienstleistungen sowohl die Grundlagen- als auch die angewandte Forschung für Innovationen in der Krebstherapie. Geleitet wird das Unternehmen von Pharmazeut Dr. Jens Hoffmann, der in der Forschung ein hohes Renommee als Onkologie- und Pharmaspezialist genießt. Hoffmann war auch Regenbrechts Mentor und inspirierte den 39jährigen zur Gründung von CPO. Beide Unternehmen profitieren nun vom Know-how des jeweils anderen und den entstehenden Synergieeffekten.
Momentan besteht das Team des jungen Unternehmens aus fünf Krebsspezialisten. Neben Regenbrecht und Mitgründer Hoffmann sind es Dr. Yvonne Welte, langjährige Mitarbeiterin von Regenbrecht, Dr. Alessandra Silvestri sowie Doktorandin Maxine Sil’vestrov.
„Gemeinsam wollen wir die 3D-Modelle technisch und biologisch weiterentwickeln“, so Regenbrecht, der bis 2015 noch eine halbe Stelle als Arbeitsgruppenleiter an der Charité innehat. Für CPO hat er ehrgeizige Pläne: Bis 2020 soll die Belegschaft auf 30 Mitarbeiter anwachsen.\n
Foto: CPO-Chef Dr. Christian Regenbrecht mit Maxine Sil’vestrov (links) und Dr. Yvonne Welte
Text und Foto: Michaela-Nicola Riedemann
- News
- Termine
- Standortjournal „buchinside“
- Presseservice/Download
-
News Archiv
- Archiv News 2025
- Archiv News 2024
- Archiv News 2023
- Archiv News 2022
- Archiv News 2021
- Archiv News 2020
- Archiv News 2019
- Archiv News 2018
- Archiv News 2017
- Archiv News 2016
- Archiv News 2015
- Archiv News 2014
- Archiv News 2013
- Archiv News 2012
- Archiv News 2011
- Archiv News 2010
- Archiv News 2009
- Archiv News 2008